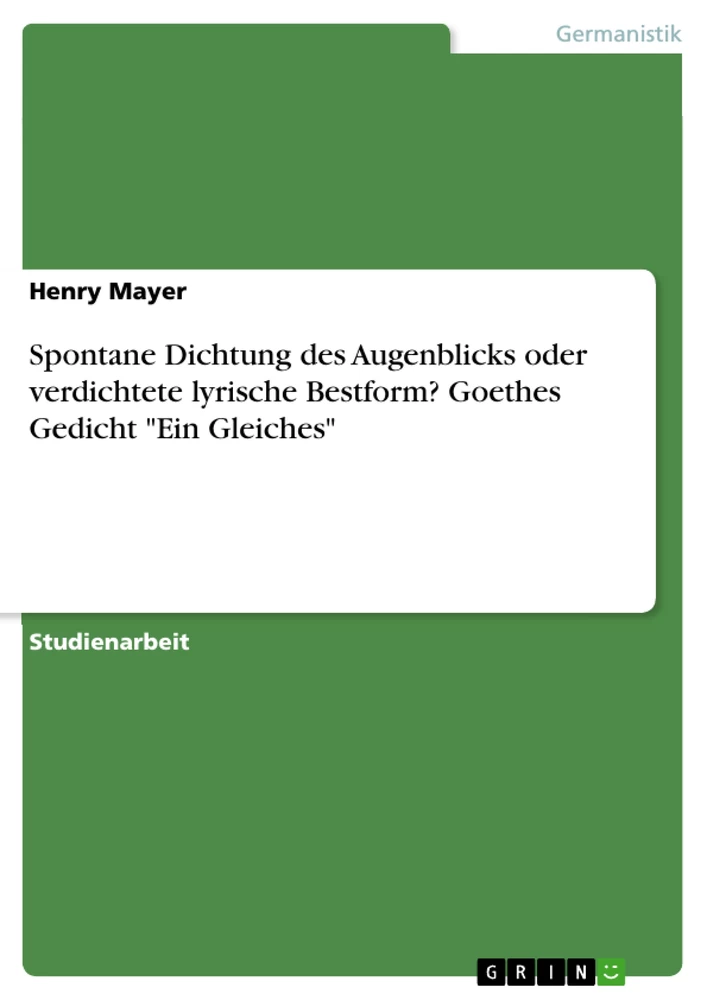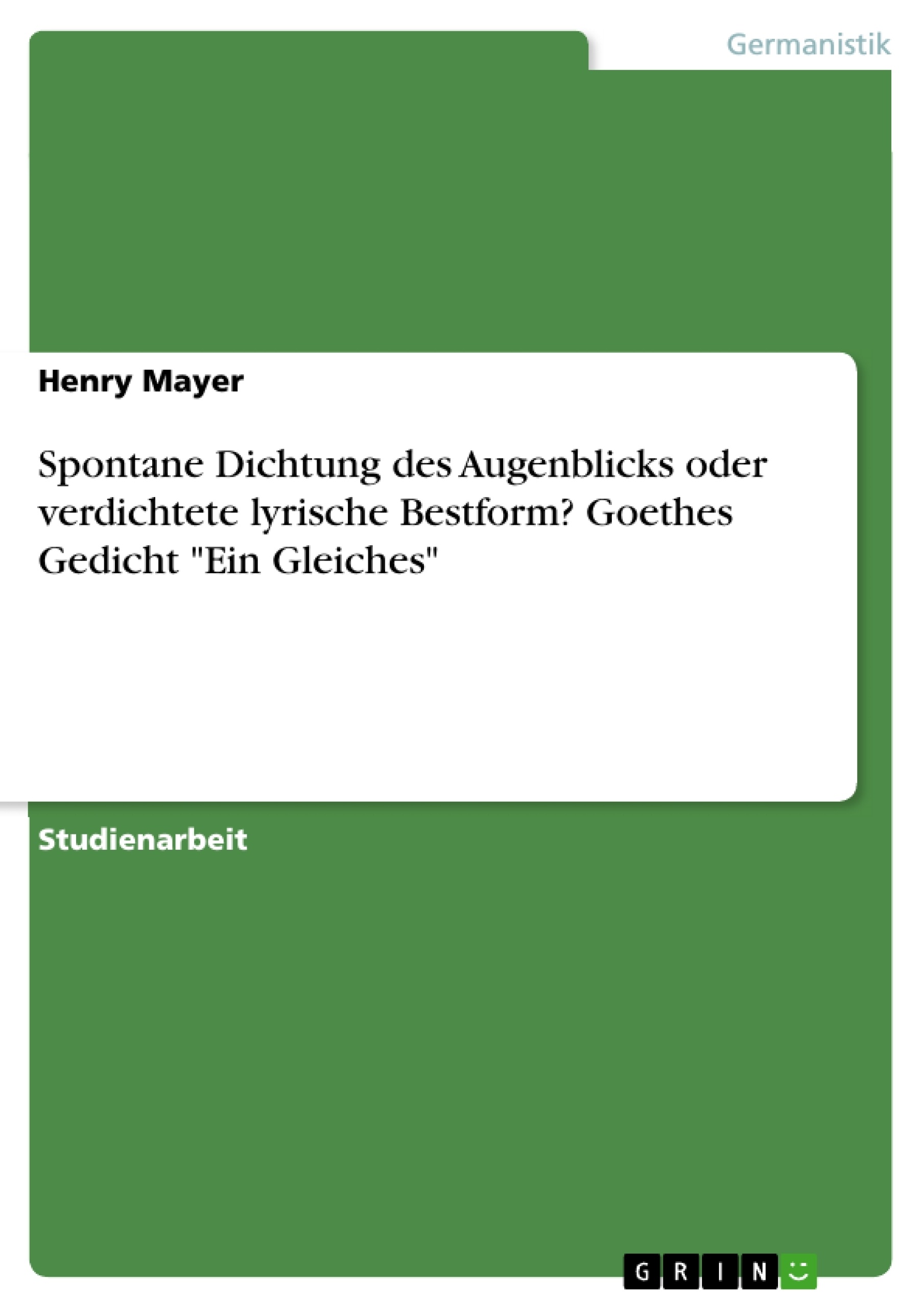Das Gedicht "Ein Gleiches", verfasst im Jahre 1780, gilt als eines der bekanntesten, wenn nicht sogar als das bekannteste der lyrischen Werke Johann Wolfgang von Goethes (1749-1832). Dies wird mit der breiten Rezeption bereits zu Lebzeiten des Autors und mit dem daraus entstandenen Kult um das Gedicht begründet. Bedeutsam ist dabei die Tatsache, dass es sich bei "Ein Gleiches" um ein vergleichbar knappes lyrisches Werk handelt, welches zudem über einen auf den ersten Blick unverständlichen Titel verfügt.
Die vorliegende Arbeit widmet sich diesem Gedicht Goethes. Die knappe Form des lyrischen Werks und seine Entstehungsbedingungen lassen eine spontane Dichtung vermuten, während der hohe Bekanntheitsgrad Anlass und Gründe zur Vermutung liefert, dass selbst in diesem kurzen Gedicht die Dichtungsprinzipien Goethes zur Anwendung kommen. Deswegen soll untersucht werden, ob es sich bei "Ein Gleiches" um eine spontane Dichtung des Augenblicks handelt oder ob hier das lyrische Schaffen Goethes trotz der Kürze des Werks in Reinform deutlich wird. Handelt es sich somit um ein simples Gelegenheitsgedicht oder um eine überlegte Naturinszenierung in verdichteter lyrischer Bestform?
Die Beantwortung dieser Frage erfolgt in vier Schritten. Zunächst werden die Entstehungs- und Überlieferungs- sowie die Rezeptionsgeschichte von "Ein Gleiches" dargestellt, bevor das Gedicht in einem zweiten Schritt formal und inhaltlich analysiert wird. Hierbei wird das im Jahre 1776 entstandene Gedicht "Wandrers Nachtlied" mit in die Analyse einbezogen, da Goethe dieses dem zu untersuchenden Gedicht bei dessen Erstveröffentlichung im Jahre 1815 voranstellte. Außerdem wird in diesem Zusammenhang die musikalische Rezeption des Gedichts von Carl Friedrich Zelter und Franz Schubert mit ihrem interpretatorischen Gehalt bei der Analyse berücksichtigt. In einem dritten Schritt werden die Begriffe "Gelegenheitsgedicht" sowie "Erlebnisdichtung" in Bezug auf das lyrische Schaffen Goethes definiert, um dann im vierten und letzten Schritt abschließend ein Fazit zu ziehen, ob man "Ein Gleiches" als spontane Dichtung des Augenblicks oder aber als "eines der reinsten Beispiele lyrischen Stils" und damit als exemplarischen Ausdruck für Goethes Dichten und Denken bezeichnen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Zur Bedeutung des Gedichts
- 1.1 Entstehungs-, Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte
- 1.2 Der Prozess der „Verkultung des Textes“
- 2. Gedichtsanalyse
- 2.1 Wandrers Nachtlied
- 2.2 Ein Gleiches: Formale Analyse
- 2.3 Ein Gleiches: Inhaltliche Analyse
- 2.3.1 Erwiderung der Todessehnsucht
- 2.3.2 Gleichnis für Gesetzmäßigkeiten in der Welt
- 2.4 Musikalische Interpretation des Gedichts
- 2.4.1 Die Vertonung Zelters 1814
- 2.4.2 Die Vertonung Schuberts 1823
- 3. Zum Erlebnis- und Gelegenheitsbegriff
- 3.1 Der Erlebnisbegriff und die Goethesche Lyrik
- 3.2 Goethe und das Gelegenheitsgedicht
- 4. Schlussbetrachtung: Ein Gleiches als verdichtete lyrische Bestform?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Goethes Gedicht „Ein Gleiches“, welches trotz seiner Kürze einen hohen Bekanntheitsgrad genießt. Ziel ist es zu klären, ob das Gedicht eine spontane Reaktion auf einen Moment darstellt oder ob es trotz seiner Knappheit die typischen Prinzipien von Goethes lyrischem Schaffen widerspiegelt. Die Analyse fokussiert auf die Frage, ob es sich um ein einfaches Gelegenheitsgedicht oder um ein Werk in verdichteter lyrischer Bestform handelt.
- Entstehungsgeschichte und Rezeption von „Ein Gleiches“
- Formale und inhaltliche Analyse des Gedichts im Vergleich zu „Wandrers Nachtlied“
- Musikalische Interpretationen des Gedichts durch Zelter und Schubert
- Der Begriff des Erlebnis- und Gelegenheitsgedichts in Goethes Lyrik
- Bewertung von „Ein Gleiches“ als spontane Dichtung oder verdichtete lyrische Bestform
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Natur von Goethes „Ein Gleiches“ als spontane Dichtung oder als Beispiel verdichteter lyrischer Bestform. Es skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte, die formale und inhaltliche Analyse, die musikalische Rezeption und die Einordnung in den Kontext von Erlebnis- und Gelegenheitsgedicht umfasst.
1. Zur Bedeutung des Gedichts: Dieses Kapitel behandelt die Entstehungs-, Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte von „Ein Gleiches“. Es beleuchtet die Entstehung des Gedichts am Kickelhahn im Jahr 1780, die Überlieferung durch eine beschriftete Bretterwand einer Jagdhütte und die daraus resultierende kultische Verehrung des Gedichts. Der Brand der Hütte und die eingeschränkte Aussagekraft der erhaltenen Fotografie des Textes werden ebenfalls diskutiert. Die breite Rezeption zu Goethes Lebzeiten und der daraus entstandene Kult um das Gedicht werden als wichtige Faktoren für seine Bedeutung hervorgehoben.
2. Gedichtsanalyse: Dieses Kapitel widmet sich einer detaillierten Analyse von „Ein Gleiches“, sowohl formal als auch inhaltlich. Dabei wird ein Vergleich mit Goethes „Wandrers Nachtlied“ gezogen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervorzuheben und das Verständnis von „Ein Gleiches“ zu vertiefen. Die Analyse deckt verschiedene Interpretationsansätze ab, darunter die Erwiderung der Todessehnsucht und die Darstellung von Gesetzmäßigkeiten der Welt. Die musikalischen Vertonungen durch Zelter und Schubert werden in Bezug auf ihren interpretatorischen Gehalt berücksichtigt, um die vielschichtigen Ebenen der Rezeption des Gedichts aufzuzeigen.
3. Zum Erlebnis- und Gelegenheitsbegriff: Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Erlebnisdichtung“ und „Gelegenheitsgedicht“ im Kontext von Goethes lyrischem Schaffen. Es untersucht, wie diese Begriffe auf „Ein Gleiches“ angewendet werden können, und trägt damit zur Klärung der zentralen Forschungsfrage bei. Die Kapitel analysiert Goethes Verständnis von Lyrik und den Einfluss von Erlebnis und Anlass auf sein lyrisches Schaffen. Diese Analyse bietet einen wichtigen Rahmen für die Bewertung von „Ein Gleiches“ im abschließenden Kapitel.
Schlüsselwörter
Goethe, Ein Gleiches, Wandrers Nachtlied, Lyrik, Gedichtsanalyse, Entstehungsgeschichte, Rezeptionsgeschichte, Gelegenheitsgedicht, Erlebnisdichtung, formale Analyse, inhaltliche Analyse, musikalische Interpretation, Zelter, Schubert, lyrische Bestform, Todessehnsucht, Naturlyrik.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes „Ein Gleiches“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Goethes Gedicht „Ein Gleiches“ und untersucht, ob es sich um ein spontanes Gelegenheitsgedicht oder ein Werk in verdichteter lyrischer Bestform handelt. Die Analyse betrachtet Entstehungsgeschichte, Rezeption, formale und inhaltliche Aspekte sowie musikalische Interpretationen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in ein Vorwort, vier Hauptkapitel und ein Fazit. Kapitel 1 behandelt die Bedeutung des Gedichts, inklusive Entstehungs-, Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte. Kapitel 2 analysiert das Gedicht formal und inhaltlich, vergleicht es mit „Wandrers Nachtlied“ und berücksichtigt musikalische Interpretationen. Kapitel 3 beleuchtet den Erlebnis- und Gelegenheitsbegriff in Goethes Lyrik. Das abschließende Kapitel bewertet „Ein Gleiches“ als spontane Dichtung oder verdichtete lyrische Bestform.
Wie wird die Entstehungsgeschichte von „Ein Gleiches“ behandelt?
Die Entstehungsgeschichte wird im ersten Kapitel ausführlich dargestellt. Sie beschreibt die Entstehung am Kickelhahn 1780, die Überlieferung durch eine beschriftete Bretterwand einer Jagdhütte und den darauf folgenden Kult um das Gedicht, inklusive des Brandes der Hütte und der eingeschränkten Aussagekraft der erhaltenen Fotografie des Textes.
Welche Rolle spielen musikalische Interpretationen in der Analyse?
Die musikalischen Vertonungen von Zelter (1814) und Schubert (1823) werden in Kapitel 2 betrachtet. Die Analyse untersucht deren interpretatorischen Gehalt und ihren Beitrag zum Verständnis des Gedichts und seiner vielschichtigen Rezeption.
Wie wird „Ein Gleiches“ mit „Wandrers Nachtlied“ verglichen?
Kapitel 2 vergleicht „Ein Gleiches“ mit „Wandrers Nachtlied“, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und so das Verständnis von „Ein Gleiches“ zu vertiefen. Dieser Vergleich dient der vertieften Analyse der formalen und inhaltlichen Aspekte.
Welche Interpretationsansätze werden für „Ein Gleiches“ diskutiert?
Die inhaltliche Analyse in Kapitel 2 umfasst verschiedene Interpretationsansätze, darunter die Erwiderung der Todessehnsucht und die Darstellung von Gesetzmäßigkeiten der Welt.
Welche Begriffe werden im Kontext von Goethes Lyrik definiert und untersucht?
Kapitel 3 befasst sich mit der Definition und Untersuchung der Begriffe „Erlebnisdichtung“ und „Gelegenheitsgedicht“ im Kontext von Goethes lyrischem Schaffen, um die zentrale Forschungsfrage nach der Natur des Gedichts zu beantworten.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob Goethes „Ein Gleiches“ ein spontanes, auf einen Moment reagierendes Gedicht ist oder ob es trotz seiner Kürze die typischen Prinzipien von Goethes lyrischem Schaffen widerspiegelt und als verdichtete lyrische Bestform verstanden werden kann.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Ein Gleiches, Wandrers Nachtlied, Lyrik, Gedichtsanalyse, Entstehungsgeschichte, Rezeptionsgeschichte, Gelegenheitsgedicht, Erlebnisdichtung, formale Analyse, inhaltliche Analyse, musikalische Interpretation, Zelter, Schubert, lyrische Bestform, Todessehnsucht, Naturlyrik.
- Quote paper
- Henry Mayer (Author), 2008, Spontane Dichtung des Augenblicks oder verdichtete lyrische Bestform? Goethes Gedicht "Ein Gleiches", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/91649