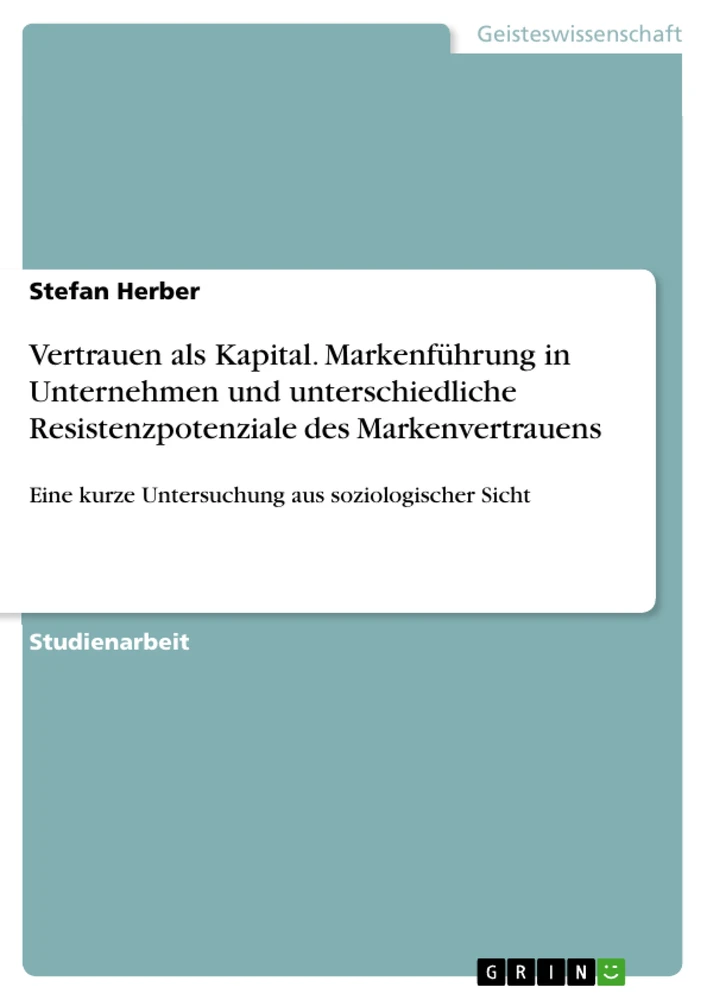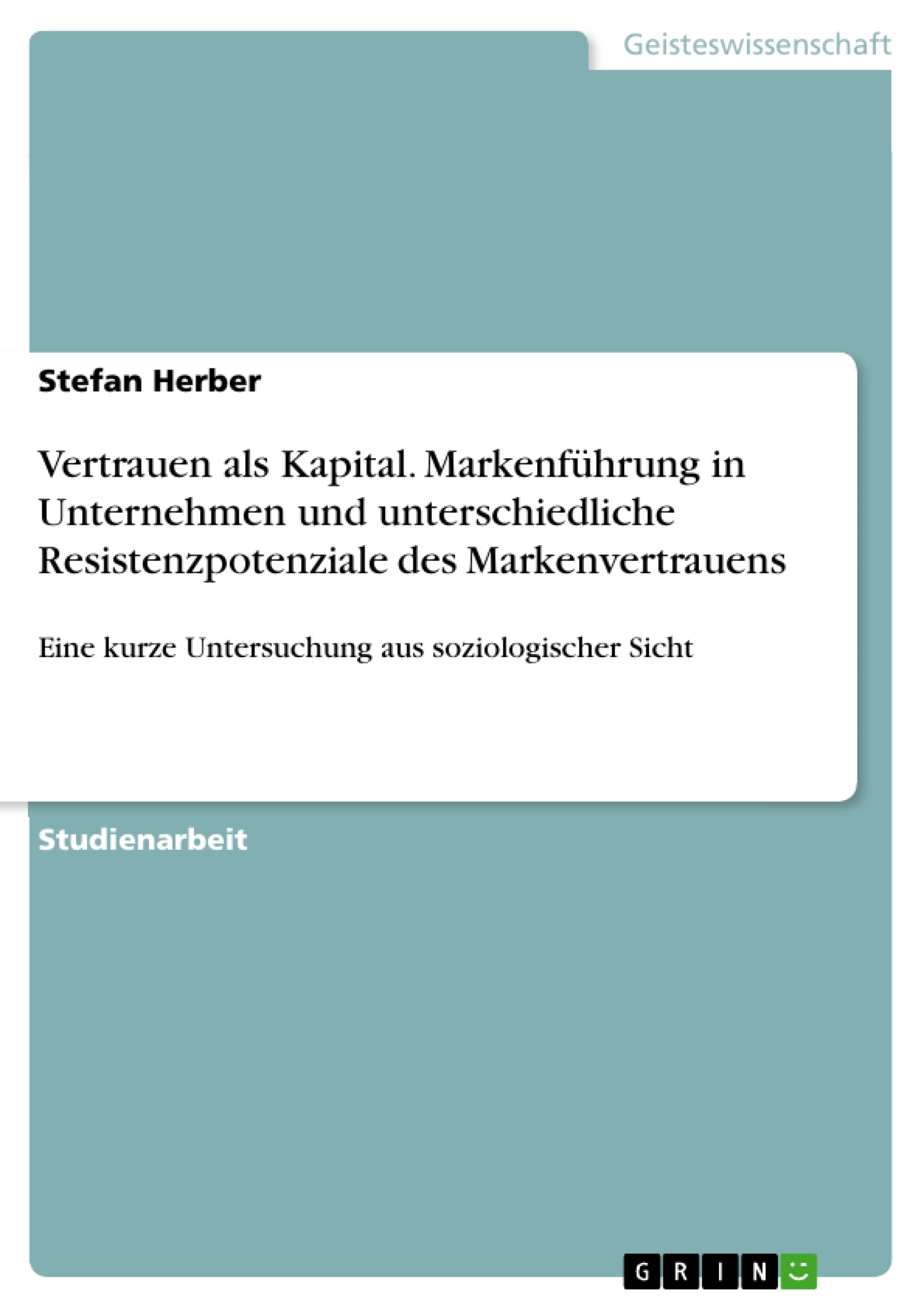Ziel dieser Arbeit soll es sein, aus einer soziologischen Perspektive zu untersuchen, wie so Vertrauensstrukturen scheinbar unterschiedlich resistenten Potentiale des Vertrauens je nach Art der jeweiligen Marke entstehen. Dazu sollen nach einer Einbettung des Vertrauensbegriffes in den theoretischen Kontext der Markensoziologie einige prototypische Beispiele von „Markenskandalen“ erläutert und anhand der Ergebnisse jüngster Marktstudien analysiert werden, ob sich der vermutete Zusammenhang zwischen Kritik, Art der Marke und Resistenz des Vertrauens feststellen lässt oder zumindest als plausibel angenommen werden kann sowie darüber hinaus der Versuch, mögliche Ursachen dessen herauszuarbeiten.
Vertrauen gilt mit als das wichtigste Kapital von Marken und dessen Produktion als die zentrale Aufgabe in der Markenführung von Unternehmen. Da auf Märkten allerdings stets das Risiko besteht, getäuscht zu werden, und dieses selbst durch umfassendste Verträge nie ganz beseitigt werden kann, bedarf es des Vertrauens in ganz besonderer Weise, um dennoch Transaktionen zu ermöglichen. Marken erfüllen diese Funktion genuin.
Vertrauen kann jedoch auch erschüttert werden oder gar vollkommen verloren bzw. untergehen, wenn spezifische Erwartungen nicht erfüllt und somit enttäuscht werden. Diesem Risiko müssten grundsätzlich also auch Unternehmen und ihre Identität als Marke ausgesetzt sein.
Inhaltsverzeichnis
- MARKENVERTRAUEN UND MARKENKRITIK
- VERTRAUEN UND MARKE IN DER MARKENSOZIOLOGIE
- VERTRAUEN AUS SOZIOLOGISCHER PERSPEKTIVE
- MARKEN ALS KOMMUNIKAtion: VertrauEN „IN“ CODE UND PROGRAMM
- VERTRAUENSBRUCH UND -VERLUST: MAẞNAHMEN DER MARKENFÜHRUNG
- ZUSAMMENHANG MARKE – KRITIK – VERTRAUENSPOTENTIALE: VERGLEICH UND DISKUSSION
- BEISPIEL RETAIL BRANDS (ALDI)
- BEISPIEL FMCG MARKEN (NESTLÉ)
- EMPIRISCHE DATEN ZU ALDI UND NESTLÉ
- DISKUSSION DES VERMUTETEN ZUSAMMENHANGS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel der Arbeit ist es, die Entstehung von Vertrauensstrukturen und deren Resistenzpotential in Bezug auf verschiedene Markengattungen aus soziologischer Perspektive zu untersuchen. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse von „Markenskandalen“ und dem vermeintlichen Zusammenhang zwischen Kritik, Art der Marke und der Widerstandsfähigkeit von Markenvertrauen.
- Markenvertrauen und dessen Bedeutung in der Markensoziologie
- Die Rolle von Markenkritik und deren Einfluss auf das Markenvertrauen
- Analyse von Fallbeispielen aus dem Bereich der „Retail Brands“ und „FMCG Brands“
- Untersuchung der Resistenz des Markenvertrauens gegenüber Kritik
- Herausarbeitung möglicher Ursachen für unterschiedliche Resistenzpotenziale
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Vertrauen für Marken und die zentrale Rolle der Markenführung in der Produktion von Vertrauen. Es wird der Aspekt des Vertrauensverlustes durch Enttäuschung von Erwartungen sowie das Risiko von „Markenskandalen“ im Kontext von Medienberichten und -debatten behandelt.
- Im zweiten Kapitel wird der Vertrauensbegriff im Kontext der Markensoziologie eingeordnet. Marken werden als soziale Phänomene und Kommunikationsinstrumente betrachtet, die Lebenswelten prägen und mit Menschen in Wechselwirkung stehen.
- Das dritte Kapitel vergleicht und diskutiert die Beziehung zwischen Marke, Kritik und Vertrauenspotentialen anhand von zwei Fallbeispielen: „Retail Brands“ (z.B. Aldi) und „FMCG Brands“ (z.B. Nestlé). Es werden empirische Daten zu den beiden Marken und deren Widerstandsfähigkeit gegenüber Kritik analysiert.
Schlüsselwörter
Markenvertrauen, Markenkritik, Markensoziologie, Retail Brands, FMCG Brands, Vertrauensverlust, Markenkommunikation, Medienberichte, Markenskandale, empirische Daten, Resistenzpotential.
- Arbeit zitieren
- Stefan Herber (Autor:in), 2013, Vertrauen als Kapital. Markenführung in Unternehmen und unterschiedliche Resistenzpotenziale des Markenvertrauens, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/912119