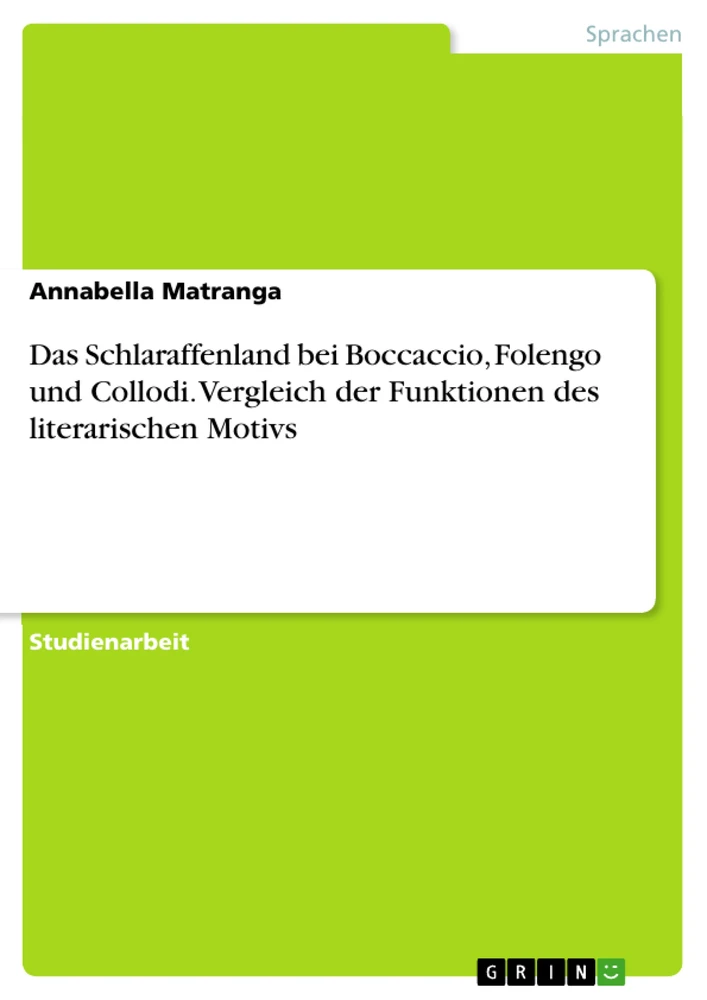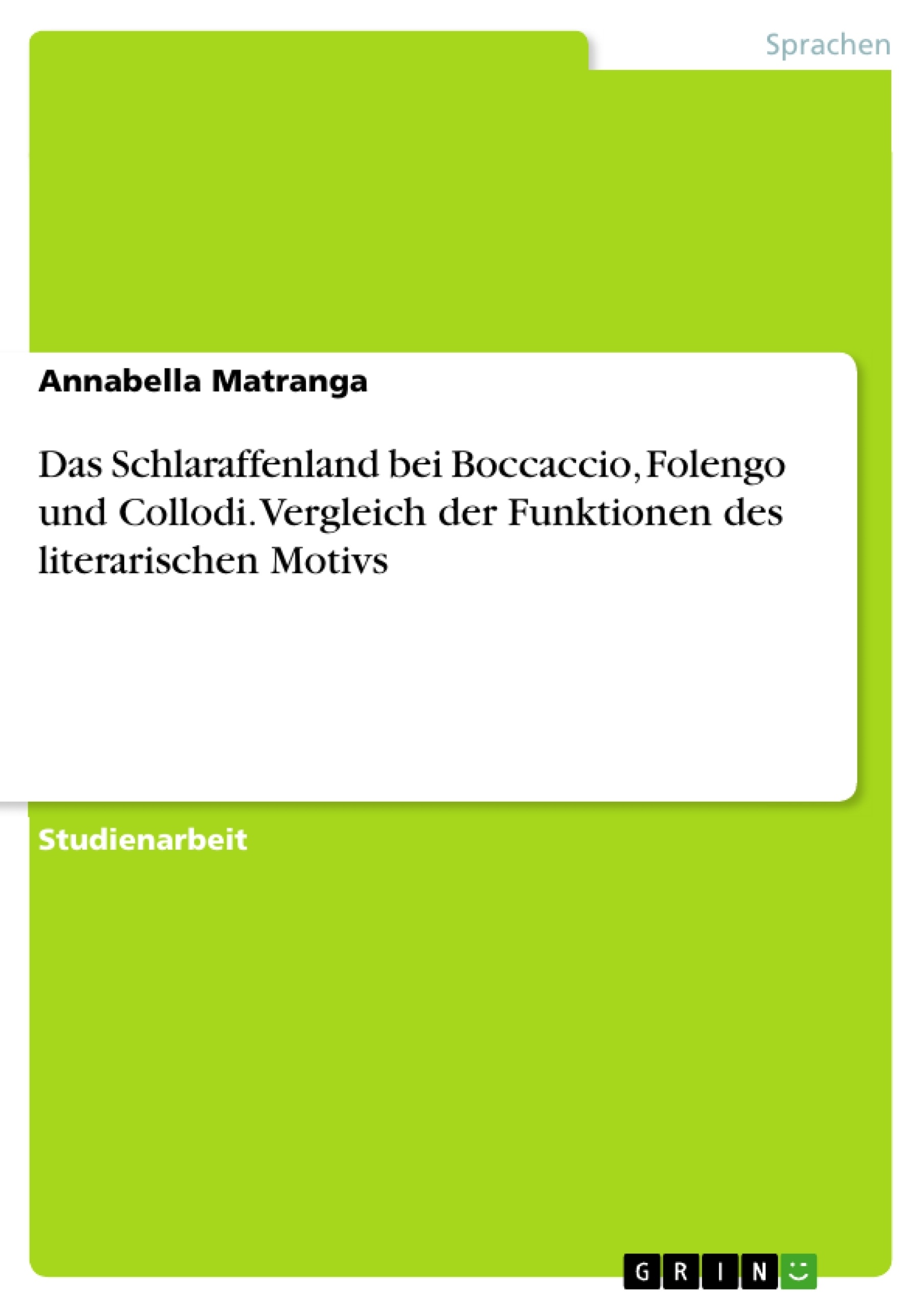Der Begriff cuccagna taucht sowohl in Märchen, in prosaischen Texten als auch in Romanen auf. Bereits der Wortstamm coquina spiegelt eines der Hauptmotive des Schlaraffenlandes wider, welches vor allem im Opus maccaronicum von Teofilo Folengo, veröffentlicht 1517 in Venedig, unter dem Pseudonym Merlin Cocai, eine zentrale Bedeutung einnimmt. Im ersten der 17 Bücher, die die grotesk-komischen Abenteuer von Baldus erzählen, wird mit einem konstruierten Küchenlatein auf die Parodie des Humanismus abgezielt. Das ähnlich lautende französische Wort coquin (Narr) deutet ebenfalls auf die Motive des Schlaraffenlandes hin. Besonders in der dritten Novelle des achten Tages aus der Novellensammlung Decamerone des frühhumanistischen Dichters der Renaissance Giovanni Boccaccio ist dieses Motiv von Wichtigkeit, denn im Zentrum dieser Novelle steht die naive Figur Calandrino, die dem Typus des bäuerlichen Tölpels entspricht und von seinen Freunden durch Lügengeschichten hinters Licht geführt wird.
Der mittelhochdeutsche Begriff sluraffe lässt sich auch mit Faulenzer übersetzen. Das Motiv des Nichts-Tuns stellt vor allem in der Geschichte Pinocchios einen zentralen Aspekt dar, denn in dem Werk "Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino" von Carlo Collodi, 1883 in Buchform erschienen, lässt sich die lebendige Holzpuppe Pinocchio, statt in die Schule zu gehen, dazu verleiten das schlaraffische Spielzeugland zu besuchen. Alle drei Werke weisen interessante Schlaraffenlandbeschreibungen mit unterschiedlichen Funktionen auf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand zum Stoff und zur Gattung des Schlaraffenlandes
- Kulturwissenschaftlicher Forschungsansatz nach Roßbach
- Veltens Diskussion über Utopie und Mythos
- Funktion der bugia und der beffa bei Boccaccio
- Vergleich der didaktischen Funktionen bei Boccaccio und Collodi
- Folengos Makkaronik als Parodie des humanistischen Diskurses
- Vergleich der essbaren Welten von Boccaccio und Folengo
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die verschiedenen Funktionen des Schlaraffenlandes in den Werken von Giovanni Boccaccio, Carlo Collodi und Teofilo Folengo. Dabei wird der Vergleich der verschiedenen Schlaraffenlandbeschreibungen und ihrer Funktionen in den jeweiligen literarischen Kontexten im Vordergrund stehen.
- Die Entwicklung und Funktion des Schlaraffenlandes als literarisches Motiv
- Der Vergleich der Schlaraffenlandbeschreibungen in den Werken von Boccaccio, Collodi und Folengo
- Die Rolle der Schlaraffenlandmotive in den jeweiligen literarischen Kontexten
- Die unterschiedlichen Funktionen des Schlaraffenlandes in den Werken der drei Autoren
- Die Bedeutung des Schlaraffenlandes für die literarische Tradition
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Forschungsfrage und das Thema der Arbeit vor. Sie beleuchtet die literarische Tradition des Schlaraffenlandes und skizziert die wichtigsten Forschungsbereiche. Darüber hinaus werden die drei zentralen Autoren der Arbeit, Boccaccio, Collodi und Folengo, vorgestellt.
- Forschungsstand: Dieses Kapitel befasst sich mit den Forschungsansätzen von Nikola Roßbach und Hans Rudolf Velten zum Thema Schlaraffenland. Roßbach untersucht den kulturwissenschaftlichen Kontext des Schlaraffenlandes, während Velten die literarische Gattung des Schlaraffenlandes im Hinblick auf Utopie und Mythos analysiert.
- Funktion der bugia und der beffa bei Boccaccio: Dieses Kapitel beleuchtet die Funktion der Lüge und der Täuschung in Boccaccios Werk Decamerone. Im Fokus steht die Novelle von Calandrino, die die naive Figur des bäuerlichen Tölpels darstellt.
- Vergleich der didaktischen Funktionen bei Boccaccio und Collodi: Dieses Kapitel vergleicht die didaktischen Funktionen des Schlaraffenlandes bei Boccaccio und Collodi. Es wird die Frage untersucht, wie das Schlaraffenland in beiden Werken zur Vermittlung von moralischen und didaktischen Botschaften eingesetzt wird.
- Folengos Makkaronik als Parodie des humanistischen Diskurses: Dieses Kapitel analysiert das Werk Opus maccaronicum von Teofilo Folengo. Es werden die parodistischen Elemente des Werkes und die Funktion der Küchensprache untersucht. Der Fokus liegt auf der Kritik des humanistischen Diskurses.
- Vergleich der essbaren Welten von Boccaccio und Folengo: Dieses Kapitel vergleicht die Beschreibungen der essbaren Welten in den Werken von Boccaccio und Folengo. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Schlaraffenlandvarianten untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die literarische Tradition des Schlaraffenlandes, insbesondere auf seine verschiedenen Funktionen in den Werken von Giovanni Boccaccio, Carlo Collodi und Teofilo Folengo. Zu den Schlüsselbegriffen zählen Schlaraffenland, cuccagna, coquaigne, Utopie, Mythos, Parodie, didaktische Funktion, literarische Tradition, bugia, beffa, Makkaronik, essbare Welt.
- Quote paper
- Annabella Matranga (Author), 2020, Das Schlaraffenland bei Boccaccio, Folengo und Collodi. Vergleich der Funktionen des literarischen Motivs, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/911833