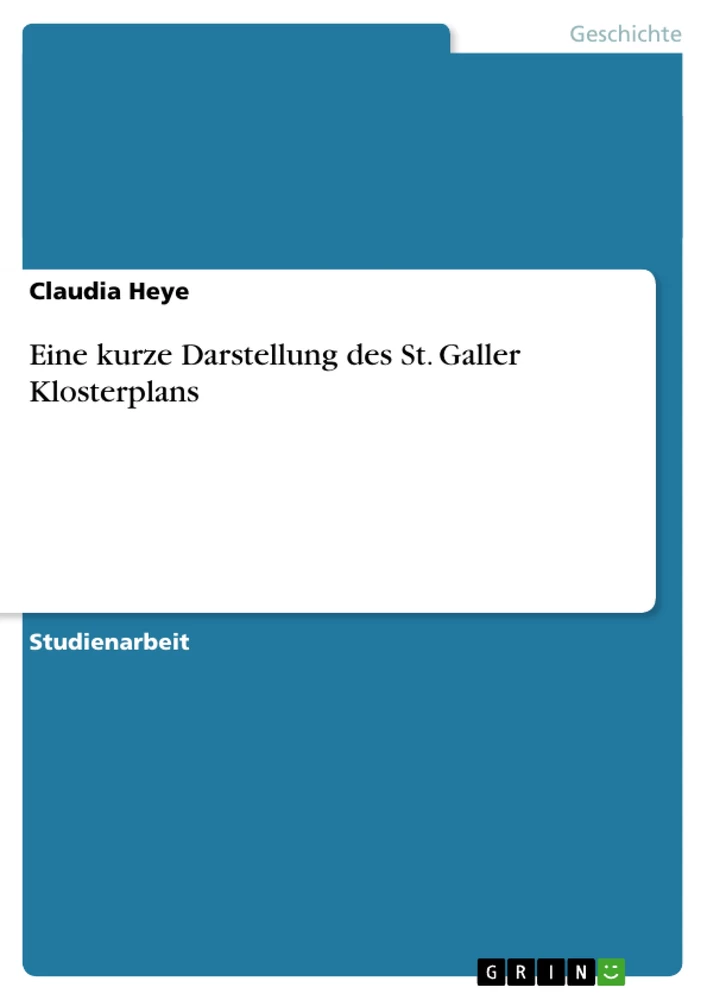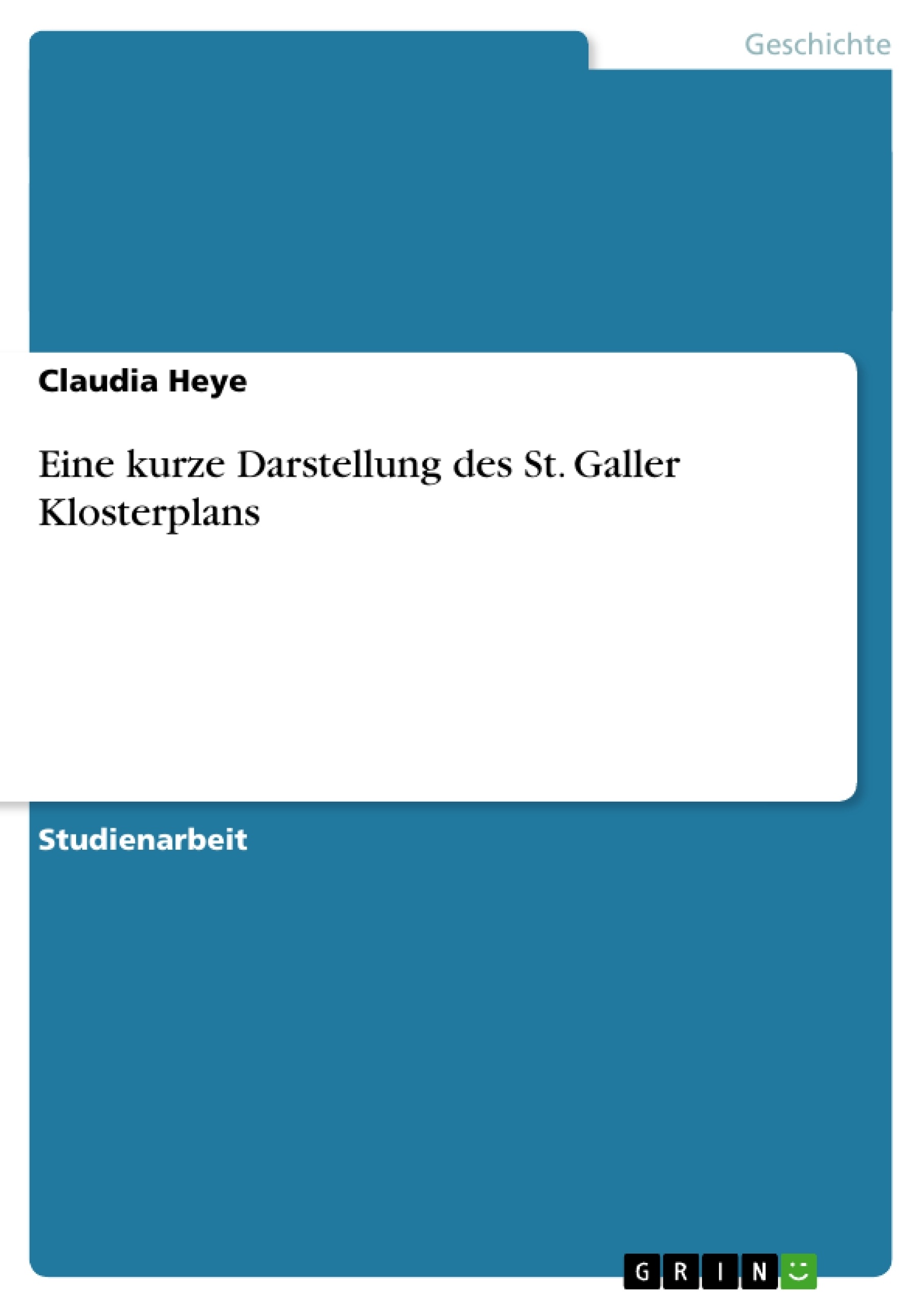Einleitung
In der Stiftsbibliothek von St. Gallen befindet sich die Kopie eines karolingischen Klosterplans, die zwischen 826 und 830 im Kloster Reichenau angefertigt wurde, es handelt sich um den so genannten St. Galler Klosterplan#. Die komplexen Bedürfnisse eines karolingischen Klosters sind in diesem Entwurf bis zur Perfektion befriedigt und gestaltet worden.
Auf dem Klosterplan ist der Grundriss einer Klosteranlage mit 55 festen Bauten und 341 Inschriften aufgetragen, die zum Teil in Versform auf die Bedeutung der Gebäude hinweisen. Mit und am Klosterplan ist viel geforscht worden.
Bereits 1604 hat Heinrich Cansius die metrischen Inschriften des Plans veröffentlicht,
1704 erschien die Zeichnung in einem Kupferstich von Jean Mabillon, 1844 brachte Ferdinand Keller den Plan in einem Steindruck heraus. Seit 1952 existiert ein Faksimile des Klosterplans, das im Offsetdruckverfahren in acht Farben hergestellt wurde und der Forschung enormen Auftrieb gegeben hat.
Es gibt in der Wissenschaft keinen Zweifel darüber, dass es sich beim St. Galler Klosterplan um eine Kopie, genauer um eine Pause und nicht um eine Originalzeichnung handelt#. Der Plan muss in einer warmen Gegend also im Süden entstanden sein, da die im Plan angelegte zweckmäßige Ausrichtung der Gebäude so nur in einem warmen Landstrich Sinn macht. Im Plan bekommen daher alle wichtigen Gebäude einen “kühlen” Platz im Plan zugewiesen, wie z.B. die Bibliothek, das Skriptorium, die Schule und die Abtspfalz. Die Versorgungseinrichtungen des Klosters werden im Idealplan im Süd-Westen angesiedelt. Uneinigkeit besteht in der Forschung über die genaue Entstehungszeit der Originalvorlage des Klosterplans. Einige Wissenschaftler vertreten die Ansicht, dass die Originalvorlage des Klosterplans während der Aachener Reformsynoden von 816 bis 817 hergestellt wurde#. Konrad Hecht datiert die Entstehung bereits auf 792 und führt dies auf die “basilika praegandis” des Reformabts Benedikt von Aniane zurück.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der St. Galler Klosterplan
- Die Beschreibung des Planes
- Die Art der Darstellung
- Beschreibung von Schreibstube, Bibliothek und Schule im Plan
- Entstehung des St. Galler Klosterplanes und die Regula Benedicti
- Die Entstehung des St. Galler Klosterplanes
- Die Benediktinerregel
- Schreibstube, Bibliothek und Schule im 9. - 11. Jahrhundert
- Die Schreibstube
- Die Bibliothek
- Die Schule
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat untersucht den St. Galler Klosterplan, eine karolingische Klosterplankopie aus dem 9. Jahrhundert. Ziel ist es, die Darstellung von Schreibstube, Bibliothek und Schule im Plan zu analysieren und ihre Funktion und Ausstattung im Kontext der Regula Benedicti zu erläutern. Weiterhin soll ein allgemeiner Überblick über die frühmittelalterlichen Inhalte dieser Begriffe gegeben werden.
- Analyse des St. Galler Klosterplanes als Quelle für die frühmittelalterliche Klosterarchitektur.
- Beschreibung und Interpretation der dargestellten Schreibstube, Bibliothek und Schule.
- Zusammenhang zwischen dem Klosterplan und der Regula Benedicti.
- Untersuchung der Entstehung und des Entstehungskontextes des Planes.
- Einordnung der dargestellten Einrichtungen in den frühmittelalterlichen Kontext.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den St. Galler Klosterplan als Kopie eines karolingischen Klosterplanes aus dem Kloster Reichenau (826-830). Sie betont die Komplexität des Planes und die umfangreiche Forschung dazu. Die Einleitung skizziert den Aufbau des Referates und die verwendeten Quellen, insbesondere die Arbeit von Konrad Hecht ("Der St. Galler Klosterplan"). Sie hebt die Bedeutung des Planes als Quelle für das Verständnis frühmittelalterlicher Klosterstrukturen hervor und kündigt die detaillierte Untersuchung der Schreibstube, Bibliothek und Schule an, die im Kontext der Regula Benedicti beleuchtet werden sollen.
1. Der St. Galler Klosterplan: Dieses Kapitel beschreibt den St. Galler Klosterplan detailliert. Es beleuchtet die physischen Eigenschaften des Plans (Material, Größe, Schrift, Zeichentechnik) und analysiert die 341 lateinischen Inschriften, die Bauwerke, Räume und deren Ausstattung beschreiben und deren Nutzung erläutern. Die Diskussion der Entstehungsweise des Plans (Kopie, nicht Originalzeichnung) und der angewendeten Zeichentechniken im Kontext mittelalterlicher Bauzeichnungspraktiken ist ein wichtiger Aspekt. Die Analyse der Inschriften und ihrer Bedeutung für das Verständnis der Klosteranlage steht im Mittelpunkt. Die Kapitel erörtern auch die verschiedenen Forschungsansätze zur Datierung des Plans und der Originalvorlage, betont die Bedeutung des Plans für das Verständnis des frühmittelalterlichen Klosterlebens.
2. Entstehung des St. Galler Klosterplanes und die Regula Benedicti: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung des St. Galler Klosterplanes und seiner Beziehung zur Regula Benedicti. Es untersucht verschiedene Theorien zur Datierung der Originalvorlage, wobei die Aachener Reformsynoden (816-817) und die Arbeit des Reformabts Benedikt von Aniane (792) erwähnt werden. Die Analyse der Regula Benedicti liefert den Kontext für das Verständnis der Organisation und des Funktionierens des Klosters, und wie diese Prinzipien im Plan architektonisch zum Ausdruck kommen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der im Plan dargestellten Strukturen und Organisation mit den Vorgaben der Benediktinerregel, um die Ideale und die praktische Umsetzung der Regel im Klosteralltag zu beleuchten.
3. Schreibstube, Bibliothek und Schule im 9. - 11. Jahrhundert: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Schreibstube, Bibliothek und Schule im frühen Mittelalter. Basierend auf dem St. Galler Klosterplan und weiteren Quellen, wird die Funktion und Ausstattung dieser Einrichtungen analysiert. Es wird die Bedeutung dieser Räume für die Erhaltung und Verbreitung von Wissen im Kontext des Klosterlebens erörtert. Das Kapitel geht auf die Rolle der Mönche als Schreiber und Bewahrer von Wissen ein, und die Bedeutung der Schule für die Ausbildung zukünftiger Mönche und die Weitergabe von Wissen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der idealen Darstellung im Plan mit den tatsächlichen Gegebenheiten im 9.-11. Jahrhundert und den Entwicklungen in diesen Bereichen über die Zeit.
Schlüsselwörter
St. Galler Klosterplan, karolingische Architektur, Regula Benedicti, Schreibstube, Bibliothek, Schule, Frühmittelalter, Klosterleben, Handschriften, Bauzeichnung, Klosteranlage, Benediktinerregel.
Häufig gestellte Fragen zum St. Galler Klosterplan
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den St. Galler Klosterplan, eine karolingische Klosterplankopie aus dem 9. Jahrhundert, mit dem Fokus auf die Darstellung von Schreibstube, Bibliothek und Schule. Ziel ist es, deren Funktion und Ausstattung im Kontext der Regula Benedicti zu untersuchen und einen Überblick über diese Einrichtungen im frühen Mittelalter zu geben.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Analyse des St. Galler Klosterplanes als Quelle frühmittelalterlicher Klosterarchitektur; die Beschreibung und Interpretation der dargestellten Schreibstube, Bibliothek und Schule; den Zusammenhang zwischen dem Klosterplan und der Regula Benedicti; die Untersuchung der Entstehung und des Entstehungskontextes des Planes; und die Einordnung der dargestellten Einrichtungen in den frühmittelalterlichen Kontext.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Einleitung: Einführung in den St. Galler Klosterplan und die Forschungsfrage. 1. Der St. Galler Klosterplan: Detaillierte Beschreibung des Planes, Analyse der Inschriften und Zeichentechniken. 2. Entstehung des St. Galler Klosterplanes und die Regula Benedicti: Untersuchung der Entstehung des Planes und dessen Bezug zur Benediktinerregel. 3. Schreibstube, Bibliothek und Schule im 9. - 11. Jahrhundert: Überblick über diese Einrichtungen im frühen Mittelalter, Analyse ihrer Funktion und Ausstattung. Schlussbetrachtung: Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem St. Galler Klosterplan selbst, der Regula Benedicti und weiteren Quellen zum frühmittelalterlichen Klosterleben. Die Arbeit von Konrad Hecht ("Der St. Galler Klosterplan") wird explizit als wichtige Quelle genannt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: St. Galler Klosterplan, karolingische Architektur, Regula Benedicti, Schreibstube, Bibliothek, Schule, Frühmittelalter, Klosterleben, Handschriften, Bauzeichnung, Klosteranlage, Benediktinerregel.
Was ist das übergeordnete Ziel der Arbeit?
Das übergeordnete Ziel ist es, ein tieferes Verständnis des St. Galler Klosterplanes als Quelle für das frühmittelalterliche Klosterleben zu gewinnen und die Rolle von Schreibstube, Bibliothek und Schule im Kontext der Benediktinerregel zu beleuchten.
Wie wird der St. Galler Klosterplan in der Arbeit eingeordnet?
Der St. Galler Klosterplan wird als einzigartige Quelle für die Erforschung der karolingischen Architektur und des frühmittelalterlichen Klosterlebens betrachtet. Seine detaillierte Darstellung der Klostergebäude und -einrichtungen ermöglicht eine umfassende Analyse der Organisation und des Alltagslebens im Kloster.
Welche Bedeutung hat die Regula Benedicti für die Arbeit?
Die Regula Benedicti liefert den kontextuellen Rahmen für das Verständnis der Organisation und des Funktionierens des Klosters, wie es im St. Galler Klosterplan dargestellt wird. Der Vergleich zwischen der Regel und dem Plan hilft, die Umsetzung der benediktinischen Ideale in der Architektur und Organisation des Klosters zu verstehen.
- Quote paper
- Claudia Heye (Author), 2008, Eine kurze Darstellung des St. Galler Klosterplans, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/90995