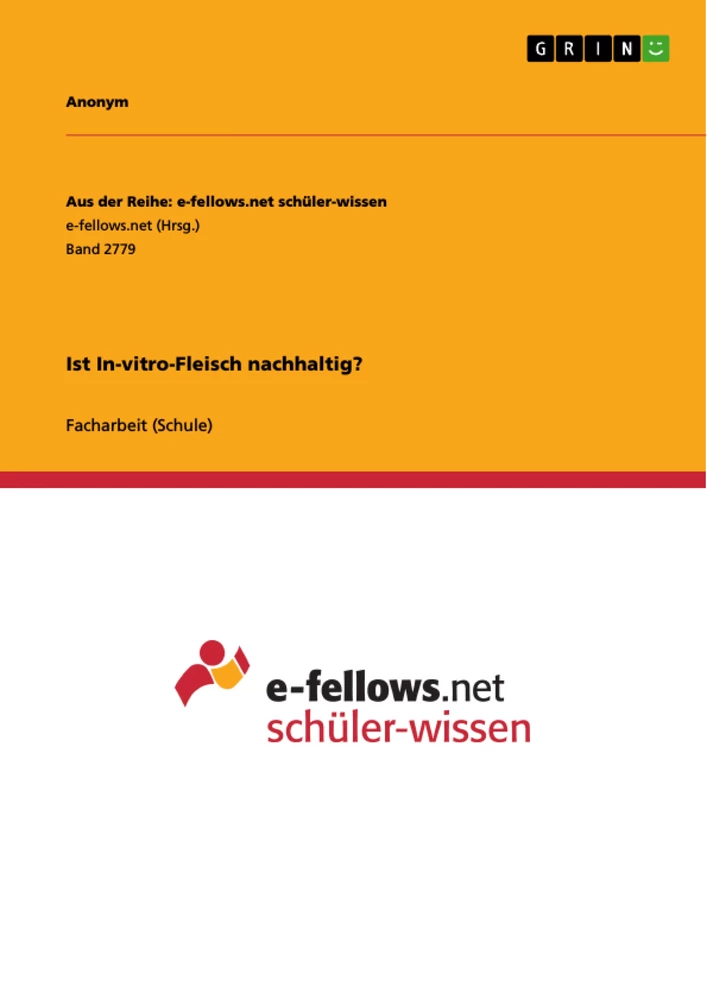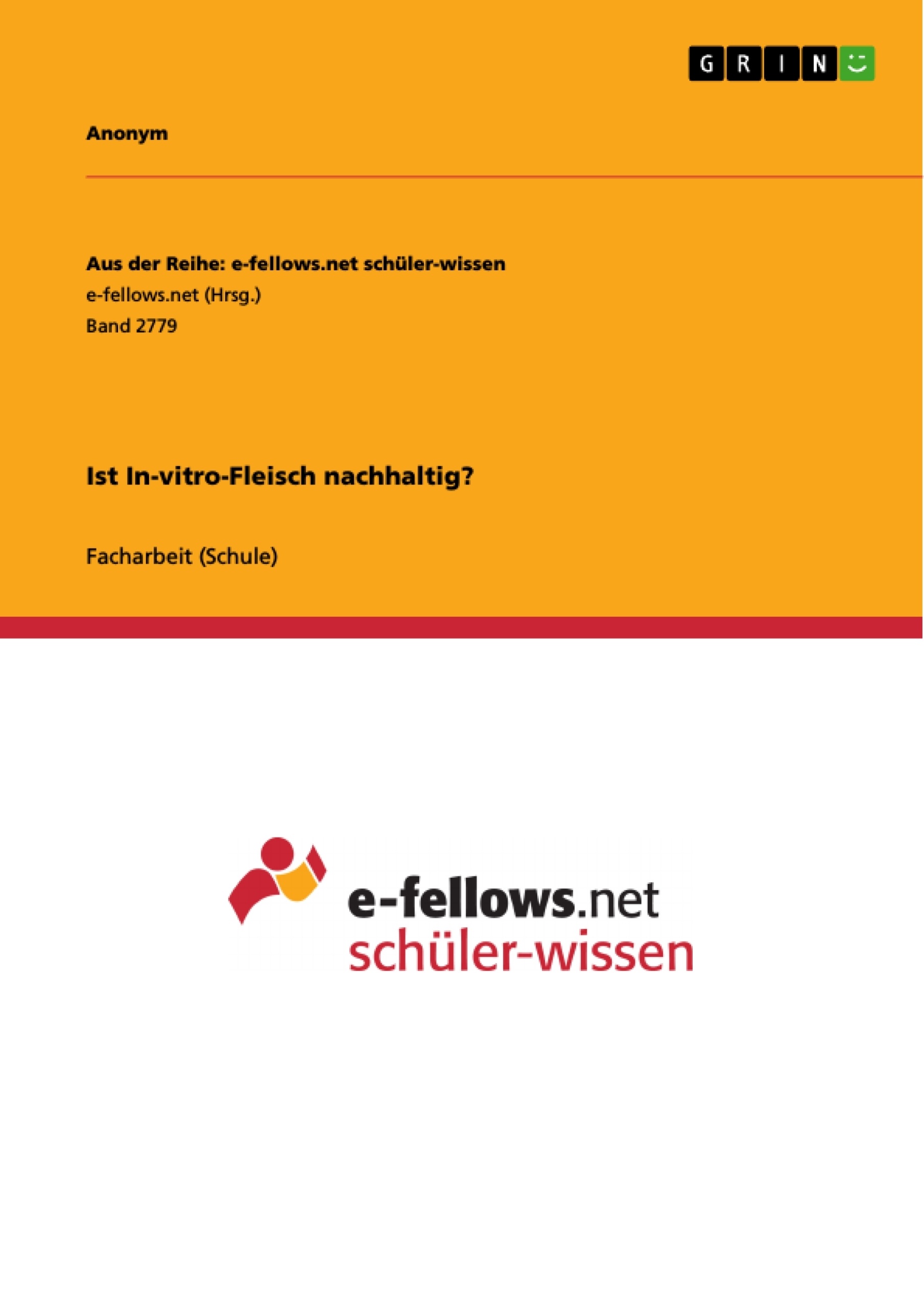Seit Anbeginn der Menschheit ist die Art der Nahrungsaufnahme ein weit gefächertes Thema von kulturellen bis hin zu ökologischen Faktoren. Dass Menschen im 21. Jahrhundert höhere Erwartungen an eine ausgewogenere und nachhaltigere Ernährung haben als unsere Vorfahren in der mittleren europäischen Steinzeit vor rund 10 000 Jahren liegt auf der Hand. Wo damals noch Jäger und Sammler ihre Nahrung wortwörtlich suchten, gibt es heute etliche Supermarktketten, die eine Vielfalt von frischem Obst und Gemüse aus Kontinenten anbieten, die mehr als 7000 km vom Konsumenten entfernt sind. Neben der Ökologie spielen Vermarktung, Produktion, neu entwickelte Technologien und wissenschaftliche Lebensmitteluntersuchungen eine bedeutende Rolle. Eine gesunde Ernährung dient nicht nur dem Einzelnen, sondern auch zahlreichen profitablen Unternehmen. Eine von vielen revolutionären Ideen in der Lebensmitteltechnologie ist das sogenannte In-vitro-Fleisch oder auch Laborfleisch, kultiviertes Fleisch (PETA), clean meat (GFI), victimless meat, oder auch frankenmeat genannt. Die ersten Überlegungen, Fleisch künstlich herzustellen, wurden bereits im Jahr 1931 von Winston Churchill in seinem Artikel „FIFTY YEARS HENCE“ getroffen. Er schrieb „We shall escape the absurdity of growing a whole chicken in order to eat the breast or wing, by growing these parts separately under a suitable medium“. Zu dieser Zeit gab es noch keine technischen oder biologischen Möglichkeiten, seine Überlegung in die Tat umzusetzen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Definiton des Wortes „Nachhaltigkeit“
- In-vitro-Fleisch verstehen
- Herstellungsprozess von In-vitro-Fleisch
- Ressourcenverbrauch von In-vitro-Fleisch
- Vergleich zwischen herkömmlichem Fleisch und In-vitro-Fleisch
- Landnutzung
- Energieverbrauch
- Wasserverbrauch
- Treibhausgas-Emissionen
- Wirtschaft und Soziales
- Möglicher Handelsmarkt von In-vitro-Fleisch
- Sozialwirtschaft: Veränderung des Arbeitsmarktes
- Mögliche Chancen bei der Erreichung politischer Ziele
- Agenda 2030 (17 sustainable development goals)
- Gesundheitliche Faktoren
- Prävention vor Krankheiten
- Geographischer Bezug: Sambia - Ein Land, das hungert
- Schlussteil
- Antwort auf die Fragestellung
- Persönliche Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob In-vitro-Fleisch als nachhaltige Alternative zu herkömmlichem Fleisch betrachtet werden kann. Dazu werden die Herstellungsprozesse und der Ressourcenverbrauch von In-vitro-Fleisch analysiert und mit denen von herkömmlichem Fleisch verglichen. Darüber hinaus werden die wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Aspekte des Themas beleuchtet.
- Definition und Bedeutung des Begriffs „Nachhaltigkeit“ im Kontext von Lebensmitteln
- Herstellungsprozess und Ressourcenverbrauch von In-vitro-Fleisch
- Vergleich von In-vitro-Fleisch mit herkömmlichem Fleisch in Bezug auf Landnutzung, Energieverbrauch, Wasserverbrauch und Treibhausgas-Emissionen
- Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen von In-vitro-Fleisch, einschließlich des möglichen Handelsmarktes und der Veränderung des Arbeitsmarktes
- Mögliche Chancen von In-vitro-Fleisch bei der Erreichung politischer Ziele, insbesondere im Hinblick auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „In-vitro-Fleisch“ ein und stellt die Fragestellung der Arbeit vor. Anschließend wird der Begriff „Nachhaltigkeit“ definiert und erläutert, welche Faktoren bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit von In-vitro-Fleisch relevant sind.
Im Kapitel „In-vitro-Fleisch verstehen“ wird der Herstellungsprozess von In-vitro-Fleisch anhand des „Tissue-Engineerings“ beschrieben, wobei insbesondere die Verwendung von fötalem Kälberserum als Nährmedium kritisch beleuchtet wird. Außerdem wird der Ressourcenverbrauch von In-vitro-Fleisch im Vergleich zu herkömmlichem Fleisch untersucht.
Das Kapitel „Vergleich zwischen herkömmlichem Fleisch und In-vitro-Fleisch“ stellt die Unterschiede zwischen beiden Fleischarten in Bezug auf Landnutzung, Energieverbrauch, Wasserverbrauch und Treibhausgas-Emissionen dar.
Das Kapitel „Wirtschaft und Soziales“ beleuchtet die möglichen Handelsmarkte für In-vitro-Fleisch und die potenziellen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.
Das Kapitel „Mögliche Chancen bei der Erreichung politischer Ziele“ untersucht, inwieweit In-vitro-Fleisch zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Agenda 2030 beitragen kann.
Im Kapitel „Gesundheitliche Faktoren“ werden die potenziellen gesundheitlichen Vorteile von In-vitro-Fleisch, wie z.B. die Prävention von Krankheiten, sowie die Bedeutung des Themas im Kontext von Ländern wie Sambia, die unter Hunger leiden, betrachtet.
Schlüsselwörter
In-vitro-Fleisch, nachhaltige Ernährung, Tissue-Engineering, Ressourcenverbrauch, Landnutzung, Energieverbrauch, Wasserverbrauch, Treibhausgas-Emissionen, Handelsmarkt, Arbeitsmarkt, Agenda 2030, Gesundheitliche Faktoren.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Ist In-vitro-Fleisch nachhaltig?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/909760