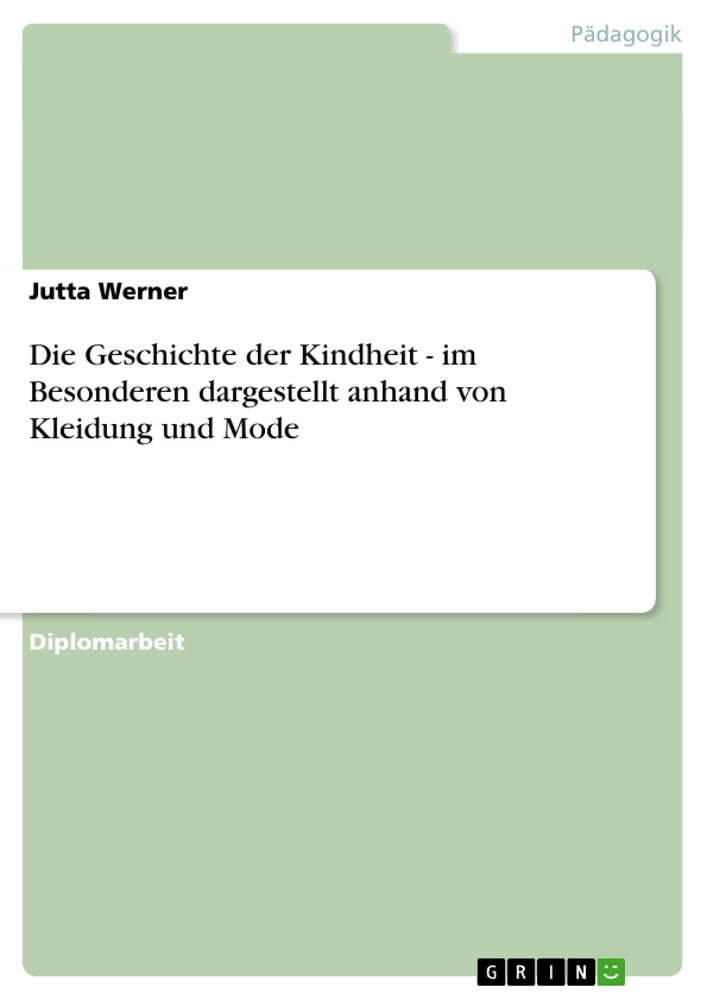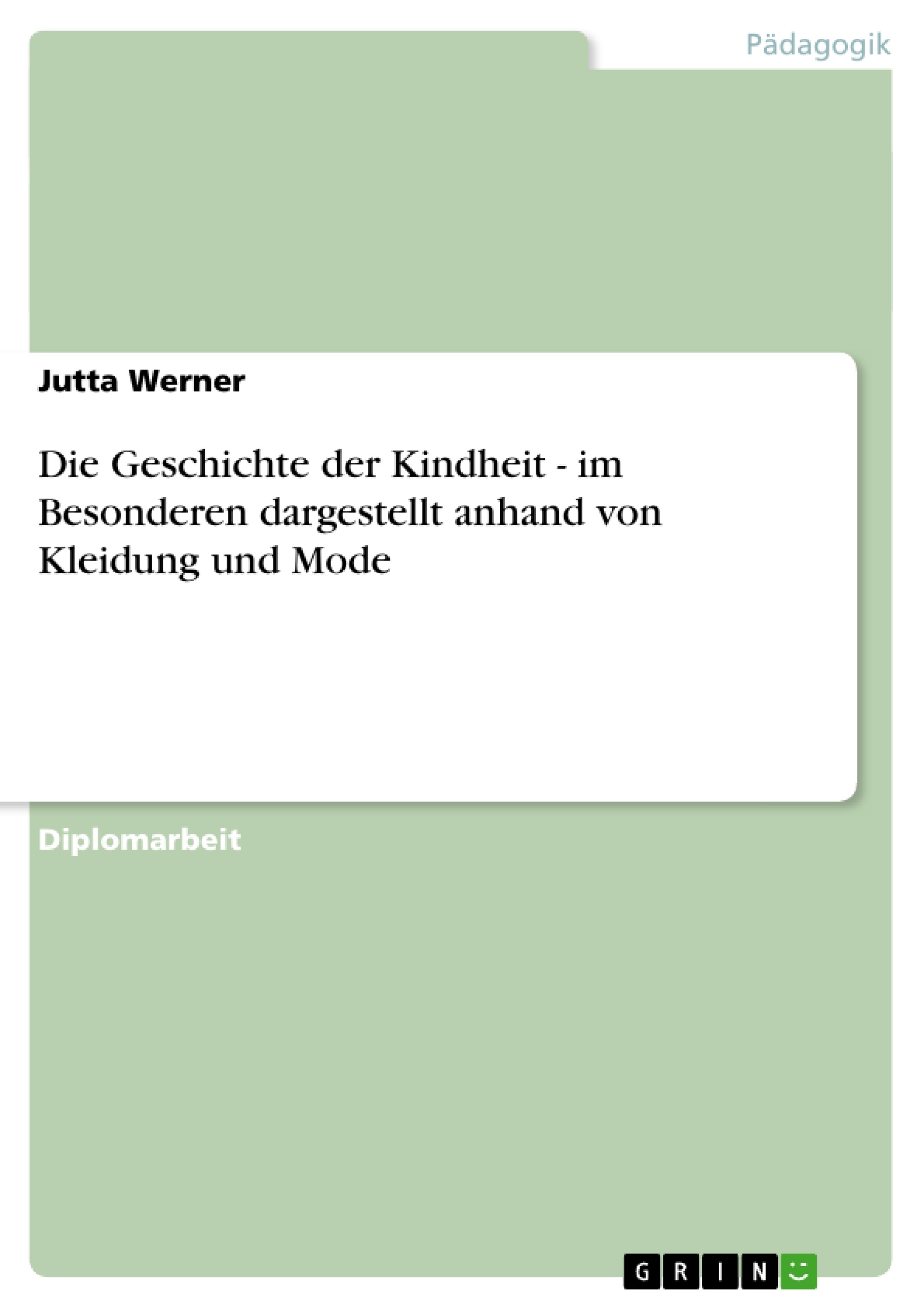Der ausführliche Titel macht schon deutlich worum es in der vorliegenden Arbeit geht. Da ich in meiner späteren Tätigkeit als Lehrerin viel mit Kindern zu tun haben werde, habe ich mir folgende Fragen gestellt: "Was ist eigentlich Kindheit? Wo kommt sie her? Hat es sie schon immer gegeben? Gibt es sie im Moment und wie sieht sie gerade aus?" Das waren nicht die einzigen Fragen, denn je mehr ich mich mit der Literatur auseinandersetzte, desto mehr fragen traten auf. In erster Linie hielt ich mich an Phillippe Ariés und Neil Postman um diese Fragen zu klären.
Doch damit war ja noch lange nicht alles geklärt.
"Wie sah die Kleidung der Kinder früher aus? War die Kleidung früher für alle gleich, oder nicht? Wann kam es zu Veränderungen und zu welchen?" Auf diese Fragen holte ich mit die Antworten vor allem von Ingeborg Weber-Kellermann aus ihren beiden Büchern: Die Kindheit und Der Kinder neue Kleider.
"Wenn man Rosa hört, denkt man kleine Mädchen. Und wenn man Blau hört, denkt man an kleine Buben. Warum? War das schon immer so? Wer legt so etwas fest?" Auf diese Fragen hab ich Antworten in Eva Hellers Buch gefunden.
"Wie kleiden sich Kinder und Jugendliche heute? Gibt es noch eine spezielle Kindermode, oder nicht mehr? Bestimmt die allgemeine Mode ihre Kleidung?" Diesen Fragen wollte ich mit Hilfe eines Fragebogens für Kinder und Jugendliche auf den Grund gehen, die ich in Mondsee, Radstadt und der Stadt Salzburg durchführen durfte. Hier an dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen LehrerInnen und Kindergärtnerinnen bedanken, die mich dabei unterstützt haben. Danke!
Natürlich stellt sich dann auch solche Frage: "Was kann ich mit meinen Erkenntnissen nun direkt für die Schule anfangen? Welche didaktischen Konsequenzen entstehen? Welche Themen sollen unbedingt mit den Schülern besprochen und bearbeitet werden?" Dazu habe ich mich zuerst an didaktischen Modellen in der Literatur orientiert und dann selbst zwei Konzepte entwickelt, die aber für die Umsetzung im Unterricht noch intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema erfordern würden, da sie stark von den jeweiligen Gruppen und von der Lehrperson abhängig sind. Die Arbeit gliedert sich also nach meiner Fragestellung genau in diese fünf Teile: Kindheit, Kinderkleidung im Wandel der Zeit, typische Kinderfarben und deren Bedeutung, Auswertung der Fragebögen zum Thema Mode, Kleidung und Farbe, Didaktische Überlegungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Entwicklung und Verlauf des Phänomens Kindheit
- 1.1 Die Zeit vor der Entdeckung der Kindheit
- 1.1.1 Die Antike
- 1.1.2 Das Mittelalter
- 1.2 Die Entdeckung der Idee der Kindheit
- 1.3 Der Bedeutungswandel des Phänomens Kindheit
- 1.3.1 Allgemeine Entwicklung
- 1.3.2 Die rechtliche Stellung des Kindes im Wandel der Zeit
- 1.4 Das Verschwinden der Kindheit
- 1.4.1 Gründe
- 1.4.2 Verlauf
- 1.5 Wie sieht die Situation heute aus?
- 2. Kostümgeschichte der Kindermode
- 2.1 Die Zeit vor der französischen Revolution
- 2.1.1 Die aristokratische Kinderkleidung
- 2.1.2 Die ländliche Kinderkleidung
- 2.2 Französische Revolution bis 1815
- 2.2.1 Die aristokratische Kindermode
- 2.2.2 Die bürgerliche Kindermode
- 2.2.3 Die ländliche Kindermode
- 2.3 Biedermeierkinder
- 2.3.1 Die bürgerliche Kindermode
- 2.3.2 Die Kleidung der Arbeiterkinder
- 2.4 Nachmärz
- 2.4.1 Die bürgerliche Kindermode
- 2.4.2 Die Kleidung der Arbeiterkinder
- 2.5 Kinderkleidung im Kaiserreich
- 2.5.1 Die Kleidung der Herrschaftskinder
- 2.5.2 Die Kleidung der Arbeiterkinder
- 2.6 Reformkleidung und Wandervogelkluft
- 2.6.1 Der Reformgedanke in der Kinderkleidung
- 2.6.2 Die Wandervogelkluft
- 2.7 Kindermode in den 20ern
- 2.7.1 Die städtisch-bürgerliche Kinderkleidung
- 2.7.2 Die Kleidung der Arbeiterkinder
- 2.8 Die Zeit des Nationalsozialismus
- 2.8.1 Die Uniformen der Jungen
- 2.8.1.1 Das deutsche Jungvolk
- 2.8.1.2 Die Hitlerjugend
- 2.8.2 Die Uniformen der Mädchen
- 2.8.2.1 Die Jungmädel
- 2.8.2.2 Bund deutscher Mädel
- 2.9 Vom zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart
- 2.9.1 Interview mit Frau Marianne Giretzlehner
- 2.9.2 Interview mit Frau Gudrun Hirz
- 2.9.3 Interview mit Frau Gudrun Hirz und ihrer Tochter Astrid
- 3. Die symbolische Bedeutung der beiden typischen Kinderfarben
- 3.1 Rosa für die Mädchen
- 3.2 Blau für die Buben
- 3.3 Die Umkehrung der Farbbedeutung
- 4. Befragung
- 4.1 Fragebögen
- 4.2 Thesen hinter der Befragung
- 4.2.1 Wichtigkeit der Mode
- 4.2.2 Mode und Qualität
- 4.2.3 Wer hilft beim Aussuchen der Kleidung?
- 4.2.4 Die Farbigkeit
- 4.3 Auswertung der Befragung
- 4.3.1 Wichtigkeit der Mode
- 4.3.2 Mode und Qualität
- 4.3.3 Wer hilft beim Aussuchen der Kleidung?
- 4.3.4 Die Farbigkeit
- 5. Didaktische Überlegungen
- 5.1 Zusammenhang mit dem Lehrplan
- 5.2 Wie sind andere Personen an das Thema Mode im Unterricht herangegangen?
- 5.2.1 Traute El-Gebali-Rüter
- 5.2.1 Doris Schmidt
- 5.2.3 Bärbel Kursawe
- 5.3 Meine eigenen Überlegungen
- 5.3.1 Eine Unterrichtssequenz für die 1./2. Klasse
- 5.3.2 Eine Unterrichtssequenz für die 3./4. Klasse
- 5.3.3 Weiterführendes zum Thema
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Konzepts der Kindheit und seine Reflexion in der Kinderkleidung. Ziel ist es, die historische Entwicklung der Kindermode zu beleuchten und deren Bedeutung im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen zu analysieren. Die didaktischen Implikationen für den Schulunterricht werden ebenfalls betrachtet.
- Die historische Entwicklung des Konzepts "Kindheit"
- Die Veränderung der Kinderkleidung im Laufe der Geschichte
- Die symbolische Bedeutung von Farben in der Kinderkleidung
- Die Ergebnisse einer Befragung zu Kindermode und -kleidung
- Didaktische Ansätze zur Vermittlung des Themas im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Entwicklung und Verlauf des Phänomens Kindheit: Dieses Kapitel erforscht die historische Konstruktion des Begriffs "Kindheit". Es beginnt mit der Antike und dem Mittelalter, wo das Kind als "kleiner Erwachsener" betrachtet wurde, und verfolgt die Entwicklung hin zum modernen Verständnis von Kindheit als einer eigenständigen Lebensphase. Der Bedeutungswandel wird anhand gesellschaftlicher, rechtlicher und philosophischer Veränderungen nachvollzogen, um die heutige Wahrnehmung von Kindheit zu kontextualisieren. Der Fokus liegt auf der gradualen Entstehung des Konzepts einer geschützten Kindheit und dessen gesellschaftlicher Bedingtheit.
2. Kostümgeschichte der Kindermode: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der Kindermode von der Zeit vor der Französischen Revolution bis zur Gegenwart. Es untersucht die unterschiedlichen Kleidungsweisen verschiedener sozialer Schichten (Aristokratie, Bürgertum, Arbeiterschaft) und zeichnet den Einfluss von historischen Ereignissen, wie der Französischen Revolution, dem Biedermeier, dem Kaiserreich, der Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit, auf die Kindermode nach. Der Vergleich verschiedener Epochen zeigt die enge Verbindung zwischen gesellschaftlichen Normen und der Kinderkleidung auf. Die Interviews mit Frauen verschiedener Generationen ergänzen die historische Analyse durch persönliche Erfahrungen.
3. Die symbolische Bedeutung der beiden typischen Kinderfarben: Dieses Kapitel widmet sich der Untersuchung der Farbcodes Rosa für Mädchen und Blau für Jungen. Es analysiert, wann und wie diese Zuordnung entstand und wie sie sich in der Gesellschaft etablierte. Die Arbeit untersucht die kulturellen und gesellschaftlichen Faktoren, die zu dieser Konvention geführt haben, und beleuchtet die zunehmende Hinterfragung dieser traditionellen Geschlechterrollen in der heutigen Gesellschaft.
4. Befragung: Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung und Auswertung einer empirischen Befragung von Kindern und Jugendlichen zum Thema Mode, Kleidung und Farbe. Die Ergebnisse liefern aktuelle Einblicke in die Bedeutung von Kleidung und Mode für Kinder und Jugendliche und erweitern die historischen Analysen um einen zeitgenössischen Aspekt. Es werden Fragen nach der Wichtigkeit von Mode, der Qualität der Kleidung, der Beteiligung bei der Kleiderauswahl und der Bedeutung von Farben behandelt.
5. Didaktische Überlegungen: Dieses Kapitel befasst sich mit didaktischen Implikationen der vorangegangenen Kapitel. Es werden verschiedene didaktische Ansätze zur Vermittlung des Themas im Schulunterricht diskutiert, inklusive einer konkreten Unterrichtssequenz für die 1./2. Klasse und eine für die 3./4. Klasse. Es wird auf die Relevanz des Themas im Lehrplan eingegangen und der Vergleich mit bereits bestehenden didaktischen Konzepten gezogen.
Schlüsselwörter
Kindheit, Kindermode, Kostümgeschichte, gesellschaftliche Entwicklung, Symbolismus, Farben, Befragung, Didaktik, Lehrplan, Geschlechterrollen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Entwicklung des Konzepts Kindheit und seine Reflexion in der Kinderkleidung
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Konzepts "Kindheit" und seine Reflexion in der Kinderkleidung. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Kindermode und analysiert deren Bedeutung im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen. Zusätzlich werden didaktische Implikationen für den Schulunterricht betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Entwicklung und Verlauf des Phänomens Kindheit; 2. Kostümgeschichte der Kindermode; 3. Die symbolische Bedeutung der beiden typischen Kinderfarben; 4. Befragung; und 5. Didaktische Überlegungen.
Worum geht es im Kapitel "Entwicklung und Verlauf des Phänomens Kindheit"?
Dieses Kapitel erforscht die historische Konstruktion des Begriffs "Kindheit", beginnend mit der Antike und dem Mittelalter bis hin zum modernen Verständnis. Es verfolgt den Bedeutungswandel anhand gesellschaftlicher, rechtlicher und philosophischer Veränderungen und konzentriert sich auf die Entstehung des Konzepts einer geschützten Kindheit.
Was wird im Kapitel "Kostümgeschichte der Kindermode" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert detailliert die Kindermode von der Zeit vor der Französischen Revolution bis zur Gegenwart. Es untersucht die Kleidungsweisen verschiedener sozialer Schichten und den Einfluss historischer Ereignisse auf die Kindermode. Interviews mit Frauen verschiedener Generationen ergänzen die historische Analyse.
Worum geht es im Kapitel "Die symbolische Bedeutung der beiden typischen Kinderfarben"?
Dieses Kapitel analysiert die Farbcodes Rosa für Mädchen und Blau für Jungen. Es untersucht, wann und wie diese Zuordnung entstand, die kulturellen und gesellschaftlichen Faktoren dahinter und die zunehmende Hinterfragung dieser Konvention.
Was beinhaltet das Kapitel "Befragung"?
Dieses Kapitel beschreibt eine empirische Befragung von Kindern und Jugendlichen zum Thema Mode, Kleidung und Farbe. Die Ergebnisse geben Einblicke in die Bedeutung von Kleidung und Mode für Kinder und Jugendliche und ergänzen die historischen Analysen.
Worum geht es in den "Didaktischen Überlegungen"?
Dieses Kapitel behandelt die didaktischen Implikationen der Arbeit. Es diskutiert verschiedene didaktische Ansätze zur Vermittlung des Themas im Schulunterricht, inklusive konkreter Unterrichtssequenzen für die 1./2. und 3./4. Klasse. Es wird auf die Relevanz des Themas im Lehrplan eingegangen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kindheit, Kindermode, Kostümgeschichte, gesellschaftliche Entwicklung, Symbolismus, Farben, Befragung, Didaktik, Lehrplan, Geschlechterrollen.
Welche Zeiträume werden in der Kostümgeschichte der Kindermode behandelt?
Die Kostümgeschichte der Kindermode umfasst die Zeit von vor der Französischen Revolution bis in die Gegenwart, einschließlich der Französischen Revolution, des Biedermeier, des Kaiserreichs, der Weimarer Republik, des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit.
Welche Methoden wurden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine Kombination aus Literaturrecherche, historischen Analysen, einer empirischen Befragung und didaktischen Überlegungen.
- Quote paper
- Jutta Werner (Author), 2002, Die Geschichte der Kindheit - im Besonderen dargestellt anhand von Kleidung und Mode, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/9015