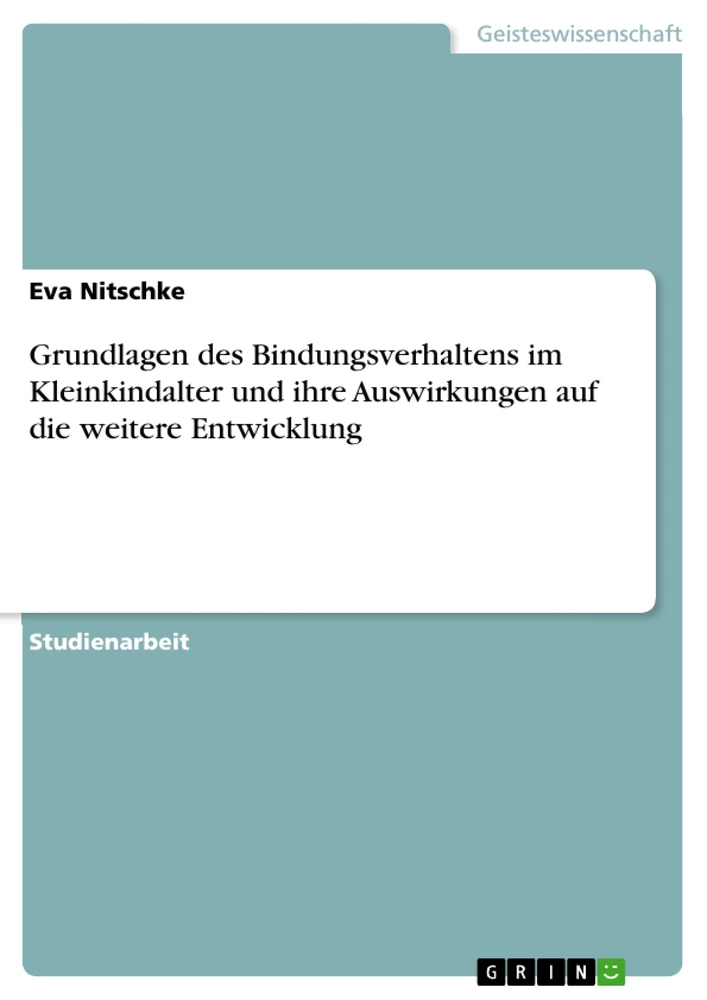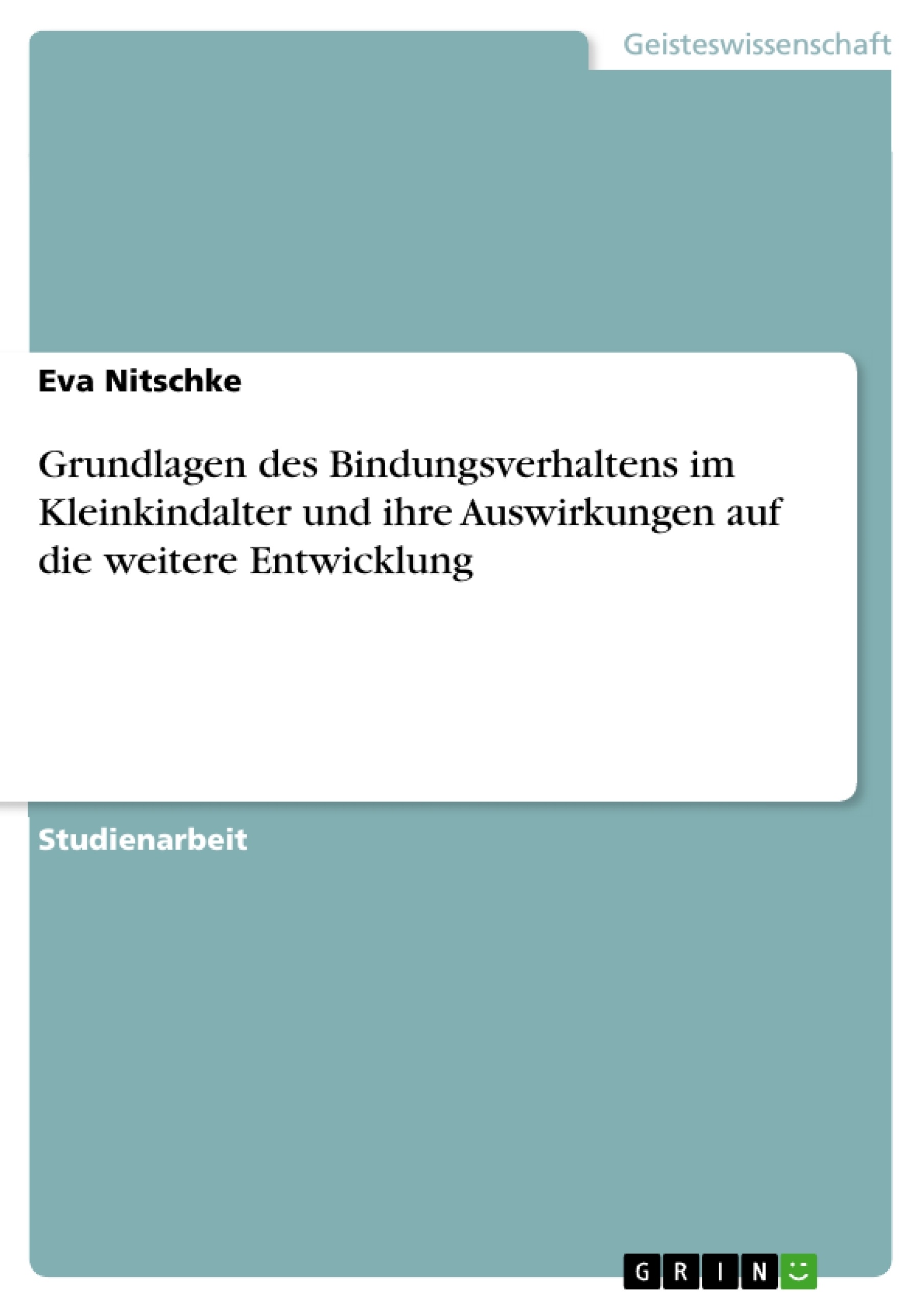Jeder Mensch hat ein Grundbedürfnis nach menschlicher Nähe und Zuwendung, also nach Bindung. Dieses Bedürfnis ist von Geburt an vorhanden.
Lange Zeit wurde der Bindung als grundlegende Basis der zwischenmenschlichen und psychischen Befindlichkeit eines Menschen kaum Beachtung geschenkt.
Erst mit Einführung der Bindungstheorie in die wissenschaftliche Psychologie durch John Bowlby und Mary Ainsworth fand eine Veränderung statt.
So ist es heute unvorstellbar, Kleinstkindern im Krankenhaus den Kontakt mit ihren Eltern zu verwehren, wie es früher aus Angst vor Infektionen und der folgenden schwierigen Trennungssituation üblich war.
Brazelton und Greenspan formulierten 7 Grundbedürfnisse von Kindern. Diese lauten:(1)
1. Bedürfnis nach Liebe, Geborgenheit, Zuwendung, Unterstützung und beständiger Erziehung
2. Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit und Sicherheit
3. Bedürfnis nach neuen und entwicklungsgerechten Erfahrungen
4. Bedürfnis nach Lob und (adäquater) Anerkennung
5. Bedürfnis nach Verantwortung und Selbständigkeit
6. Bedürfnis nach Übersicht und Zusammenhang, nach stabilen und unterstützenden Gemeinschaften sowie nach einer sicheren Zukunft
7. Bedürfnis nach Orientierung, Strukturen, Regeln und Grenzen
Diese 7 Grundbedürfnisse scheinen den Grundstein für eine positive Entwicklung zu legen. Alle diese Punkte lassen sich in die Bindungstheorie einordnen bzw. werden von ihr berücksichtigt.
Im ersten Teil meiner Arbeit werde ich spezifisch auf die bindungstheoretischen Grundlagen eingehen und diese erläutern, um dann im zweiten Teil auf die Auswirkungen des Bindungsverhaltens in der weiteren psychischen Entwicklung einzugehen.
Kenntnisse der Bindungsforschung sollten nicht nur auf das erste Lebensjahr bezogen sein, sondern ihre weit reichenden erwiesenen Folgen in die politische Diskussion um Kindererziehung und Fremdbetreuung berücksichtigt werden.
(1) Brazelton & Greenspan auf: http://userpage.fu-berlin.de/~balloff/altesemester/alt/Folien_Grundbeduerfnisse.htm
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bindungstheoretische Grundüberlegungen
- 2.1. Die Bindungstheorie
- 2.2. Bindungstypen
- 2.2.1. Unsicher-vermeidend gebunden (A)
- 2.2.2. Sicher gebunden (B)
- 2.2.3. Unsicher-ambivalent gebunden (C)
- 2.2.4. Unsicher-desorganisiert/desorientiert gebunden (D)
- 2.3. Entwicklung der Bindung im ersten Lebensjahr
- 2.4. Besonderheiten der Mutter-Kind-Bindung
- 2.4.1. Feinfühligkeit
- 3. Auswirkungen der Bindungserfahrung
- 3.1. Auswirkung auf das Gehirn
- 3.2. Auswirkung auf die weitere Entwicklung
- 4. Berücksichtigung der Bindungsforschung in der Fremdbetreuung
- 4.1. Besonderheiten bei der Erzieherin-Kind-Bindung
- 4.2. Rahmenbedingungen
- 5. Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Grundlagen des Bindungsverhaltens im Kleinkindalter und deren Auswirkungen auf die weitere Entwicklung. Sie beleuchtet die Bindungstheorie, verschiedene Bindungstypen und die Bedeutung der Mutter-Kind-Bindung. Die Arbeit betrachtet auch den Einfluss der Bindungserfahrung auf die Gehirnentwicklung und die spätere Entwicklung des Kindes.
- Bindungstheorie nach Bowlby und Ainsworth
- Beschreibung verschiedener Bindungstypen
- Auswirkungen der Bindung auf die Entwicklung
- Bedeutung der Feinfühligkeit der Bezugsperson
- Relevanz der Bindungsforschung für die Fremdbetreuung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Bindung ein und betont dessen grundlegende Bedeutung für die psychische Entwicklung. Sie erwähnt die historische Vernachlässigung des Themas und den Paradigmenwechsel durch Bowlby und Ainsworth. Die sieben Grundbedürfnisse von Kindern nach Brazelton und Greenspan werden vorgestellt und in den Kontext der Bindungstheorie eingeordnet. Die Arbeit gliedert sich in einen Teil zur Erläuterung bindungstheoretischer Grundlagen und einen zweiten Teil zu den Auswirkungen des Bindungsverhaltens auf die weitere Entwicklung. Die Relevanz der Bindungsforschung für die politische Diskussion um Kindererziehung und Fremdbetreuung wird hervorgehoben.
2. Bindungstheoretische Grundüberlegungen: Dieses Kapitel erläutert das grundlegende Bedürfnis nach emotionalen Beziehungen und veranschaulicht dies anhand von Beispielen aus dem Alltag. Es stellt die Bindungstheorie von John Bowlby vor, die von angeborenen Fähigkeiten des Neugeborenen ausgeht, Bindungen herzustellen. Bowlbys Theorie wird im Kontext der Ethologie und in Abgrenzung zur Psychoanalyse Freuds diskutiert. Der Fokus liegt auf dem Zusammenspiel von Exploration und Bindungssicherung sowie der Bedeutung der Bezugsperson als sichere Basis. Der Begriff des „emotionalen Auftankens“ des Säuglings wird erklärt.
2.2. Bindungstypen: Das Kapitel beschreibt den „Fremde Situation-Test“ von Mary Ainsworth zur Erfassung von Bindungstypen. Die drei Hauptbindungstypen (unsicher-vermeidend, sicher, unsicher-ambivalent) und der später hinzugefügte Typ des desorganisierten Verhaltensmusters werden benannt. Die Beobachtungskriterien des Tests werden kurz dargelegt, wobei der Fokus auf der Reaktion des Kindes in Trennungssituationen und Wiedervereinigungen liegt, und die Bedeutung dieser Reaktionen für die Klassifizierung der Bindungstypen hervorgehoben wird.
3. Auswirkungen der Bindungserfahrung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen von Bindungserfahrungen. Es thematisiert die Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung und die weitere psychische Entwicklung. Obwohl keine detaillierten Inhalte genannt werden, wird die Reichweite der Auswirkungen der frühen Bindungserfahrungen auf das spätere Leben deutlich gemacht und die Bedeutung der Thematik in diesem Kontext hervorgehoben.
4. Berücksichtigung der Bindungsforschung in der Fremdbetreuung: Dieses Kapitel behandelt die Relevanz der Bindungsforschung für die Fremdbetreuung von Kindern. Es beleuchtet die Besonderheiten der Erzieherin-Kind-Bindung und relevante Rahmenbedingungen. Auch hier wird ohne konkrete Beispiele die Bedeutung der frühkindlichen Bindung im Kontext von Fremdbetreuung betont und ein Ausblick auf die Relevanz der angesprochenen Faktoren gegeben.
Schlüsselwörter
Bindungstheorie, Bowlby, Ainsworth, Bindungstypen, sichere Basis, Exploration, Feinfühligkeit, Mutter-Kind-Bindung, Gehirnentwicklung, Fremdbetreuung, Entwicklungspsychologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Bindungstheorie und ihre Auswirkungen"
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die Bindungstheorie, ihre verschiedenen Bindungstypen und die Auswirkungen frühkindlicher Bindungserfahrungen auf die Entwicklung des Kindes. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste von Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Mutter-Kind-Bindung und der Relevanz der Bindungsforschung für die Fremdbetreuung.
Welche Bindungstheorien werden behandelt?
Der Text behandelt vor allem die Bindungstheorie nach John Bowlby und Mary Ainsworth. Bowlbys Theorie wird im Kontext der Ethologie und in Abgrenzung zur Psychoanalyse Freuds diskutiert. Ainsworths "Fremde Situation-Test" zur Erfassung von Bindungstypen wird detailliert beschrieben.
Welche Bindungstypen werden unterschieden?
Es werden die vier Bindungstypen nach Ainsworth beschrieben: sicher gebunden (B), unsicher-vermeidend gebunden (A), unsicher-ambivalent gebunden (C) und unsicher-desorganisiert/desorientiert gebunden (D). Der Text erläutert die Beobachtungskriterien des "Fremde Situation-Tests" und die Bedeutung der kindlichen Reaktionen in Trennungs- und Wiedervereinigungssituationen für die Klassifizierung der Bindungstypen.
Welche Auswirkungen haben Bindungserfahrungen?
Der Text betont die weitreichenden Auswirkungen frühkindlicher Bindungserfahrungen auf die Gehirnentwicklung und die gesamte weitere psychische Entwicklung des Kindes. Obwohl keine detaillierten Inhalte genannt werden, wird die Bedeutung der Thematik in diesem Kontext hervorgehoben.
Welche Rolle spielt die Bindungsforschung in der Fremdbetreuung?
Der Text beleuchtet die Relevanz der Bindungsforschung für die Fremdbetreuung von Kindern. Er hebt die Besonderheiten der Erzieherin-Kind-Bindung und die Bedeutung relevanter Rahmenbedingungen hervor. Die Bedeutung der frühkindlichen Bindung im Kontext von Fremdbetreuung wird betont.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text behandelt?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Bindungstheorie, Bowlby, Ainsworth, Bindungstypen, sichere Basis, Exploration, Feinfühligkeit, Mutter-Kind-Bindung, Gehirnentwicklung, Fremdbetreuung und Entwicklungspsychologie.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Die Zielsetzung des Textes ist es, die Grundlagen des Bindungsverhaltens im Kleinkindalter und deren Auswirkungen auf die weitere Entwicklung zu untersuchen. Es werden die Bindungstheorie, verschiedene Bindungstypen und die Bedeutung der Mutter-Kind-Bindung beleuchtet. Der Text betrachtet auch den Einfluss der Bindungserfahrung auf die Gehirnentwicklung und die spätere Entwicklung des Kindes.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist in verschiedene Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zu bindungstheoretischen Grundüberlegungen, den Auswirkungen von Bindungserfahrungen und der Berücksichtigung der Bindungsforschung in der Fremdbetreuung. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
- Arbeit zitieren
- Eva Nitschke (Autor:in), 2008, Grundlagen des Bindungsverhaltens im Kleinkindalter und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung , München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/90140