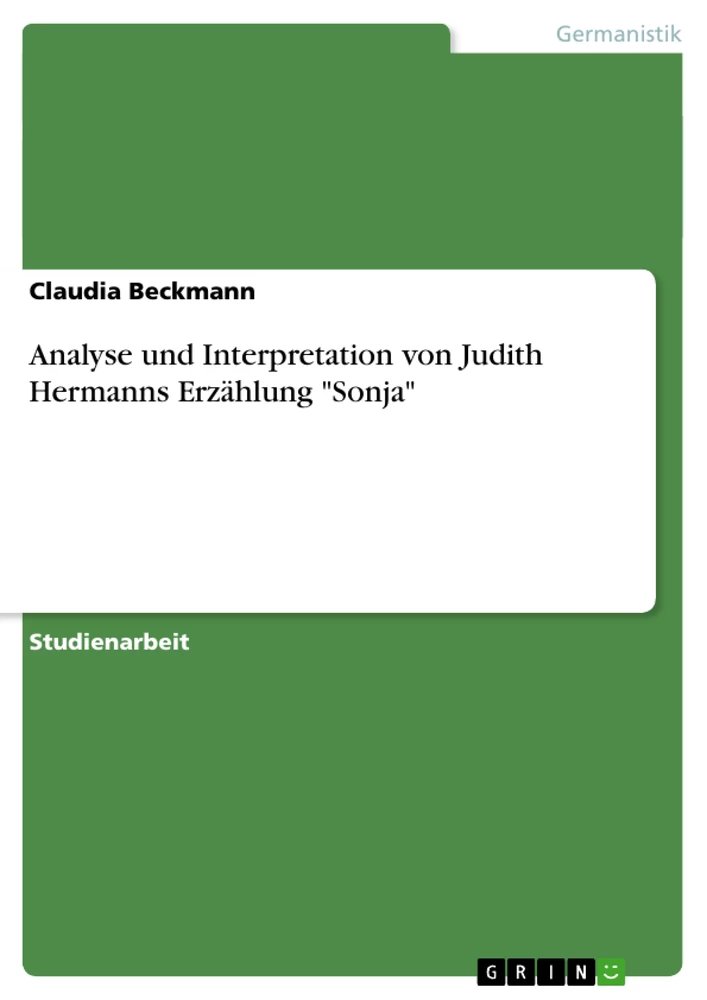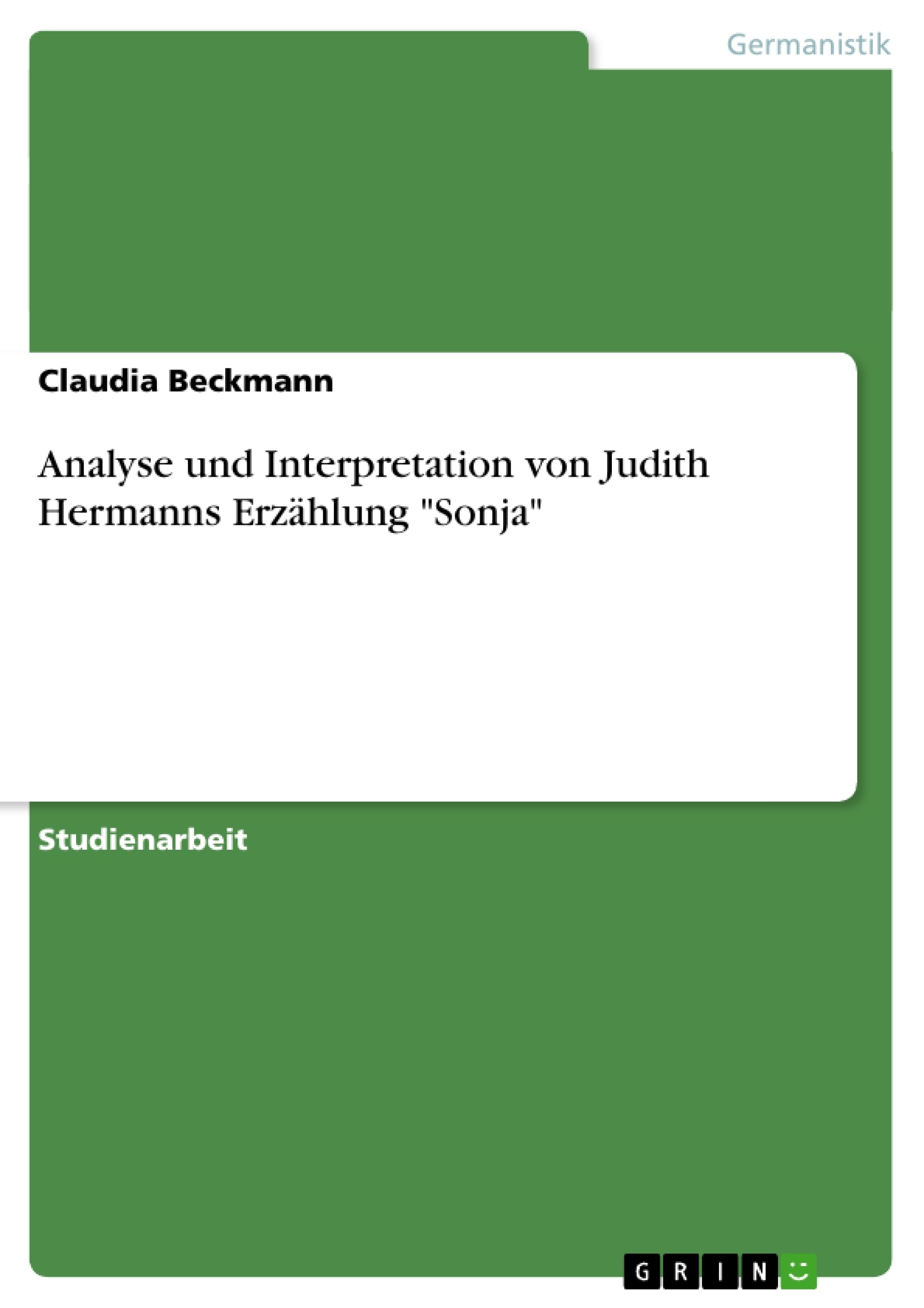Die Erzählung „Sonja“ von Judith Hermann, Gegenstand der folgenden Ausarbeitung, ist Teil des 1998 veröffentlichten Erzählbandes „Sommerhaus, später“, mit dem sie ihren ersten großen Erfolg verzeichnen konnte.
„Sommerhaus, später“ beinhaltet neun Erzählungen, deren Handlung sich in Berlin oder in der näheren Umgebung abspielt. Die Hauptfiguren sind allesamt junge Menschen – die meisten zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt – , die trotz ihres Alters seltsam antriebslos und müde wirken. Die Erzählung „Sonja“ ist eine der umfangreicheren des Erzählbandes. Wie der Titel vermuten lässt, geht es um eine junge Frau mit dem Namen Sonja. Die männliche Hauptfigur lernt Sonja auf einer Zugfahrt im Mai kennen, als sie sich auf der Rückreise von Hamburg, dem Wohnort ihrer Freundin Verena, nach Berlin befindet. Zwischen ihnen entwickelt sich eine ganz besondere Form von platonischer Beziehung, deren Verlauf und Ende den zentralen Erzählgegenstand bilden. Bei der männlichen Hauptfigur handelt es sich zugleich der Ich-Perspektive berichtenden Erzähler, der seine Erlebnisse der vergangenen 22 Monate Revue passieren lässt. [...]
Im Hinblick darauf, dass der Ich-Erzähler seine Gefühle – insbesondere Gefühle anderen gegenüber – permanent bewusst steuert bzw. zensiert, um sich zwecks gezielten Selbstschutzes nicht mehr als nötig der Außenwelt preiszugeben und sich seinem eigenen Urteilsvermögen nicht aussetzen zu müssen, beginnt und endet die Beziehung zwischen Sonja und der männlichen Hauptfigur desaströs: „Was die Begegnung mit Sonja auslöst, kann als eine Erschütterung des Referenzrahmens beschrieben werden, der den narzisstischen Selbstbezugs des Erzählers garantiert.“ [...]
Die Figuren Verena und Sonja sind nicht ausschließlich als Reflexionen kontrastiver Frauenbilder oder unterschiedlicher Lebensentwürfe zu verstehen.Ein Deutungsansatz, dem die Opposition zwischen beiden Figuren als einzig entscheidendes Moment zugrunde liegt, würde deutlich zu kurz greifen und dabei die Bedeutung anderer Aspekte verkennen. Einer dieser Aspekte ist die existentielle Verlusterfahrung des Ich-Erzählers am Ende der Erzählung. Wie diese Erfahrung für ihn spürbar wird und wie er mit ihr umgeht, wird in den letzten Zeilen lediglich angedeutet. Es bleibt dem Leser überlassen, diese Leerstelle mit Sinn zu füllen: „Manchmal habe ich auf der Straße das Gefühl, jemand liefe dicht hinter mir her, ich drehe mich dann um, und da ist niemand, aber das Gefühl der Irritation bleibt."
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Inhaltliche Zusammenfassung
- 2. Analyse erzähltheoretischer Aspekte
- 2.1 Erzählperspektive
- 2.2 Zeitstrukturen / Erzählzeit und erzählte Zeit
- 2.3 Sprachlich-stilistische Beschreibung
- 3. Charakterisierung und Bewertung der Figuren und ihrer Beziehung zueinander
- 3.1 Ich-Erzähler
- 3.2 Verena - Ich-Erzähler
- 3.3 Sonja - Ich-Erzähler
- 4. Zentrale Motive und Deutungsansätze
- 4.1 Bedeutung bestimmter Orte und Bewegungsrichtungen
- 4.2 Sonjas Blicke und Körpersprache
- 5. Die Figurenzeichnung von Verena und Sonja: Reflexion kontrastiver Frauenbilder und unterschiedlicher Lebensentwürfe?
- 6. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Judith Hermanns Erzählung „Sonja“ aus dem Erzählband „Sommerhaus, später“. Die Zielsetzung besteht in der erzähltheoretischen Analyse und der Interpretation der Figurenbeziehungen und zentralen Motive. Die Arbeit untersucht die Darstellung der Figuren, ihre Beziehungen zueinander und die Bedeutung der gewählten Erzählperspektive für das Verständnis des Textes.
- Erzählperspektive und Erzähltechnik
- Charakterisierung der Figuren Verena und Sonja
- Analyse der Beziehung zwischen dem Ich-Erzähler, Verena und Sonja
- Interpretation zentraler Motive und Symbole
- Reflexion kontrastiver Frauenbilder
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Erzählung „Sonja“ von Judith Hermann ein, kontextualisiert sie innerhalb des Erzählbandes „Sommerhaus, später“ und gibt eine knappe inhaltliche Zusammenfassung der Handlung. Sie beschreibt die Hauptfiguren und ihren ungewöhnlichen Beziehungszusammenhang, der im Zentrum der Erzählung steht. Der Fokus liegt auf der besonderen, platonischen Beziehung zwischen dem Ich-Erzähler und Sonja, die sich auf einer Zugfahrt entwickelt und deren Verlauf und Ende die Handlung bestimmen.
2. Analyse erzähltheoretischer Aspekte: Dieses Kapitel analysiert die erzähltheoretischen Aspekte der Erzählung, konzentriert sich auf die Erzählperspektive (homodiegetischer Erzähler mit interner Fokalisierung), die Zeitstrukturen (Erzählzeit und erzählte Zeit) und die sprachlich-stilistischen Merkmale. Die Analyse beleuchtet, wie die erzählerische Gestaltung die Wahrnehmung des Lesers beeinflusst und als Grundlage für weitere Interpretationen dient. Die eingeschränkte Perspektive des Ich-Erzählers wird kritisch hinterfragt, insbesondere im Hinblick auf dessen subjektive Darstellung der Ereignisse und der Beziehungen zu den weiblichen Figuren.
Häufig gestellte Fragen zu Judith Hermanns "Sonja"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert Judith Hermanns Erzählung "Sonja" aus dem Band "Sommerhaus, später". Sie untersucht erzähltheoretische Aspekte, die Charakterisierung der Figuren (insbesondere des Ich-Erzählers, Verena und Sonja), ihre Beziehungen zueinander und zentrale Motive. Ein Schwerpunkt liegt auf der Interpretation der Beziehung zwischen dem Ich-Erzähler und Sonja und der Reflexion kontrastiver Frauenbilder.
Welche erzähltheoretischen Aspekte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Erzählperspektive (homodiegetischer Erzähler mit interner Fokalisierung), die Zeitstrukturen (Erzählzeit und erzählte Zeit) und die sprachlich-stilistischen Merkmale der Erzählung. Die eingeschränkte Perspektive des Ich-Erzählers und deren Einfluss auf die Leserwahrnehmung werden kritisch beleuchtet.
Wie werden die Figuren charakterisiert?
Die Arbeit charakterisiert den Ich-Erzähler, Verena und Sonja. Die Beziehungen zwischen diesen Figuren, insbesondere die besondere, platonische Beziehung zwischen dem Ich-Erzähler und Sonja, stehen im Mittelpunkt der Analyse. Die Arbeit untersucht auch, wie die Figurenzeichnung kontrastierende Frauenbilder und Lebensentwürfe widerspiegelt.
Welche zentralen Motive werden interpretiert?
Die Analyse umfasst die Interpretation zentraler Motive und Symbole in der Erzählung. Konkret werden die Bedeutung bestimmter Orte, Bewegungsrichtungen, Sonjas Blicke und Körpersprache untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung (inhaltliche Zusammenfassung und Kontextualisierung), 2. Analyse erzähltheoretischer Aspekte, 3. Charakterisierung und Bewertung der Figuren und ihrer Beziehungen, 4. Zentrale Motive und Deutungsansätze, 5. Reflexion kontrastiver Frauenbilder, 6. Schlussbetrachtungen. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Erzählung "Sonja".
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt auf eine erzähltheoretische Analyse und Interpretation der Figurenbeziehungen und zentralen Motive in Judith Hermanns "Sonja" ab. Sie untersucht die Darstellung der Figuren, ihre Beziehungen und die Bedeutung der Erzählperspektive für das Textverständnis.
- Arbeit zitieren
- Claudia Beckmann (Autor:in), 2008, Analyse und Interpretation von Judith Hermanns Erzählung "Sonja", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/90134