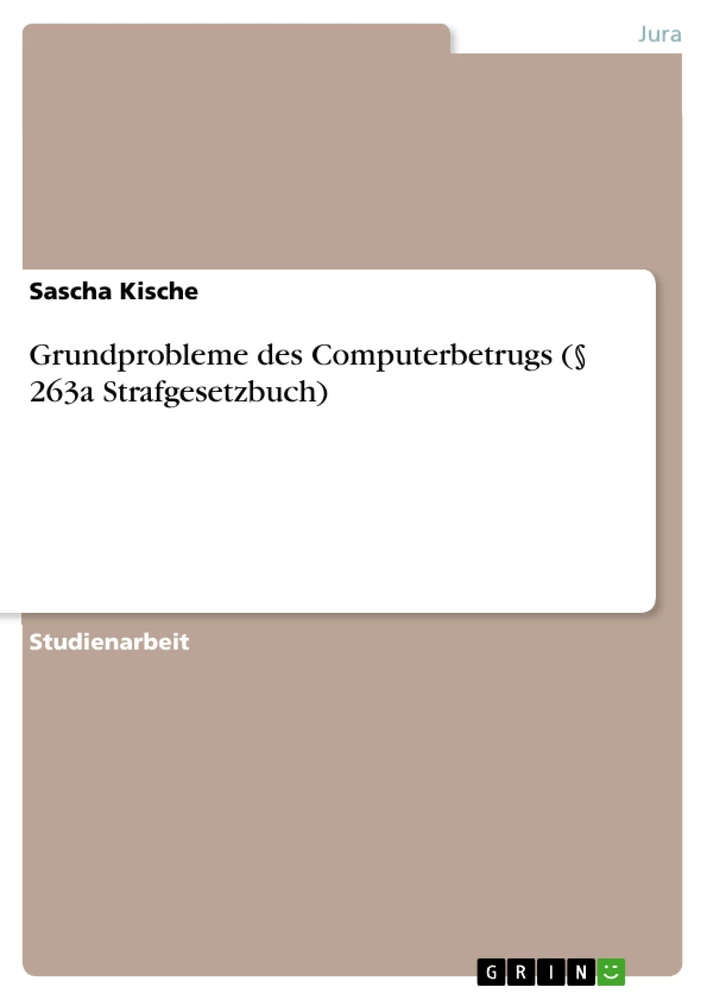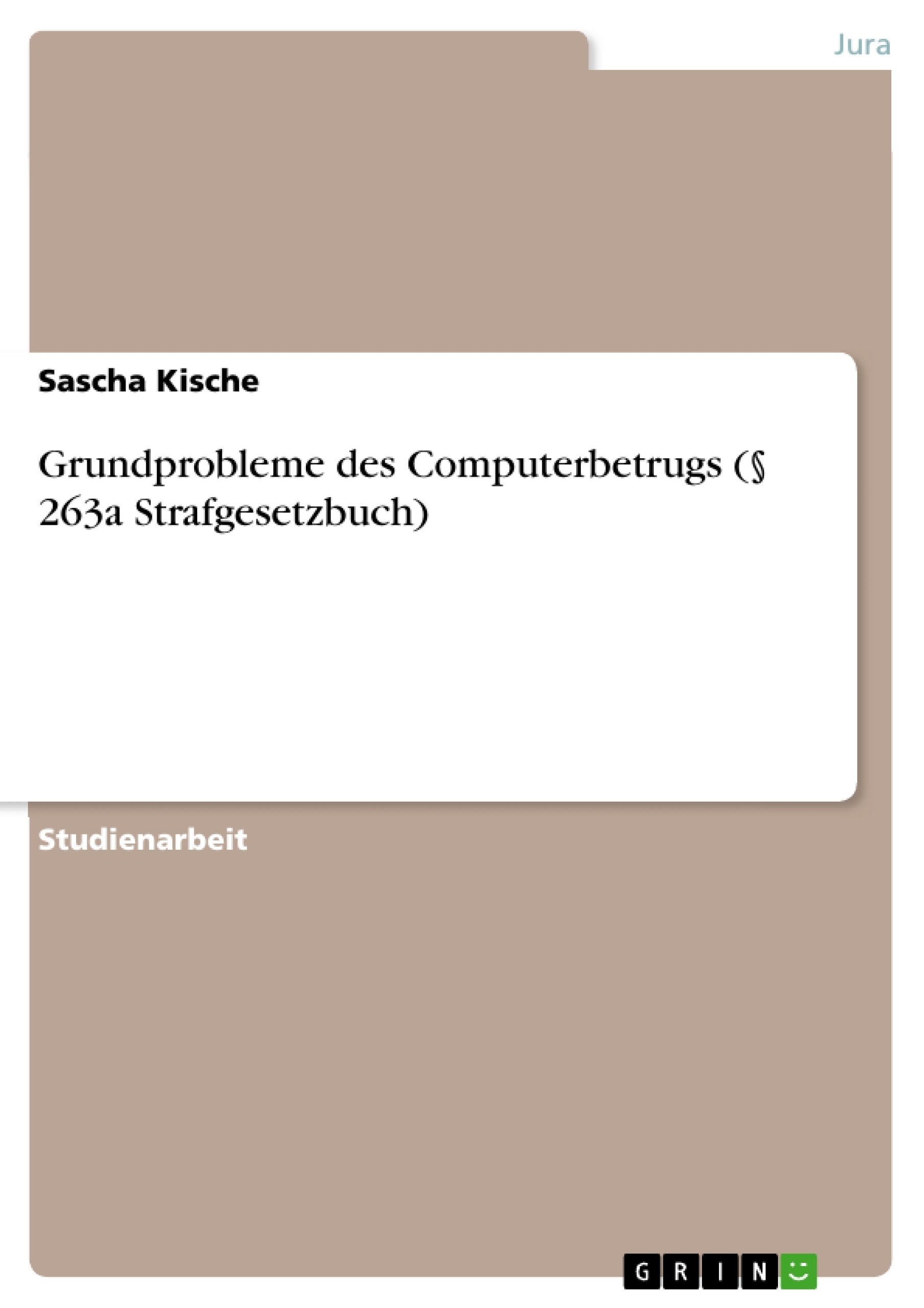Angesichts der weitreichenden Entwicklungen auf dem Computer- und Datensektor sowie der ständigen und sich beinahe überschlagenen technischen Veränderungen gilt es, sich der materiellen und darüber hinaus auch prozessualen Rahmendaten zum Computerbetrug (§ 263a StGB) zu vergewissern. Bei der damaligen Fassung des § 263a orientierte man sich zwar an der Formulierung des klassischen Betrugstatbestandes, doch weist der Straftatbestand auch Elemente der Eigentumsdelikte und der Untreue auf, so dass er einen ganz eigenen Deliktstatbestand darstellt. In der vorliegenden Arbeit werden daher zunächst die 4 unterschiedlichen Verhaltensweisen des § 263a StGB sowie die weiteren Voraussetzungen des objektiven Tatbestandes in den Vordergrund gestellt. Im Anschluss daran werden ausgewählte, für den „Computerbetrug“ in Frage kommende Fallkonstellationen in klausuraufbaumäßiger Form dargestellt und verschiedene Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Über das materielle Strafrecht hinaus wird ein Überblick über die strafprozessualen Grundlagen bei der Verfolgung des Computerbetrugs gegeben. Eine Zusammenfassung und Ausblick runden schließlich die Darstellungen ab. Näheres über den Autor erfahren Sie unter http://www.home.uni-osnabrueck.de/skische.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung unter Skizzierung der wesentlichen Problemstellungen
- II. Der objektive Tatbestand des § 263a StGB
- 1. Gegenstand der Tathandlungen
- a) Daten
- b) Datenverarbeitung/Datenverarbeitungsvorgang
- (1) Begriffsbestimmung
- (2) Erfordernis einer elektronischen Datenverarbeitung (,,EDV-Systeme“)
- (3) Einschränkung auf automatische Datenverarbeitung
- 2. Die einzelnen Tathandlungen
- a) Die unrichtige Gestaltung des Programms
- b) Die Verwendung unrichtiger oder unvollständiger Daten
- c) Die unbefugte Verwendung von Daten
- d) Die sonst unbefugte Einwirkung auf den Ablauf
- 3. Zwischenerfolg: Beeinflussung des Ergebnisses eines Datenverarbeitungsvorgangs
- 4. Taterfolg: Vermögensschaden
- 1. Gegenstand der Tathandlungen
- III. Missbrauch beim „electronic cash“ – die sog. Bankomatenfälle
- IV. Das „Leerspielen“ von Geldspielautomaten
- V. Das „Abtelefonieren“ gefälschter Telefonkarten
- VI. Die „Piraterieakte“ gegen verschlüsselte Pay-TV-Dienste
- VII. Missbrauch eines Geldwechselautomaten durch Einführung eines mit Tesafilm präparierten Geldscheines
- VIII. Strafbarkeit des Telefonierens mit einem fremden Handy
- IX. Exkurs: Strafprozessuale Grundlagen bei der Verfolgung
- 1. Durchsuchungen im EDV-Bereich, §§ 102 ff. StPO
- 2. Durchsicht von Papieren, § 110 StPO
- 3. Beschlagnahme, §§ 94 ff. StPO
- 4. Sonderproblem: Ermittlungen mit Auslandsbezug
- X. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit den Grundproblemen des Computerbetrugs gemäß § 263a Strafgesetzbuch. Sie analysiert die verschiedenen Tatbestandsmerkmale des § 263a StGB, wobei insbesondere die verschiedenen Formen des Missbrauchs von elektronischen Zahlungssystemen, wie z. B. Bankomaten, Geldspielautomaten und Telefonkarten, im Vordergrund stehen. Darüber hinaus werden strafprozessuale Aspekte der Verfolgung von Computerkriminalität, wie Durchsuchungen im EDV-Bereich und Beschlagnahmen, beleuchtet.
- Die Definition und Abgrenzung des Tatbestandes des Computerbetrugs (§ 263a StGB)
- Die verschiedenen Formen des Missbrauchs von elektronischen Zahlungssystemen (z.B. Bankomaten, Geldspielautomaten, Telefonkarten)
- Die strafprozessualen Besonderheiten bei der Verfolgung von Computerkriminalität
- Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Computerkriminalität
- Die Problematik der Beweisführung in Computerkriminalitätsfällen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Diese Einführung skizziert die wesentlichen Problemstellungen im Zusammenhang mit dem Computerbetrug und führt in das Thema der Seminararbeit ein.
- Kapitel II: Dieses Kapitel analysiert den objektiven Tatbestand des § 263a StGB. Es werden die verschiedenen Tatbestandsmerkmale, wie z. B. der Gegenstand der Tathandlungen, die einzelnen Tathandlungen und der Taterfolg, detailliert erläutert.
- Kapitel III: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Missbrauch beim „electronic cash“ und analysiert verschiedene Fälle von Bankomatenbetrug. Es werden die unterschiedlichen Formen des Missbrauchs, wie z. B. durch den berechtigten Karteninhaber, durch Dritte oder durch nichtberechtigte Karteninhaber, untersucht.
- Kapitel IV: Dieses Kapitel behandelt die strafrechtliche Erfassung des „Leerspielens“ von Geldspielautomaten und analysiert die verschiedenen Formen dieses Missbrauchs.
- Kapitel V: Dieses Kapitel befasst sich mit dem „Abtelefonieren“ gefälschter Telefonkarten und untersucht die rechtlichen Probleme im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Telefonkarten.
- Kapitel VI: Dieses Kapitel thematisiert die „Piraterieakte“ gegen verschlüsselte Pay-TV-Dienste und diskutiert die rechtlichen Aspekte des Zugriffs auf Pay-TV-Dienste.
- Kapitel VII: Dieses Kapitel beschreibt den Missbrauch eines Geldwechselautomaten durch die Einführung eines mit Tesafilm präparierten Geldscheines und analysiert die strafrechtliche Relevanz dieser Handlung.
- Kapitel VIII: Dieses Kapitel untersucht die Strafbarkeit des Telefonierens mit einem fremden Handy und diskutiert die rechtlichen Probleme im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Handys.
- Kapitel IX: Dieses Kapitel analysiert die strafprozessualen Grundlagen bei der Verfolgung von Computerkriminalität. Es werden verschiedene strafprozessuale Maßnahmen wie Durchsuchungen im EDV-Bereich, Durchsicht von Papieren und Beschlagnahmen sowie die Problematik der Ermittlungen mit Auslandsbezug beleuchtet.
Schlüsselwörter
Computerbetrug, § 263a StGB, elektronische Zahlungssysteme, Bankomaten, Geldspielautomaten, Telefonkarten, Pay-TV-Dienste, Computerkriminalität, Strafprozessuale Grundlagen, Durchsuchungen im EDV-Bereich, Beschlagnahme, Ermittlungen mit Auslandsbezug.
- Quote paper
- Ass. iur. Sascha Kische (Author), 2002, Grundprobleme des Computerbetrugs (§ 263a Strafgesetzbuch), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/89978