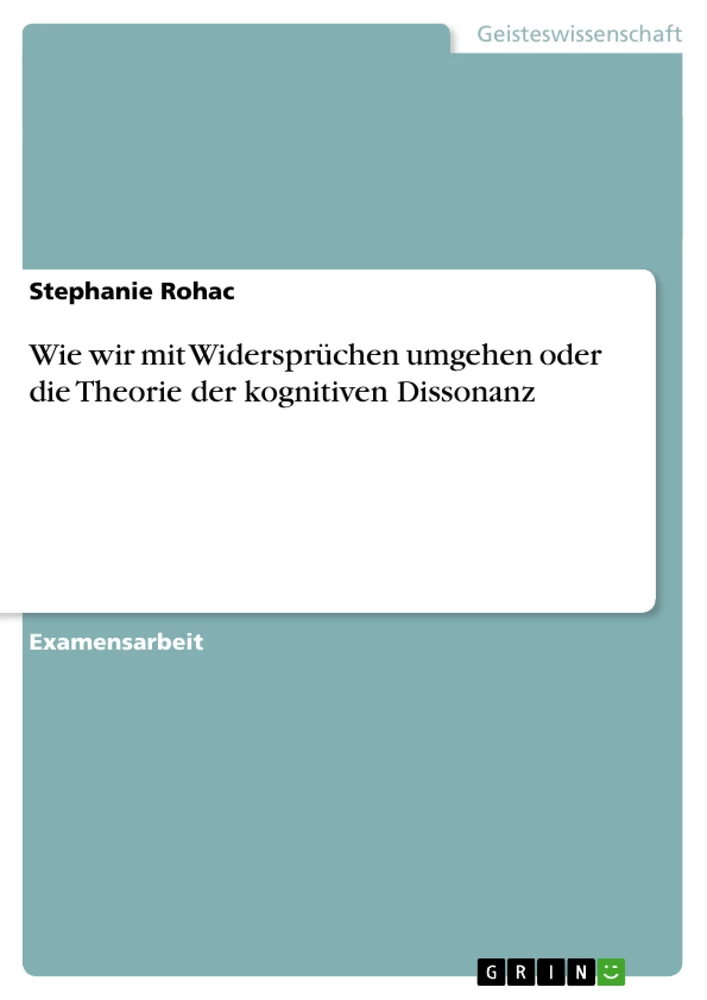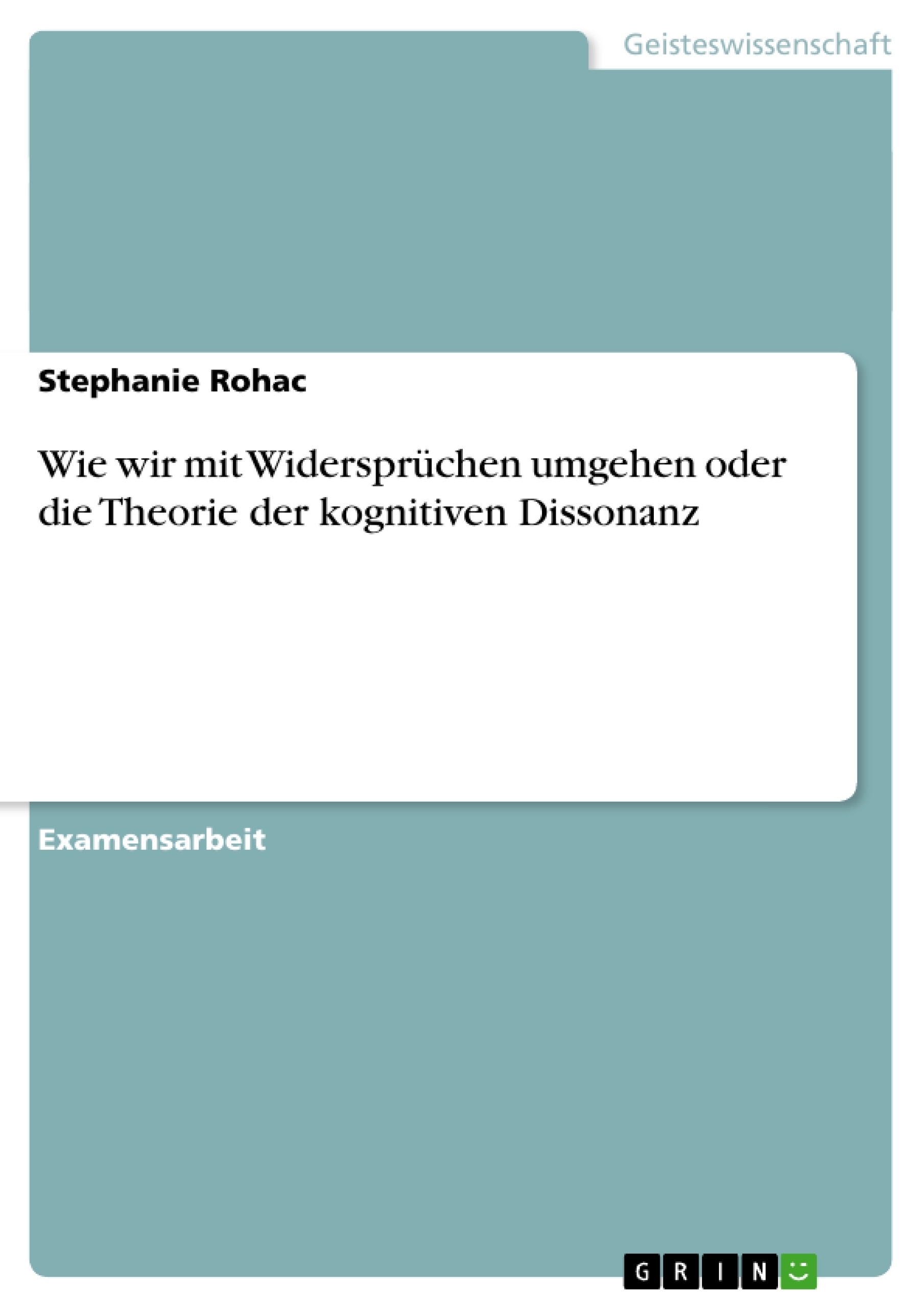Scheinbar nebensächliche Aussagen können Menschen in besonderen Fällen sehr hart treffen. Hat man sich für eine bestehende Handlungsalternative entschieden, schmerzt es, wenn sich eine andere, somit verschmähte Variante als die vermeintlich bessere herausstellt. Wie in diesem Beispiel aus der Unterhaltung zweier Damen:
„Die Schuhe hattest du jetzt gekauft, oder? Klar, freu dich doch, die sind doch wirklich schick. Obwohl ich gestern zufällig gesehen habe, dass die gleichen in dem Geschäft XY preisreduziert zu haben waren.“
Diese Situation steht stellvertretend für eine Reihe von vielen alltäglichen Begebenheiten, bei denen sich der Betroffene verunsichert fühlt und Strategien entwickelt, diesen Kontrollverlust wieder in einen stabilen kognitiven Zustand zu bringen. Treffen Menschen Entscheidungen oder vertreten bestimmte Positionen, drängen intrapsychische und interpersonelle Kräfte zu konsistentem Verhalten mit diesen Feststellungen. Vielfach kommt es zur Rechtfertigung der früheren Entscheidung. Haben Menschen sich selbst überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, fühlen sie sich wohler mit der Situation. Da Menschen im Allgemeinen bestrebt sind, ein gewisses inneres Gleichgewicht zu halten, initiieren sie Selbstheilungsprozesse, die diese Dissonanzen zu reduzieren versuchen. Theoretiker wie FESTINGER, HEIDER und NEWCOMB betrachten das Streben nach Konsistenz als zentrales psychologisches Motiv.
Die Theorie der kognitiven Dissonanz versucht dieses Phänomen zu erklären und hat in der Wissenschaft der Psychologie einen besonderen Stellenwert eingenommen:
„Kaum eine Theorie hat innerhalb der Psychologie und besonders innerhalb der Sozialpsychologie derart umfangreiche Forschungen angeregt und Kontroversen ausgelöst wie die Theorie der kognitiven Dissonanz, die 1957 von Leon Festinger vorgestellt wurde.“
Diese Arbeit legt einen Schwerpunkt auf die ursprüngliche Theorie Leon FESTINGERs und ermöglicht es somit, die Grundlage für ein Verständnis weiterer aufbauender Theorien und Anwendungsbereiche zu entwickeln. Eine ausführliche theoretische Herleitung eröffnet den Rahmen für einen Einblick in die Vielfältigkeit der Anwendung dieser Theorie. Somit wird eine theoretisch fundierte und zugleich sehr praxisorientierte Darstellung erreicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Theoretische Betrachtung
- 2.1. Einstellung, Verhalten und Kognition
- 2.2. Konsonanz und Dissonanz
- 2.2.1. Konsonanz
- 2.2.2. Dissonanz
- 2.2.2.1. Ursachen kognitiver Dissonanz
- 2.2.2.2. Stärke der Dissonanz
- 2.2.2.3. Reduktion von Dissonanz
- 2.2.2.3.1. Änderung eines kognitiven Elements des Verhaltens
- 2.2.2.3.2. Änderung eines kognitiven Elements der Umwelt
- 2.2.2.3.3. Hinzufügen neuer kognitiver Elemente
- 2.2.2.4. Vermeidung von Dissonanz
- 3. Ausgewählte Anwendungen auf Basis der Theorie der kognitiven Dissonanz
- 3.1. Selbstverpflichtung (Commitment)
- 3.1.1. Commitments und der Einfluss auf das Selbstbild
- 3.1.2. Anwendungsbereiche
- 3.1.2.1. Allgemeine Anwendungen
- 3.1.2.2. Spezielle Anwendung: Foot-in-the-door Technik
- 3.2. Dissonanz nach Entscheidungen
- 3.2.1. Entscheidungen und unvermeidbare Dissonanz
- 3.2.2. Faktoren zur Bestimmung der Dissonanzstärke nach Entscheidungen
- 3.2.2.1. Wichtigkeit der Entscheidung
- 3.2.2.2. Relative Attraktivität der nichtgewählten Alternative
- 3.2.2.3. Grad der kognitiven Überlappung
- 3.1. Selbstverpflichtung (Commitment)
- 4. Zusammenfassender Überblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Theorie der kognitiven Dissonanz umfassend darzustellen und ihre vielseitigen Anwendungsbereiche aufzuzeigen. Sie verbindet theoretische Fundierung mit praxisorientierter Erklärung, um dem Leser sowohl ein grundlegendes Verständnis als auch die Möglichkeit zur praktischen Anwendung im Alltag zu vermitteln.
- Theoretische Grundlagen der kognitiven Dissonanz
- Konsonanz und Dissonanz als zentrale Konzepte
- Mechanismen der Dissonanzreduktion und -vermeidung
- Anwendungsbeispiele der Theorie in verschiedenen Kontexten
- Der Einfluss von Selbstverpflichtung und Entscheidungen auf die kognitive Dissonanz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses einführende Kapitel legt den Grundstein für die gesamte Abhandlung. Es beschreibt den Umfang und die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, die Theorie der kognitiven Dissonanz sowohl theoretisch fundiert als auch praxisorientiert darzustellen. Der Leser wird darauf vorbereitet, sowohl das theoretische Verständnis als auch die praktische Anwendbarkeit der Theorie zu erlernen. Die Einleitung betont die Wichtigkeit der klaren Kennzeichnung von Zitaten und Beispielen im Text.
2. Theoretische Betrachtung: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und liefert eine detaillierte Erläuterung der Theorie der kognitiven Dissonanz. Es beleuchtet die Beziehung zwischen Einstellungen, Verhalten und Kognitionen und definiert die Konzepte der Konsonanz und Dissonanz. Ausführlich werden die Ursachen, die Stärke und die Reduktionsmechanismen kognitiver Dissonanz untersucht, einschließlich der Strategien zur Änderung kognitiver Elemente, der Hinzufügung neuer Elemente und der Vermeidung von Dissonanz. Dieses Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen für die späteren Anwendungsbeispiele dar.
3. Ausgewählte Anwendungen auf Basis der Theorie der kognitiven Dissonanz: Dieses Kapitel wendet die im zweiten Kapitel dargestellte Theorie auf verschiedene Praxisbereiche an. Es fokussiert sich auf die Konzepte der Selbstverpflichtung (Commitment) und der Dissonanz nach Entscheidungen. Die Selbstverpflichtung wird im Kontext des Einflusses auf das Selbstbild und mit konkreten Anwendungsbeispielen, einschließlich der Foot-in-the-door Technik, erläutert. Der Abschnitt über Dissonanz nach Entscheidungen analysiert die unvermeidbare Dissonanz nach getroffenen Entscheidungen und identifiziert Faktoren, die die Stärke der Dissonanz beeinflussen, wie z.B. die Wichtigkeit der Entscheidung und die Attraktivität der nichtgewählten Alternativen. Zusammenfassend zeigt dieses Kapitel die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der Theorie der kognitiven Dissonanz.
Schlüsselwörter
Kognitive Dissonanz, Konsonanz, Dissonanzreduktion, Selbstverpflichtung, Commitment, Entscheidungen, Foot-in-the-door Technik, Einstellung, Verhalten, Kognition, Anwendung, Alltag.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Theorie der kognitiven Dissonanz
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Theorie der kognitiven Dissonanz. Es umfasst eine Einleitung, eine detaillierte theoretische Betrachtung der Konsonanz und Dissonanz, verschiedene Mechanismen der Dissonanzreduktion und -vermeidung sowie ausgewählte Anwendungsbeispiele, darunter Selbstverpflichtung (Commitment) und Dissonanz nach Entscheidungen. Zusätzlich enthält es ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die zentralen Themen sind die theoretischen Grundlagen der kognitiven Dissonanz, die Konzepte der Konsonanz und Dissonanz, die Mechanismen der Dissonanzreduktion und -vermeidung (z.B. Änderung kognitiver Elemente, Hinzufügen neuer Elemente, Vermeidung), die Anwendung der Theorie in verschiedenen Kontexten, der Einfluss von Selbstverpflichtung (inkl. Foot-in-the-door Technik) und Entscheidungen auf die kognitive Dissonanz, sowie die Stärke der Dissonanz nach Entscheidungen (abhängig von Wichtigkeit, Attraktivität der nicht gewählten Alternative und kognitiver Überlappung).
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einführung), Kapitel 2 (Theoretische Betrachtung: Einstellung, Verhalten, Kognition; Konsonanz und Dissonanz mit detaillierter Erläuterung der Dissonanzreduktion), Kapitel 3 (Ausgewählte Anwendungen: Selbstverpflichtung, Foot-in-the-door Technik, Dissonanz nach Entscheidungen), und Kapitel 4 (Zusammenfassender Überblick).
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, die Theorie der kognitiven Dissonanz umfassend darzustellen und ihre vielfältigen Anwendungsbereiche aufzuzeigen. Es verbindet theoretische Fundierung mit praxisorientierter Erklärung, um dem Leser sowohl ein grundlegendes Verständnis als auch die Möglichkeit zur praktischen Anwendung im Alltag zu vermitteln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Kognitive Dissonanz, Konsonanz, Dissonanzreduktion, Selbstverpflichtung, Commitment, Entscheidungen, Foot-in-the-door Technik, Einstellung, Verhalten, Kognition, Anwendung, Alltag.
Wie ist das Dokument aufgebaut?
Das Dokument ist strukturiert mit einem Inhaltsverzeichnis, einer Beschreibung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und einer Liste von Schlüsselwörtern. Die Kapitel sind klar gegliedert und folgen einer logischen Reihenfolge, beginnend mit der theoretischen Grundlage und fortschreitend zu den Anwendungsbeispielen.
Für wen ist dieses Dokument geeignet?
Das Dokument ist für Leser geeignet, die sich für die Theorie der kognitiven Dissonanz interessieren, egal ob mit akademischem Hintergrund oder nicht. Die Kombination aus theoretischer Erklärung und praktischen Beispielen macht es sowohl für Studierende als auch für Personen zugänglich, die die Theorie in ihrem Alltag anwenden möchten.
Wo finde ich mehr Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln finden sich in den jeweiligen Kapitelzusammenfassungen innerhalb des Dokuments. Diese Zusammenfassungen bieten einen Überblick über den Inhalt und die zentralen Punkte jedes Kapitels.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts in International Management (B.A.) Stephanie Rohac (Autor:in), 2008, Wie wir mit Widersprüchen umgehen oder die Theorie der kognitiven Dissonanz, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/89831