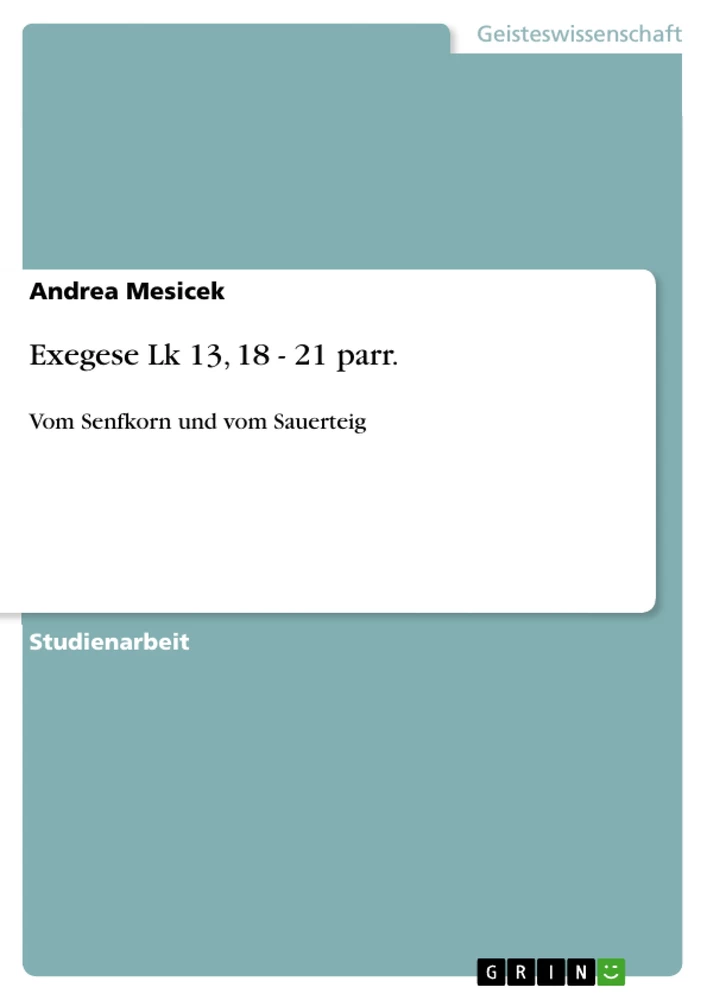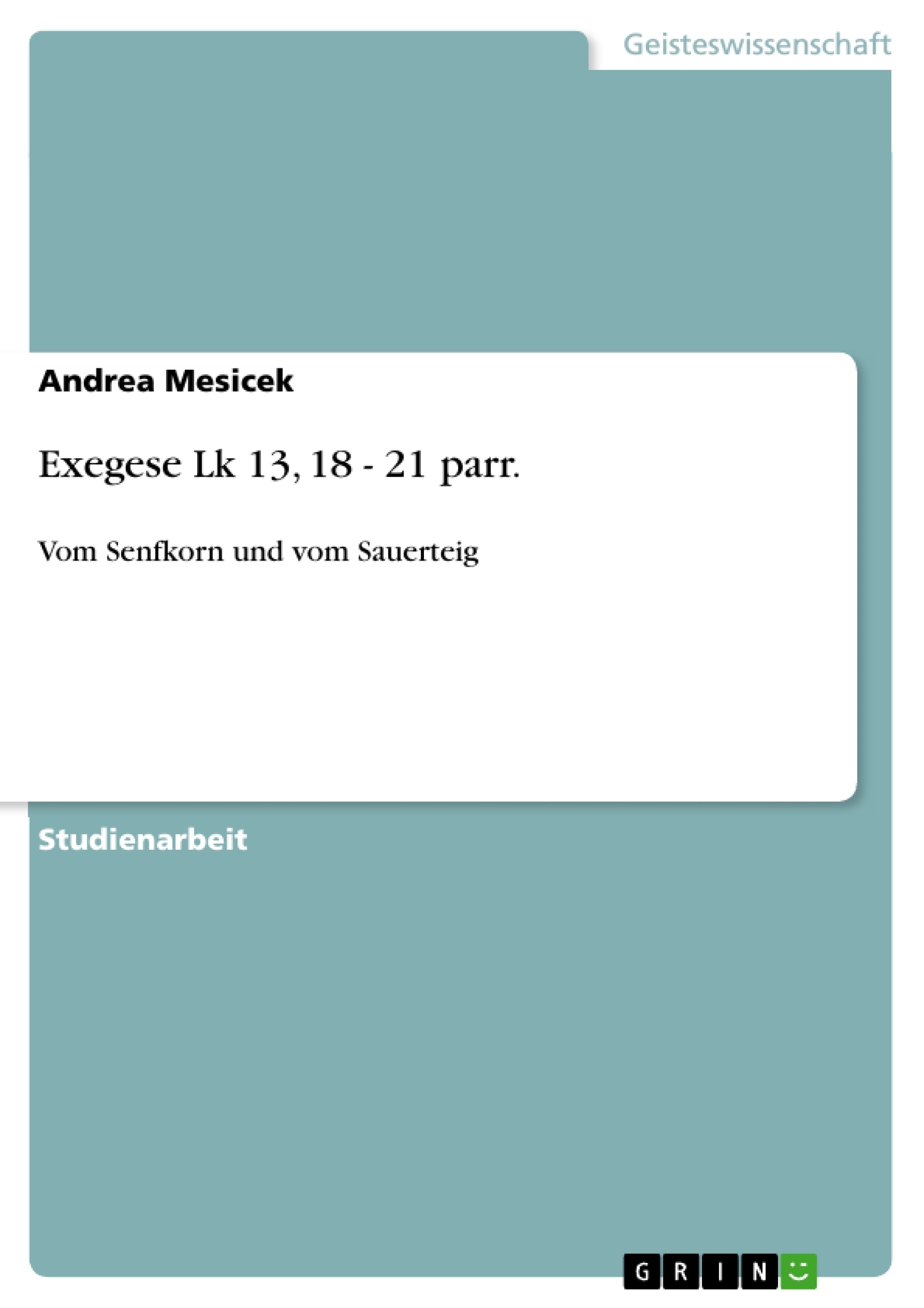„Dein Reich komme“ beten Christen weltweit im Vater Unser, als handelte es sich bei dieser Formulierung um das Herbeibitten einer ganz ‚selbstverständlichen’ Größe. Dass das erbetene ‚Reich’ (Gottes bzw. der Himmel), die βασιλεία (του θεου bzw. των ούρανων), so ‚selbstredend’ nicht sein kann, belegt dagegen schon allein der Befund, dass alle drei Synoptiker es in vielfältiger, nicht widerspruchspruchsfreier Weise thematisieren und Jesus selbst eine oft bildhaft vergleichende Rede von der Basileia in den Mund legen. Schon ein grober Vergleich der relevanten Belegstellen weist die Mehrdeutigkeit dieses Begriffs aus: teils erscheint die Basileia als geographische Größe, in die man „hineinkommen“, bzw. in der man „sein“, „sitzen“ oder aus ihr „ausgestoßen sein“ kann, teils wird sie qualitativ als göttliche Herrschaftsausübung bestimmt, die, obwohl schon angebrochen, erst in der Endzeit volle Verwirklichung findet. Die Zuordnung der jeweiligen Belege in eine der Kategorien kann dabei oft nicht mit letzter Sicherheit getroffen werden. Die offenkundige Polyvalenz des Ausdrucks liegt darin begründet, dass er selbst ja eine Metapher darstellt und als solche prinzipiell semantisch offen ist, wenn auch der kontextuelle Rahmen den Interpretationsmöglichkeiten Grenzen steckt.
Ungeachtet dieser Problemlage, legt die über 80malige Bezeugung des Begriffs in den synoptischen Evangelien nahe, dass die βασιλεία του θεου als zentraler Verkündigungsinhalt Jesu zu gelten hat. Nicht nur die Quantität der Belegstellen, auch ihre Verteilung über verschiedene gattungskritische Formen innerhalb, aber auch außerhalb direkter Rede Jesu, sowie ihre Eingebundenheit in unterschiedliche Kontexte zeigen, wie sehr Jesus darin bemüht war, seinen Hörern die Basileia ‚nahezubringen’. Oft, wie auch im vorliegenden Fall, bediente er sich hierzu des einzigen Mittels, das die menschliche Sprache zur Beschreibung göttlicher Wirklichkeit zur Verfügung stellt: Bildhaft-vergleichender Redeweise.
Am Beispiel der/s Gleichnisse/s vom Senfkorn und vom Sauerteig (Lk 13, 18-21 parr.), sowie unter Zuhilfenahme der klassischen Verfahrensweisen neutestamentlicher Exegese (u. a. die Methodenschritte der Textlinguistik, Textkritik, Literarkritik, Synoptischer Vergleich, Formkritik, Religionsgeschichtlicher Vergleich) versucht die hier unternommene Analyse die Polyvalenz der Basileia-Metapher zu schmälern, um so exemplarisch Zugang zu einem adäquaten Verstehen der Gleichnisrede Jesu zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- I. „Dein Reich komme...“
- II. Textlinguistik:
- a) Syntaktische Analyse:
- b) Semantische Analyse:
- 1. „Senfkorn“:
- 2. „Sauerteig“:
- c) Textpragmatik:
- III. Textkritik: Übersetzungsvergleich:
- Exkurs I: Zur „Dynamik“ der Basileia
- IV. Literarkritik:
- a) Abgrenzung der „kleinsten sinnvollen Texteinheit“ vom Kontext...
- 1. Abgrenzung vom Vorangehenden...
- 2. Abgrenzung vom Nachfolgenden:
- Exkurs II: „Letzte, die werden die Ersten sein...“
- b) Einordnung von Lk 13, 18-21 in den Makrokontext:
- c) Kohärenz ?
- a) Abgrenzung der „kleinsten sinnvollen Texteinheit“ vom Kontext...
- V. Synoptischer Vergleich:
- a) Lk 13, 18-21 vs. Mk 4, 30 – 32:
- b) Lk 13, 18 - 21 vs. Mt 13, 31 - 33 (vs. Mk 4, 30-32):
- 1. Lk 13, 18-19 vs. Mt 13, 30 – 32:
- 2. Lk 13, 20-21 vs. Mt 13, 33:
- 3. Identifikation der ältesten Textvariante:
- VI. Formgeschichte / Formkritik:
- a) Prämissen und Begriffsklärung:
- b) Charakteristika der Gattung „Gleichnis“ nach R. BULTMANN:
- c) Anwendung und Prüfung der BULTMANN’schen Kriterien auf Lk 13, 18–21parr:
- VIII. Religionsgeschichtlicher Vergleich, Traditions- und redaktionsgeschichtliche Erwägungen, im Hinblick auf die Frage nach dem Historischen Jesus:
- a) Allgemeine Übereinstimmungen mit religionsgeschichtlichen Parallelphänomenen:
- b) Konkretisierung des Befundes an Lk 13, 18 – 21parr:
- 1. Das „Senfkorn“ als metaphorische Innovation:
- 2. Konnotationen des „Baumes“:
- 3. Die „Vögel des Himmels“ - ein redaktioneller Nachtrag?
- 4. Zur metaphorischen Indikation des „Sauerteiges“: Eine usuelle Metapher in neuem Gewand
- Exkurs III: Das „Fest der ungesäuerten Brote“:
- 5. „Drei Sea Mehl“ – nachgetragene AT-Reminiszenz?
- 6. Frage vs. mt Einleitungsformel: Wie leitete Jesus seine Gleichnisse ein?
- Exkurs IV: Welche Vortragssituation plausibilisiert die Formulierung einer Doppelfrage?
- c) Rekonsruktionsversuch der ipsissima verba Jesu und hermeneutische Konsequenzen:
- d) Vergleich von Mk 4, 30-32 mit dem rekonstruierten Prototypus und Deutung der Differenzen:
- e) Mk 4, 30-32 – ‚Prototypus' – Lk 13, 18–19 (– Q-Fassung): Vergleich und Deutung der Differenzen:
- f) Integration von Lk 13, 20 – 21 und abschliessende Interpretation:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der exegetischen Untersuchung des Gleichnisses vom Senfkorn und vom Sauerteig in Lukas 13, 18-21. Ziel ist es, den Text in seiner literarischen und historischen Bedeutung zu analysieren und seine Aussagekraft im Kontext der synoptischen Evangelien zu erforschen.
- Die Bedeutung der Metapher „Reich Gottes“ in der neutestamentlichen Literatur
- Die Interpretation und Funktion von Gleichnissen im Kontext der jüdisch-christlichen Tradition
- Die Bedeutung der Synoptiker für die Auslegung der Jesusworte
- Die Herausforderungen der Textkritik und die Frage nach der ältesten Textvariante
- Die Rolle der Formgeschichte und Formkritik bei der Interpretation von Gleichnissen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit setzt sich mit der Bedeutung des Begriffs „Reich Gottes“ im Kontext der synoptischen Evangelien auseinander. Es analysiert die verschiedenen Facetten des Begriffs und die unterschiedlichen Interpretationen, die sich in der neutestamentlichen Literatur finden.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der textlinguistischen Analyse des Gleichnisses vom Senfkorn und vom Sauerteig in Lukas 13, 18-21. Es untersucht die syntaktische Struktur des Textes und die Bedeutung der einzelnen Wörter und Wendungen.
Das dritte Kapitel behandelt die Textkritik des Gleichnisses und analysiert die Unterschiede zwischen den verschiedenen Übersetzungsvarianten.
Das vierte Kapitel widmet sich der literarkritischen Untersuchung des Gleichnisses und setzt es in den Kontext des Lukasevangeliums ein. Es analysiert die Kohärenz des Textes und seine Beziehung zum Vor- und Nachtext.
Das fünfte Kapitel bietet einen synoptischen Vergleich des Gleichnisses mit seinen Parallelen in Markus und Matthäus. Es analysiert die Unterschiede zwischen den drei Textvarianten und versucht, die älteste Form des Gleichnisses zu identifizieren.
Das sechste Kapitel untersucht die Formgeschichte und Formkritik des Gleichnisses und analysiert seine Gattung und seine typischen Merkmale.
Schlüsselwörter
Reich Gottes, Gleichnis, Senfkorn, Sauerteig, Synoptiker, Textkritik, Formgeschichte, Formkritik, Historischer Jesus, metaphorische Innovation, redaktionsgeschichtliche Erwägungen.
- Quote paper
- Andrea Mesicek (Author), 2006, Exegese Lk 13, 18 - 21 parr., Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/89773