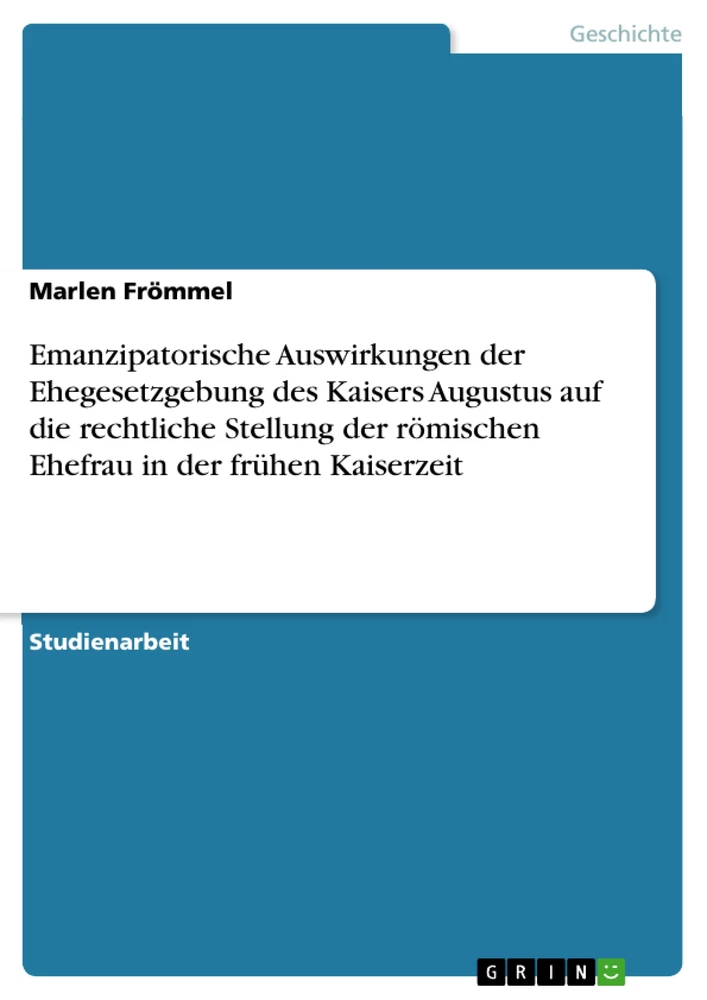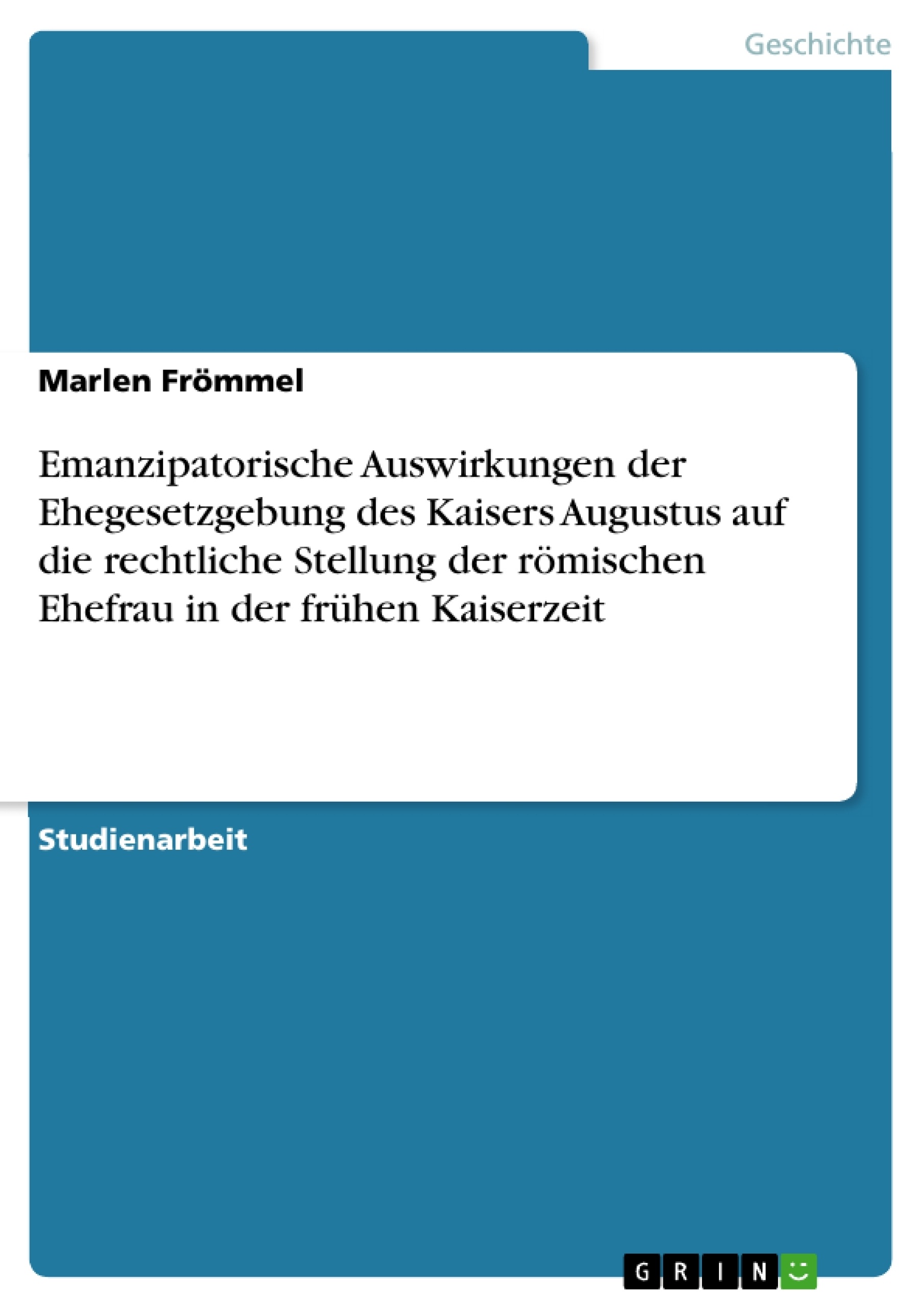„Er übernahm auch die Aufsicht über die Sitten und Gesetze, und zwar auf Lebenszeit […].“ Mit diesen Worten nimmt Sueton in seiner Kaiservita Bezug auf die von Augustus erlassenen Ehegesetze. Mit der lex Iulia de maritandis ordinibus aus dem Jahr 18 v. Chr. und ihrer Ergänzung von 9 n. Chr., der lex Papia Poppaea, beabsichtigte Kaiser Augustus die herrschende Demoralisierung sowie die zunehmende Kinder- und Ehelosigkeit vor allem in den oberen Schichten zu bekämpfen.
Die unmittelbaren rechtlichen Auswirkungen dieser Gesetze, die Eheverbote ebenso wie Ehegebote enthielten, sollen nun hinsichtlich einer Verbesserung der Stellung der römischen Ehefrau untersucht werden. Daraus ergibt sich, dass weder Sklavinnen und Konkubinen noch andere Frauengruppen, die laut der augusteischen Gesetzgebung nicht in der Lage waren, eine legitime Ehe einzugehen, behandelt werden. Auch wenn sich das Thema auf die Frau bezieht, so ist es unumgänglich, auch die römischen Männer einzubeziehen, um die Lage der Frau deutlich zu machen, insbesondere wenn emanzipatorische Vorgänge festzustellen sind. [...]
Da die rechtliche Stellung der Ehefrau in diesem Zusammenhang als Ansatzpunkt dient, ist festzuhalten, dass Gesetze erlassen werden, um die bestehende Ordnung zu gewährleisten oder aber um Veränderungen im Sinne des Gesetzgebers herbeizuführen. Sie vermitteln, warum welche Verbote oder Gebote erforderlich waren, so dass man Rückschlüsse auf das Leben der Ehefrau in der frühen Kaiserzeit ziehen kann.
Im Folgenden wird es also darum gehen, inwieweit es der römischen Ehefrau durch die Ehegesetzgebung des Kaiser Augustus gelang, aus dem Schatten der Vormundschaft eines Mannes hervorzutreten. Welche Vorteile oder Nachteile ergaben sich für sie? Fanden diese Veränderungen wie auch generell die erlassenen Gesetze Zustimmung? Nach einer Einführung in das neue Gesetzeswerk des Kaisers muss, um diesen Fragen nachzugehen, geklärt werden, welche Formen einer Vormundschaft in welchem Lebensabschnitt über eine Frau ausgeübt wurden. Anschließend wird die Gesetzgebung des Augustus hinsichtlich ihrer für eine römische Ehefrau relevanten Anwendungsfelder betrachtet – Ehe, Scheidung, Sexualstraftaten und Erbe –, so dass aus diesen Entwicklungen auf die veränderte/emanzipierte Stellung der Frau geschlossen werden kann. In einem ersten Schritt soll zunächst jedoch die Quellenlage und der Forschungsstand dargelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die antiken Quellen und die Forschungsliteratur
- Die Digesten
- Die Institutiones des Gaius
- Sueton
- Tacitus
- Forschungsliteratur
- Die Ehe- und Sittengesetzgebung des Kaisers Augustus
- Die Vormundschaft über Frauen
- Die Ehe
- Scheidung
- Ehebruch und Stuprum
- Die augusteische Erbgesetzgebung
- Die Emanzipation der römischen Ehefrau
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der rechtlichen Stellung der römischen Ehefrau in der frühen Kaiserzeit und untersucht, inwieweit die Ehegesetzgebung des Kaisers Augustus die Emanzipation der Frauen beeinflusst hat. Dabei wird der Fokus auf die legistischen Auswirkungen der lex Iulia de maritandis ordinibus und der lex Papia Poppaea gelegt, wobei die Frage im Mittelpunkt steht, ob diese Gesetze eine Verbesserung der rechtlichen Position der Frau herbeiführten.
- Rechtliche Stellung der römischen Ehefrau in der frühen Kaiserzeit
- Einfluss der Ehegesetzgebung des Kaisers Augustus auf die Emanzipation von Frauen
- Analyse der lex Iulia de maritandis ordinibus und der lex Papia Poppaea
- Bewertung der Auswirkungen der Gesetze auf die rechtliche Position der Frau
- Untersuchung der Vormundschaft, Ehe, Scheidung, Sexualstraftaten und Erbrechts in Bezug auf die Emanzipation der römischen Ehefrau
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der augusteischen Ehegesetzgebung im Kontext der Emanzipation der römischen Ehefrau vor.
- Die antiken Quellen und die Forschungsliteratur: Dieses Kapitel erläutert die Quellenlage und den Forschungsstand zur rechtlichen Stellung der römischen Ehefrau und der augusteischen Ehegesetzgebung. Es werden wichtige Quellen wie die Digesten, die Institutiones des Gaius, Suetons Kaiservita und Tacitus' Annalen vorgestellt.
- Die Ehe- und Sittengesetzgebung des Kaisers Augustus: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Ehegesetze des Kaisers Augustus, insbesondere über die lex Iulia de maritandis ordinibus und die lex Papia Poppaea. Es werden die Ziele dieser Gesetze sowie ihre wichtigsten Inhalte dargestellt.
- Die Vormundschaft über Frauen: Dieses Kapitel behandelt die Vormundschaft über Frauen im römischen Recht. Es wird die Rolle der Vormundschaft im Lebensabschnitt einer Frau beleuchtet und ihre Auswirkungen auf die rechtliche Stellung der Frau.
- Die Ehe: Dieses Kapitel beleuchtet die Ehe im römischen Recht, insbesondere die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Folgen der Ehe für die Frau.
- Scheidung: Dieses Kapitel behandelt das Scheidungsrecht im römischen Recht und untersucht die Auswirkungen der Scheidung auf die rechtliche Stellung der Frau.
- Ehebruch und Stuprum: Dieses Kapitel analysiert die römischen Gesetze zum Ehebruch und Stuprum und ihre Bedeutung für die rechtliche Stellung der Frau.
- Die augusteische Erbgesetzgebung: Dieses Kapitel widmet sich der augusteischen Erbgesetzgebung und ihren Auswirkungen auf die rechtliche Stellung der Frau.
- Die Emanzipation der römischen Ehefrau: Dieses Kapitel untersucht, inwieweit die augusteische Ehegesetzgebung zu einer Emanzipation der römischen Ehefrau geführt hat.
Schlüsselwörter
Römisches Recht, Ehegesetzgebung, Kaiser Augustus, Emanzipation, lex Iulia de maritandis ordinibus, lex Papia Poppaea, Vormundschaft, Ehe, Scheidung, Ehebruch, Stuprum, Erbgesetzgebung, rechtliche Stellung der Frau, römische Gesellschaft, Antike.
- Quote paper
- Marlen Frömmel (Author), 2004, Emanzipatorische Auswirkungen der Ehegesetzgebung des Kaisers Augustus auf die rechtliche Stellung der römischen Ehefrau in der frühen Kaiserzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/89095