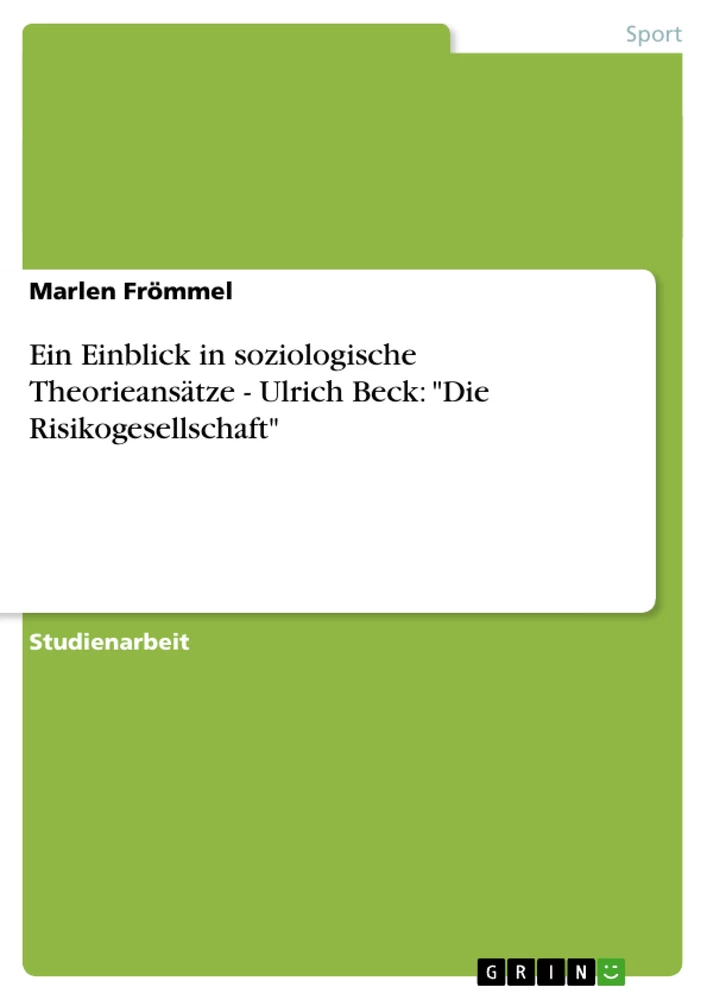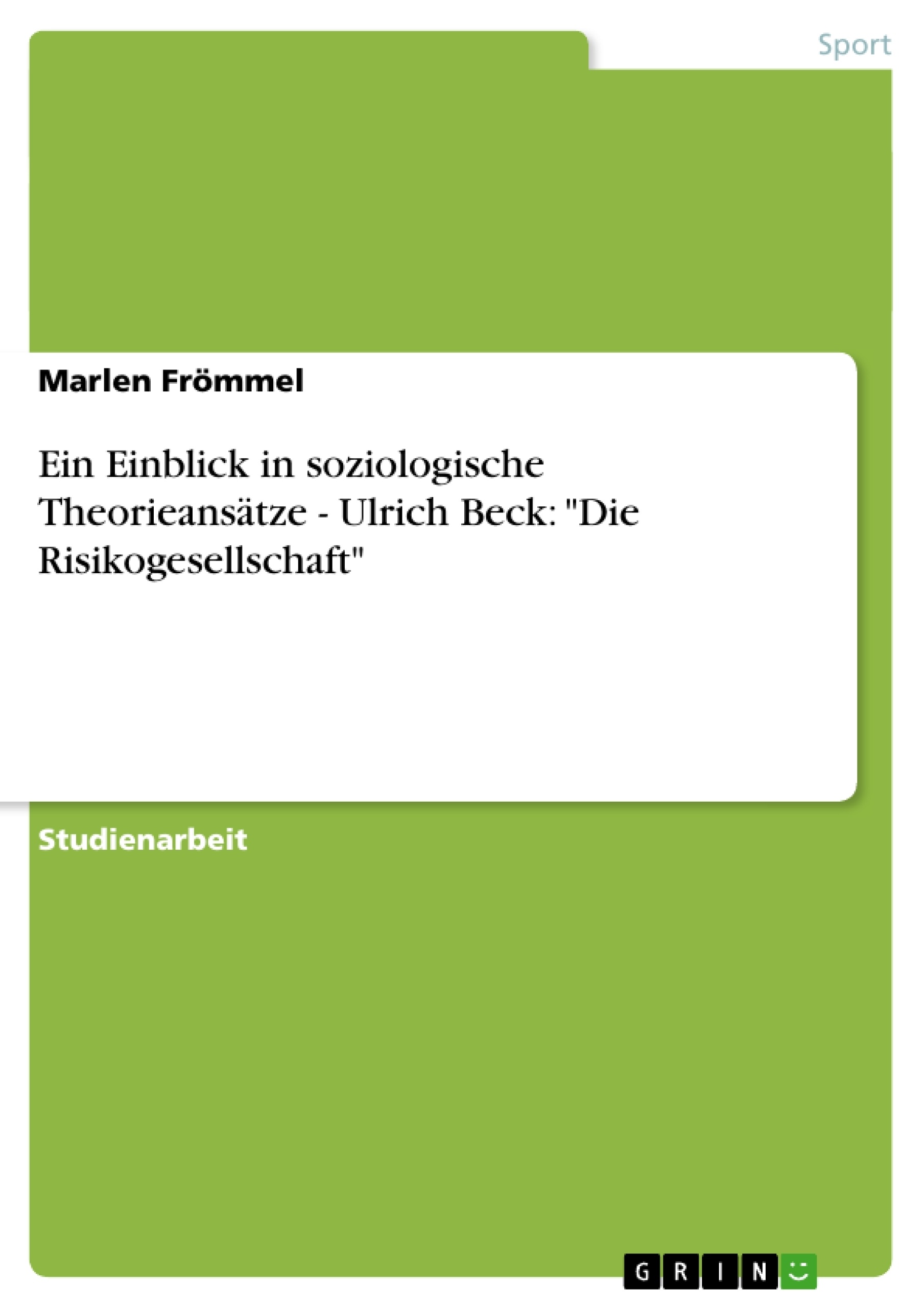Wenn man heute in Zeiten von Harz IV eine Umfrage zum Thema: „Für wie gesichert halten sie ihren Lebensabend?“ starten würde, wäre die Antwort der meisten Menschen: „Für sehr unsicher.“ oder „Es ist riskant zu planen.“
Arbeitslosigkeit und ihre Folgen sind für viele Menschen die größte Bedrohung in ihrem Leben.
Für dieses und andere Risiken bietet die Sozialwissenschaft seit Mitte der 80er Jahre einen Schlüsselbegriff – die „Risikogesellschaft“.
Die Diskussion um diese Art des Gesellschaftskonzeptes wurde 1986 durch den Soziologieprofessor Ulrich Beck (1944) entfacht. In diesem Jahr veröffentlichte er sein Buch „Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne.“
Als solche bezeichnet er eine moderne Gesellschaft, in der die sozialen, politischen, ökologischen und individuellen Risiken aus einem industriegesellschaftlichen Fortschritt resultieren, der sich mehr und mehr den bestehenden Kontroll- und Sicherungsvorkehrungen dieser Gesellschaft entzieht. Somit thematisiert er also auch die Frage, wie mit derartigen Risiken umzugehen ist.
Ziel seiner Gesellschaftstheorie war die Verknüpfung des Handlungs- und des Strukturaspektes (vgl. Treibel 1993, S. 220).
Man kann annehmen, dass dieses Gesellschaftskonzept unter den heutigen regionalen aber auch globalen Gefährdungslagen der Bevölkerung regen Zuspruch erhält.
Inhaltsverzeichnis
- Der Gegenstand der Risikogesellschaft
- Theorie der Risikogesellschaft
- Die drei Säulen der Risikogesellschaft
- Das Theorem der dreifachen Individualisierung
- Der Integrationsaspekt
- Die reflexive Modernisierung
- Globalisierung
- Rezeption und Kritik
- Sport als Spiegel der Risikogesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Ulrich Becks Theorie der Risikogesellschaft. Ziel ist es, die zentralen Konzepte und Argumente Becks zu präsentieren und deren Relevanz zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Struktur der Risikogesellschaft, ihre Ursachen und Folgen, sowie die Rolle von Individualisierung und Globalisierung.
- Die Charakteristika der Risikogesellschaft
- Die drei Säulen der Risikogesellschaft und deren Interdependenzen
- Reflexive Modernisierung und ihre Auswirkungen
- Die Rolle von Globalisierung im Kontext der Risikogesellschaft
- Kritik und Rezeption der Risikogesellschaftstheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Der Gegenstand der Risikogesellschaft: Dieses Kapitel führt in das Thema der Risikogesellschaft ein und veranschaulicht die wachsende Unsicherheit in modernen Gesellschaften, besonders im Hinblick auf Arbeitslosigkeit und den Lebensabend. Es positioniert Becks Werk als zentralen Beitrag zur soziologischen Debatte um dieses Konzept, welches die Herausforderungen industrieller Fortschritte und deren Einfluss auf bestehende Kontroll- und Sicherungsmechanismen beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Problematik des Umgangs mit Risiken und der Verknüpfung von Handlungs- und Strukturaspekten in Becks Theorie.
Theorie der Risikogesellschaft: Dieses Kapitel vergleicht Becks Risikogesellschaftstheorie mit anderen sozialwissenschaftlichen Ansätzen zur Erklärung der postindustriellen oder postmodernen Gesellschaft. Es hebt die ambivalente Natur der Risikogesellschaft hervor: kontinuierliche Modernisierung, Rationalisierung und technischer Fortschritt gehen mit der Gefährdung bestehender gesellschaftlicher Grundlagen einher. Im Mittelpunkt steht die Verschiebung von der Verteilung materieller Güter hin zur Problematik der Risikozurechnung und -verteilung, ein Kernelement von Becks „Logik der Risikoproduktion und der Logik der Risikoverteilung“.
Die drei Säulen der Risikogesellschaft: Dieses Kapitel analysiert die drei Säulen, die Becks Konzept der Risikogesellschaft stützen. Es beleuchtet das Verhältnis der Gesellschaft zu den Ressourcen von Natur und Kultur, die durch Industrialisierung minimiert werden. Weiterhin werden die von der Gesellschaft erzeugten Gefährdungen und Probleme behandelt, die etablierte Sicherheitsvorstellungen in Frage stellen und die bestehende Gesellschaftsordnung erschüttern können. Schließlich wird die Transformation von früher unabwendbaren Risiken (Pest, Hunger) hin zu kalkulierbaren, von Menschen verursachten Risiken untersucht, einschließlich individueller Risiken wie Unfälle, Krankheit, Armut und sozialer Unsicherheit, die zur Entwicklung von Sozialversicherungssystemen geführt haben. Die zunehmende Entscheidbarkeit von Lebensbereichen wie Familienplanung, Berufswahl und Mobilität wird als Chance und Risiko zugleich betrachtet.
Die reflexive Modernisierung: (Kapitelzusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierten Informationen zu diesem Kapitel enthält)
Globalisierung: (Kapitelzusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierten Informationen zu diesem Kapitel enthält)
Rezeption und Kritik: (Kapitelzusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierten Informationen zu diesem Kapitel enthält)
Sport als Spiegel der Risikogesellschaft: (Kapitelzusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierten Informationen zu diesem Kapitel enthält)
Schlüsselwörter
Risikogesellschaft, Ulrich Beck, Reflexive Modernisierung, Individualisierung, Globalisierung, Risikoverteilung, Risikoproduktion, Industriegesellschaft, soziale Sicherheit, Modernisierung, Rationalisierung, technischer Fortschritt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Theorie der Risikogesellschaft"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht Ulrich Becks Theorie der Risikogesellschaft. Das Ziel ist die Präsentation der zentralen Konzepte und Argumente Becks und die Beleuchtung deren Relevanz. Analysiert werden die Struktur der Risikogesellschaft, ihre Ursachen und Folgen sowie die Rolle von Individualisierung und Globalisierung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Charakteristika der Risikogesellschaft, die drei Säulen der Risikogesellschaft und deren Interdependenzen, die reflexive Modernisierung und ihre Auswirkungen, die Rolle der Globalisierung im Kontext der Risikogesellschaft und die Kritik und Rezeption der Risikogesellschaftstheorie. Zusätzlich wird der Sport als Spiegel der Risikogesellschaft betrachtet (obwohl die Zusammenfassung zu diesem Kapitel im vorliegenden Text fehlt).
Was sind die drei Säulen der Risikogesellschaft nach Beck?
Die drei Säulen, die im Detail im dritten Kapitel erläutert werden, umfassen das Verhältnis der Gesellschaft zu den Ressourcen von Natur und Kultur (durch Industrialisierung minimiert), die von der Gesellschaft erzeugten Gefährdungen und Probleme, die etablierte Sicherheitsvorstellungen in Frage stellen, und die Transformation von früher unabwendbaren Risiken hin zu kalkulierbaren, menschengemachten Risiken (inklusive individueller Risiken wie Unfälle, Krankheit etc.). Die zunehmende Entscheidbarkeit von Lebensbereichen wird als Chance und Risiko zugleich gesehen.
Wie wird die "reflexive Modernisierung" im Kontext der Risikogesellschaft behandelt?
Eine detaillierte Zusammenfassung zum Kapitel "Reflexive Modernisierung" fehlt im bereitgestellten Text. Weitere Informationen sind daher nicht verfügbar.
Welche Rolle spielt die Globalisierung in Becks Theorie?
Eine detaillierte Zusammenfassung zum Kapitel "Globalisierung" fehlt im bereitgestellten Text. Weitere Informationen sind daher nicht verfügbar.
Wie wird die Rezeption und Kritik der Risikogesellschaftstheorie behandelt?
Eine detaillierte Zusammenfassung zum Kapitel "Rezeption und Kritik" fehlt im bereitgestellten Text. Weitere Informationen sind daher nicht verfügbar.
Wie wird der Sport in die Analyse der Risikogesellschaft eingebunden?
Eine detaillierte Zusammenfassung zum Kapitel "Sport als Spiegel der Risikogesellschaft" fehlt im bereitgestellten Text. Weitere Informationen sind daher nicht verfügbar.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Risikogesellschaft, Ulrich Beck, Reflexive Modernisierung, Individualisierung, Globalisierung, Risikoverteilung, Risikoproduktion, Industriegesellschaft, soziale Sicherheit, Modernisierung, Rationalisierung, technischer Fortschritt.
Wie vergleicht Beck seine Theorie mit anderen sozialwissenschaftlichen Ansätzen?
Das zweite Kapitel vergleicht Becks Risikogesellschaftstheorie mit anderen sozialwissenschaftlichen Ansätzen zur Erklärung der postindustriellen oder postmodernen Gesellschaft. Es hebt die ambivalente Natur der Risikogesellschaft hervor: kontinuierliche Modernisierung, Rationalisierung und technischer Fortschritt gehen mit der Gefährdung bestehender gesellschaftlicher Grundlagen einher. Im Mittelpunkt steht die Verschiebung von der Verteilung materieller Güter hin zur Problematik der Risikozurechnung und -verteilung.
Wie wird der Umgang mit Risiken in der Risikogesellschaft dargestellt?
Das erste Kapitel führt in die Problematik des Umgangs mit Risiken ein und verdeutlicht die wachsende Unsicherheit in modernen Gesellschaften. Es betont die Verknüpfung von Handlungs- und Strukturaspekten in Becks Theorie und positioniert Becks Werk als zentralen Beitrag zur soziologischen Debatte um die Herausforderungen industrieller Fortschritte und deren Einfluss auf bestehende Kontroll- und Sicherungsmechanismen.
- Quote paper
- Marlen Frömmel (Author), 2004, Ein Einblick in soziologische Theorieansätze - Ulrich Beck: "Die Risikogesellschaft", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/89083