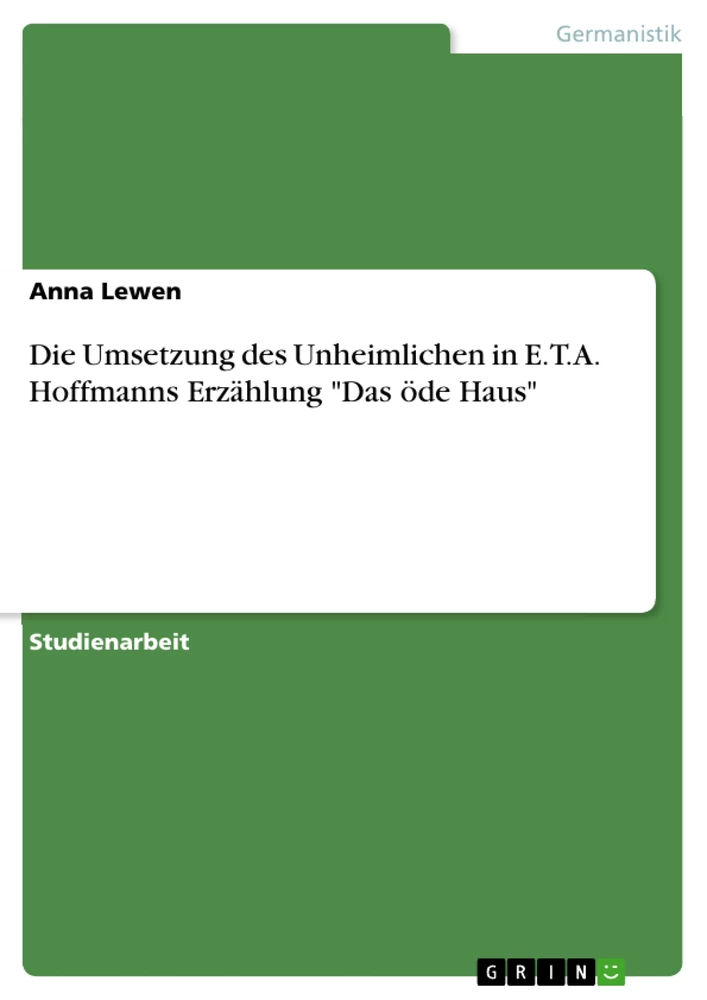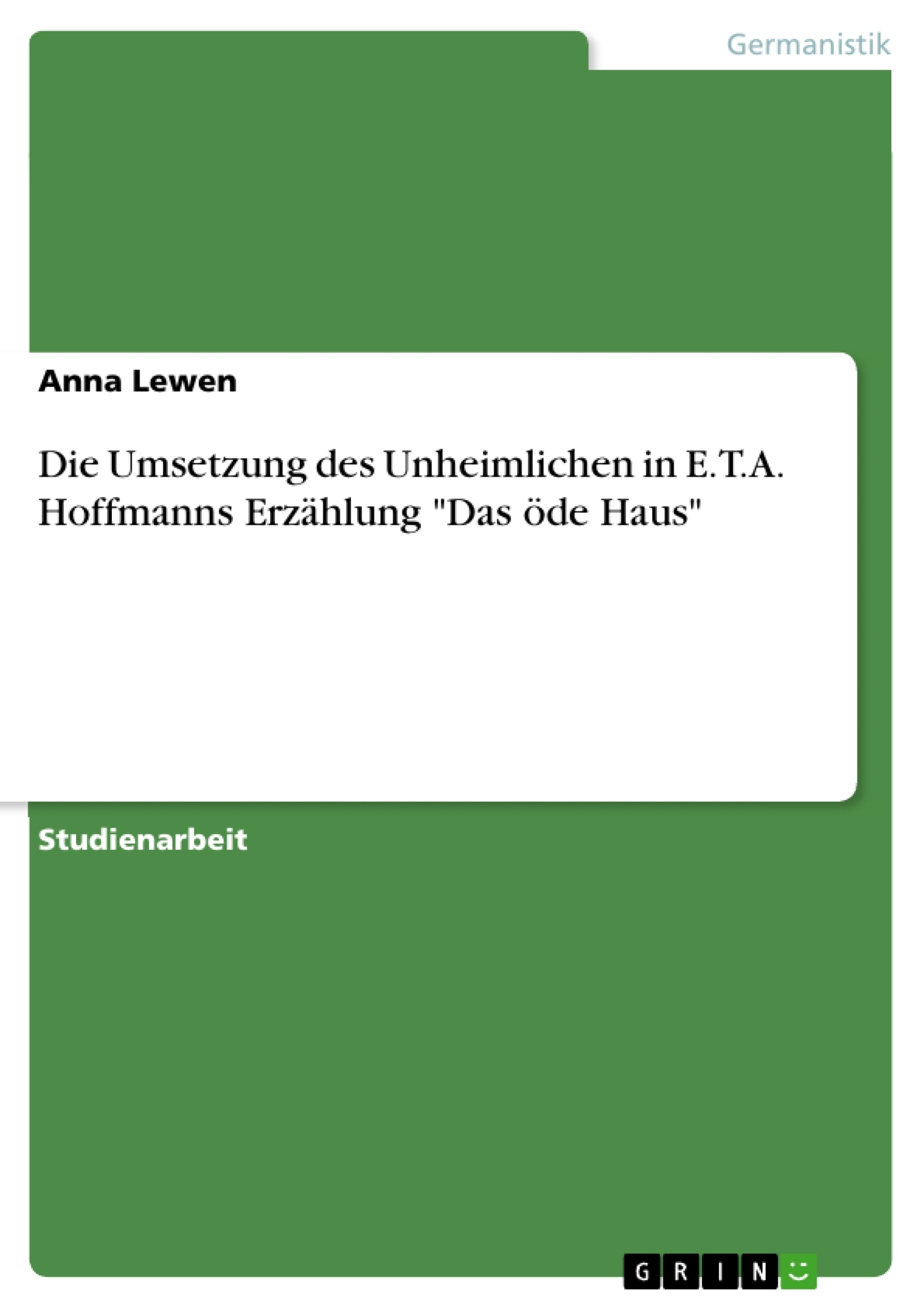In der folgenden Arbeit wird tiefergehend betrachtet, wie genau Hoffmann aus dem Grundgerüst einer widerspruchsfreien und kausalen Geschichte eine gegensätzliche erschafft, die den Lesenden ein Gefühl von Unsicherheit gibt und die einem unheimlich werden lässt. Um beantworten zu können wie Hoffmann das Unheimliche in der Erzählung "Das öde Haus" umsetzt, werden die Erzählsituation sowie ihre Struktur, eine Auswahl der verwendeten Motive und die sprachliche Gestaltung genauer analysiert.
Ein Mann, der auf seiner Reise in eine fremde Stadt durch die Straßen flaniert und von einem nicht in die Szenerie passendem Haus fasziniert ist, der eines Tages eine Frauengestalt erblickt und daraufhin zu jeder Tages- und Nachtzeit zu dem verlassenen Haus eilt, versucht die Geschichte dahinter zu ergründen und die Bewohnerin des Hauses, die er seitdem nicht mehr aus dem Kopf bekommt, zu erblicken.
Ein verrückter Voyeur? Ein Stalker? Wenn man eine solche Geschichte hört, sind diese beiden Gedanken mit Sicherheit eine der ersten, die einem dabei in den Sinn kommen.
Die Erzählung Das öde Haus, welche von E.T.A. Hoffmann im Jahre 1817 veröffentlicht wurde, handelt genau von solch einer beschriebenen Situation. Doch warum liest man diese Erzählung dann nicht mit dieser Interpretation? Warum wurde Hoffmann von Heinrich Heine zu einem „Gespenster Hoffmann“ stilisiert1, wenn der Inhalt seiner Erzählung doch eigentlich so schlüssig ist? Warum liest man sie letztendlich als eine unheimliche Schauergeschichte, die einen das Fürchten lehrt?
Ein Grund dafür ist die Darstellung des Sachverhaltes, den Hoffmann anders als die obige sehr pragmatisch und logisch dargestellte Situation, in eine phantastische Welt einbettet „[...], die nicht mehr von einer auf Kausalität, Kohärenz und Widerspruchsfreiheit pochenden Darstellungslogik regiert wird.“. Es ist den Rezipienten also nicht mehr möglich klar und deutlich zu unterscheiden, was genau in der Erzählung der Wahrheit und Realität entspricht und was nicht. Einige Begebenheiten und Geschehnisse sind mit dem gesunden Menschenverstand und der eigenen Erfahrung nicht zu erklären und bleiben als Rätsel bestehen, die nicht aufzulösen sind. Diese Unauflösbarkeit und die damit verbundene Unaufklärbarkeit der Geschehnisse führen letztendlich dazu, die Geschichte als unheimlich oder gruselig zu bezeichnen und den Autoren Hoffmann, wie Heinrich Heine bemerkte, zu einem „Gespenster Hoffmann“ zu popularisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erzählsituation in Das öde Haus
- Erzählweise und Erzählstruktur Theodors
- Sprachliche Gestaltung in Das öde Haus
- Motivik
- Vokabular
- Sinneswahrnehmungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie E.T.A. Hoffmann in seiner Erzählung „Das öde Haus“ eine Atmosphäre des Unheimlichen erzeugt. Die Analyse konzentriert sich auf die Erzähltechnik, die sprachliche Gestaltung und die Konstruktion der Erzählfigur Theodor.
- Analyse der Erzählsituation und ihrer Wirkung auf den Leser
- Untersuchung der Erzählweise und -struktur, insbesondere der Rolle des unzuverlässigen Erzählers Theodor
- Bedeutung der sprachlichen Mittel (Motive, Vokabular, Sinneswahrnehmungen) für die Schaffung einer unheimlichen Atmosphäre
- Zusammenspiel von Realität und Phantastik in der Erzählung
- Die Ambivalenz zwischen Tatsachenbericht und Abenteuergeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Unheimlichen in E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Das öde Haus“ ein. Sie stellt die Frage, warum die Geschichte als unheimlich empfunden wird, obwohl der Plot an sich logisch nachvollziehbar wäre. Es wird auf die Einbettung des Sachverhalts in eine phantastische Welt hingewiesen, die die klare Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion erschwert und somit das Gefühl des Unheimlichen erzeugt. Die Arbeit kündigt die Analyse der Erzählsituation, der Erzählstruktur, der Motive und der sprachlichen Gestaltung an, um die Entstehung des Unheimlichen in der Erzählung zu beleuchten.
Erzählsituation in Das öde Haus: Dieses Kapitel beschreibt die Erzählsituation in „Das öde Haus“. Die Erzählung beginnt im Rahmen einer Rahmenhandlung, in der Theodor seinen Freunden von seinen Erlebnissen in einer Residenzstadt berichtet. Die Erzählung wechselt somit zwischen der Rahmenhandlung und der Binnenerzählung, wobei Theodors Bericht durch Kommentare und Interaktionen mit seinen Freunden unterbrochen wird. Diese Struktur trägt zur Ambivalenz der Erzählung bei, da der Leser nicht immer sicher sein kann, was genau passiert ist.
Erzählweise und Erzählstruktur Theodors: Dieses Kapitel analysiert die Erzählweise und -struktur aus der Perspektive Theodors. Seine Erzählung ähnelt einem Tatsachenbericht, aber es fehlt eine bestätigende Instanz, was zu einer Unsicherheit bezüglich seiner Glaubwürdigkeit führt. Die Bezeichnung seiner Erlebnisse als „Abenteuer“ unterstreicht den Widerspruch zwischen Tatsachenbericht und fiktiver Darstellung und verstärkt den Eindruck eines unzuverlässigen Erzählers. Die Kommentare der Freunde, die Theodors Erzählungen teilweise anzweifeln, unterstützen diese Interpretation. Theodors selbstkritische Reflexionen und die mögliche Infragestellung seiner Wahrnehmungen aufgrund früherer Traumata tragen zusätzlich zur Konstruktion des unzuverlässigen Erzählers bei, welcher durch Divergenzen zwischen Selbst- und Fremdcharakterisierung geprägt ist.
Sprachliche Gestaltung in Das öde Haus: Dieses Kapitel, obwohl in Unterkapitel unterteilt, wird hier als Ganzes zusammengefasst. Die sprachliche Gestaltung spielt eine entscheidende Rolle bei der Konstruktion des Unheimlichen. Die Analyse umfasst die Motivik, das Vokabular und die Schilderung von Sinneswahrnehmungen. Diese Elemente wirken zusammen und tragen dazu bei, eine Atmosphäre der Ungewissheit und des Unbehagens zu schaffen, welche die Grenze zwischen Realität und Phantastik verschwimmen lässt und den Leser in die unheimliche Welt der Erzählung eintauchen lässt. Details hierzu sind aufgrund des Auszuges nicht ausführlich darstellbar.
Schlüsselwörter
E.T.A. Hoffmann, Das öde Haus, Unheimliches, Erzähltechnik, Erzählsituation, unzuverlässiger Erzähler, Sprachliche Gestaltung, Motivik, Atmosphäre, Realität und Phantastik, Ambivalenz.
Häufig gestellte Fragen zu E.T.A. Hoffmanns "Das öde Haus"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert E.T.A. Hoffmanns Erzählung "Das öde Haus" und untersucht, wie der Autor eine Atmosphäre des Unheimlichen erzeugt. Der Fokus liegt auf der Erzähltechnik, der sprachlichen Gestaltung und der Konstruktion der Erzählfigur Theodor.
Welche Aspekte der Erzählung werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Erzählsituation und ihre Wirkung auf den Leser, die Erzählweise und -struktur (insbesondere die Rolle des unzuverlässigen Erzählers Theodor), die Bedeutung sprachlicher Mittel (Motive, Vokabular, Sinneswahrnehmungen) für die Schaffung einer unheimlichen Atmosphäre, das Zusammenspiel von Realität und Phantastik und die Ambivalenz zwischen Tatsachenbericht und Abenteuergeschichte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Erzählsituation, zur Erzählweise und -struktur Theodors, zur sprachlichen Gestaltung (Motivik, Vokabular, Sinneswahrnehmungen) und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der relevanten Aspekte.
Wie wird die Erzählsituation in "Das öde Haus" beschrieben?
Die Erzählsituation ist durch eine Rahmenhandlung gekennzeichnet, in der Theodor seinen Freunden von seinen Erlebnissen berichtet. Es wechselt zwischen Rahmenhandlung und Binnenerzählung, was zur Ambivalenz beiträgt, da der Leser nicht immer sicher sein kann, was genau passiert ist.
Welche Rolle spielt Theodor als Erzähler?
Theodor fungiert als unzuverlässiger Erzähler. Seine Erzählung ähnelt einem Tatsachenbericht, mangelt aber an bestätigender Instanz, wodurch seine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wird. Die Kommentare seiner Freunde und seine selbstkritischen Reflexionen verstärken diesen Eindruck. Divergenzen zwischen Selbst- und Fremdcharakterisierung prägen seine Figur.
Welche Bedeutung hat die sprachliche Gestaltung?
Die sprachliche Gestaltung, einschließlich Motivik, Vokabular und Sinneswahrnehmungen, ist entscheidend für die Schaffung der unheimlichen Atmosphäre. Diese Elemente verschwimmen die Grenze zwischen Realität und Phantastik und lassen den Leser in die unheimliche Welt der Erzählung eintauchen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: E.T.A. Hoffmann, Das öde Haus, Unheimliches, Erzähltechnik, Erzählsituation, unzuverlässiger Erzähler, Sprachliche Gestaltung, Motivik, Atmosphäre, Realität und Phantastik, Ambivalenz.
Was ist das zentrale Thema der Einleitung?
Die Einleitung führt in die Thematik des Unheimlichen in "Das öde Haus" ein und stellt die Frage nach der Entstehung des Unheimlichen trotz eines logisch nachvollziehbaren Plots. Sie kündigt die Analyse der Erzählsituation, der Erzählstruktur, der Motive und der sprachlichen Gestaltung an.
Wie wird das Fazit dargestellt?
Ein zusammenfassendes Fazit wird im vorliegenden Auszug nicht explizit dargestellt, ist aber implizit in den Kapitelzusammenfassungen enthalten.
- Quote paper
- Anna Lewen (Author), 2020, Die Umsetzung des Unheimlichen in E.T.A. Hoffmanns Erzählung "Das öde Haus", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/889402