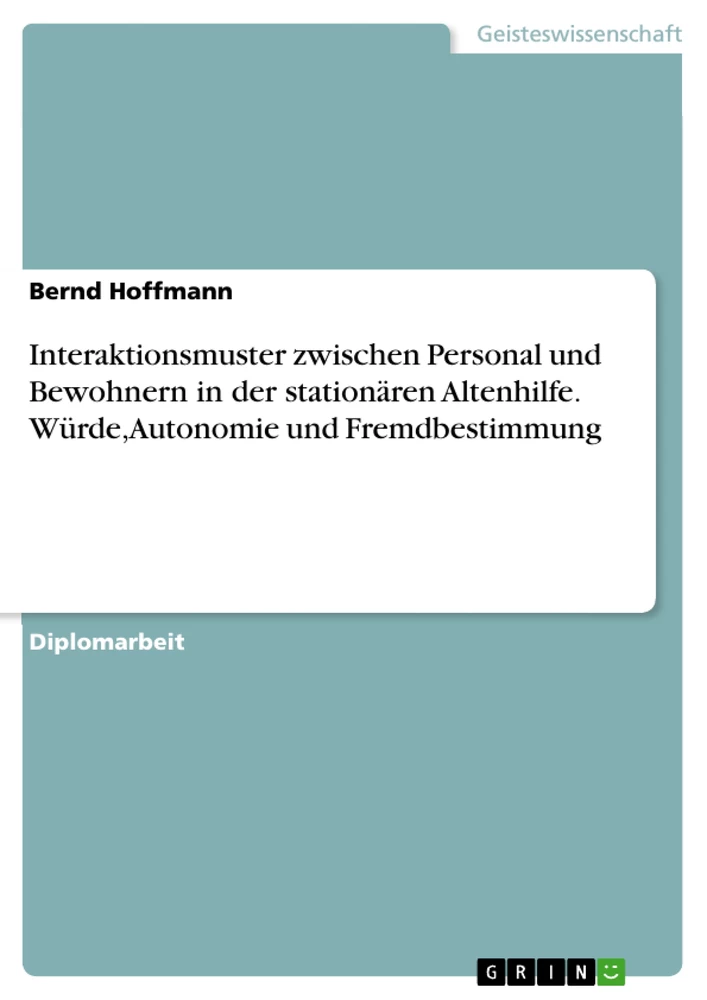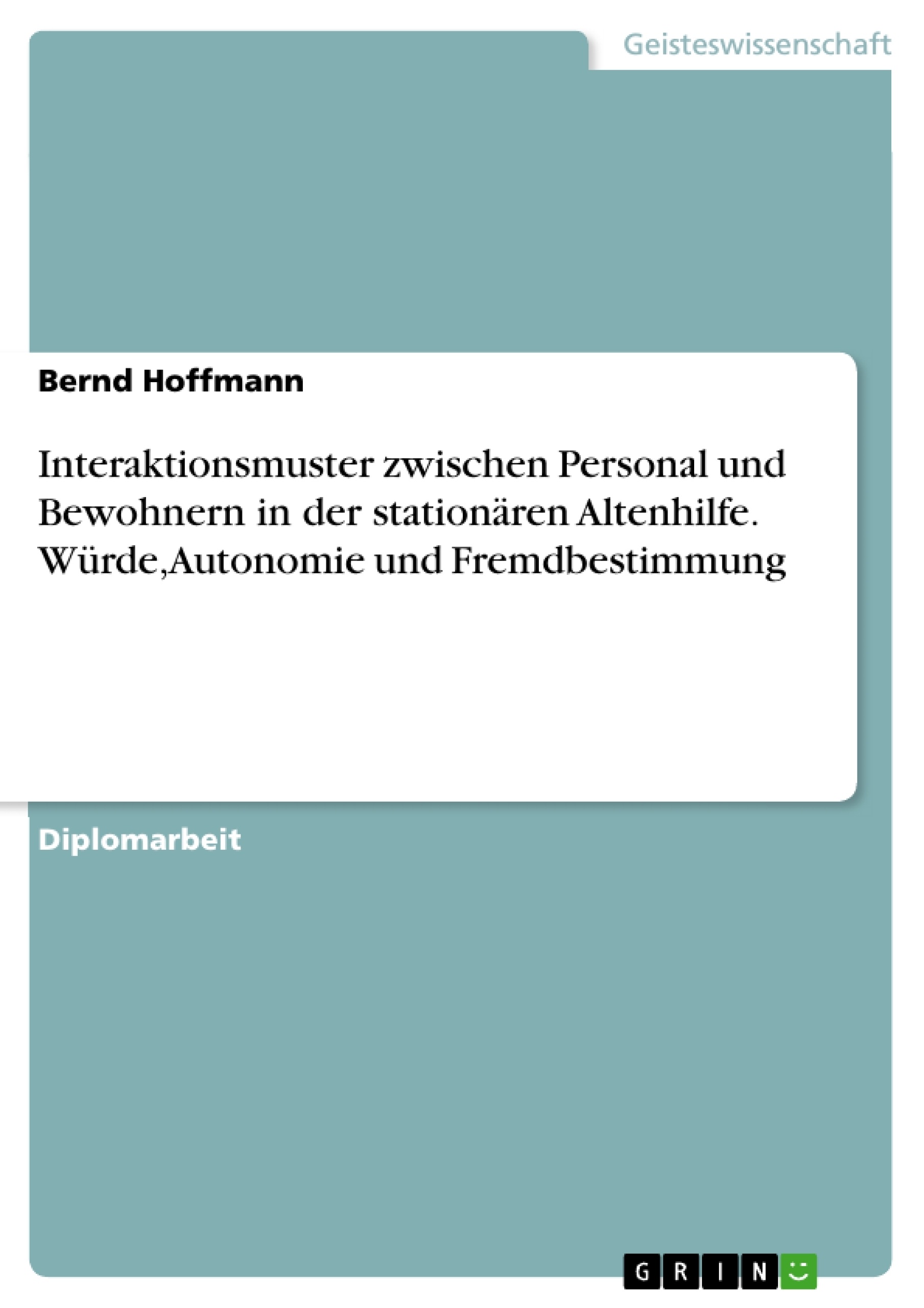Diese Arbeit folgt einem Ziel: den Bewohnern im Rahmen der Veränderungen im Altenhilfesektor zu mehr Autonomie und damit auch zu einem "Altern in Würde" zu verhelfen.
Der Autor kann sich auf umfangreiche Praxiserfahrungen aus der Altenpflege stützen, in dessen Kontext er ausgiebig Feldforschung betreiben konnte.
Zu den Inhalten:
Im ersten Teil der Arbeit gibt der Autor Hintergrundinformationen zu dem Altenpflegeheim, auf welches seine Praxiserfahrungen sich im Folgenden beziehen.
- Der zweite Teil widmet sich Stereotypen. Neben allgemeinen Erklärungen und Ausführungen, warum Menschen zu Stereotypisierungen neigen, werden Praxiserfahrungen angeführt und Anregungen gegeben, um stereotyp-konformes Verhalten zu vermeiden.
- anschließend wird verbale und nonverbale Kommunikation behandelt. Zunächst wird ein umfassender Überblick vermittelt, bevor der Autor ausführlich auf Praxiserfahrungen eingeht und abschließend Verbesserungsmöglichkeiten des Kommunikationsverhaltens aufzeigt.
- Die Gedanken zu „Abhängigkeit und Unabhängigkeit“ widmen sich der Beschreibung von dem „Abhängigkeits-Unterstützungs-Muster (dependency-support script)“ und „Unabhängigkeits-Ignoranz-Muster (independency-ignorance script)“ (nach Baltes). Aufbauend auf dem Wissen der zuvor niedergelegten Inhalte wird der Frage nachgegangen, wie stark Autonomie und Selbständigkeit im institutionellen Kontext überhaupt gefördert wird. Spezielle Trainingsprogramme und Verbesserungsansätze für das Personal, die bei ungünstigem Interaktionsverhalten intervenierend verwendet werden können, runden die Ausführungen ab.
- „Würde, Autonomie und Fremdbestimmung“ im Kontext der stationären Altenhilfeeinrichtung wird in einem gesonderten Gliederungspunkt abgehandelt. Hierbei weist der Autor auf diverse „Eigentümlichkeiten“ im Pflegealltag hin, die zum Nachdenken anregen sollen.
- Schließlich wird am Ende der Arbeit im „Schlusswort“ eine Bilanzierung vorgenommen und der Blick auf die Zukunft der stationären Altenhilfe gerichtet.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vorwort
- II. Informationen bezüglich der Einrichtung
- 1. Strukturelle Informationen
- 2. Leitbild des Hauses
- 2.1 Wunsch
- 2.2...und Wirklichkeit...
- 3. Anzahl der Mitarbeiter: Tabellarischer Überblick
- 4. Der Wohnbereich
- 4.1 Bewohner- und Mitarbeiterstruktur
- 4.2 Dienstzeiten
- 4.3 Tagesablauf
- III. Stereotype und Stereotypisierungen
- 1. Allgemeines
- 1.1 Was versteht man unter Stereotypen ?
- 1.2 Warum neigen Menschen zu Stereotypisierungen?
- 1.3 Möglichkeiten der Selbstkontrolle
- 2. Altersstereotype
- 2.1 Stereotypgeleitete Bilder und Realität...
- 2.2 Altersstereotype in der (Alten-)Pflege
- 2.3 Korrelation mit der Berufserfahrung
- 2.4 Praxiseindrücke
- 3. Anregungen zur Vermeidung von stereotypkonformen Verhaltensweisen
- 1. Allgemeines
- IV. Kommunikationsformen im Pflegealltag
- 1. Verbale Kommunikation
- 1.1 Vorbemerkungen zur verbalen Kommunikation im Pflegealltag
- 1.2,,Kommunikationsdürre“ – Strukturell bedingt oder Angst vor dem eigenen Alter?
- 1.2.1 Zeitliche Ressourcen
- 1.2.2 Gründe der individuellen Gesprächsvermeidung
- 1.3 Babysprache
- 1.3.1 Überblick
- 1.3.2 Häufigkeit der Anwendung im stationären Alltag / Praxiseindrücke
- 1.4 Risiken & Verbesserungsmöglichkeiten der verbalen Kommunikation
- 2. Nonverbale Kommunikation
- 2.1 Einleitende Bemerkungen zur nonverbalen Kommunikation
- 2.2 Elemente der nonverbalen Kommunikation
- 2.3 Nonverbale Kommunikation im Pflegealltag
- 2.4 Häufigkeit der Anwendung im stationären Alltag / Praxiseindrücke
- 2.5 Verbesserungsmöglichkeiten der nonverbalen Kommunikation
- 1. Verbale Kommunikation
- V. Abhängigkeit und Unabhängigkeit
- 1. Gewinne und Verluste im Alter
- 2. Abhängigkeits-Unterstützungs-Muster / Unabhängigkeits-Ignoranz-Muster
- 2.1 Was versteht man darunter?
- 2.2 Auferlegte und selbsterwählte Abhängigkeit
- 3. Praxiserfahrungen - Probleme des institutionellen Rahmens
- 4. Interventionsmöglichkeiten
- 4.1 Trainingsprogramm im Rahmen von Verhaltensmodifikation
- (nach Baltes, Zank, Neumann, Tzschätzsch)
- Überblick über die Unterrichtseinheiten
- I. Unselbständigkeit im Alter
- II. Lernmöglichkeiten im Alter
- III. Verhaltensmodifikation (VM): Theorie und Praxis
- IV. Planung der Verhaltensmodifikation
- V. Intervention
- VI. Auswertung
- 4.2 Weitere Trainings- bzw. Fortbildungsprogramme
- 4.1 Trainingsprogramm im Rahmen von Verhaltensmodifikation
- VI. Würde, Autonomie und Fremdbestimmung
- 1.,,My home is my castle“
- 2. Geschlechtsspezifische Pflege
- 3. Körperpflege
- 4. Bekleidung
- 5. Weckzeiten
- 6. Ernährung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Interaktionsmuster zwischen Personal und Bewohnern in der stationären Altenhilfe. Das Ziel ist es, die Herausforderungen und Potenziale der Kommunikation zwischen beiden Gruppen zu analysieren und Handlungsempfehlungen für eine gelingende und wertschätzende Interaktion zu entwickeln.
- Stereotypen und Stereotypisierungen in der Altenpflege
- Kommunikationsformen im Pflegealltag: Verbale und nonverbale Kommunikation
- Abhängigkeits- und Unabhängigkeitsmuster im Kontext der stationären Altenhilfe
- Würde, Autonomie und Fremdbestimmung von Bewohnern in Pflegeeinrichtungen
- Handlungsempfehlungen für eine wertschätzende und gelingende Interaktion zwischen Personal und Bewohnern
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel beleuchtet die institutionellen Rahmenbedingungen der Einrichtung. Es werden strukturelle Informationen, das Leitbild des Hauses sowie die Anzahl der Mitarbeiter und deren Einsatzbereiche dargestellt. Der Wohnbereich wird hinsichtlich der Bewohner- und Mitarbeiterstruktur, Dienstzeiten und des Tagesablaufs beschrieben.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit Stereotypen und Stereotypisierungen. Hier werden die Definition und die Gründe für Stereotypisierungen erläutert. Besonderes Augenmerk wird auf Altersstereotype in der Pflege gelegt. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, wie stereotype Bilder im Vergleich zur Realität, die Auswirkungen von Altersstereotypen auf die Pflege und die Korrelation mit der Berufserfahrung.
Das vierte Kapitel befasst sich mit verschiedenen Kommunikationsformen im Pflegealltag. Es werden sowohl verbale als auch nonverbale Kommunikationsformen untersucht. Die Kapitel analysieren die Herausforderungen der verbalen Kommunikation, wie die Entstehung von „Kommunikationsdürre“ und die Risiken und Verbesserungsmöglichkeiten der verbalen Kommunikation.
Das fünfte Kapitel widmet sich dem Thema Abhängigkeit und Unabhängigkeit im Alter. Es werden Gewinne und Verluste im Alter sowie das Abhängigkeits-Unterstützungs-Muster und das Unabhängigkeits-Ignoranz-Muster beschrieben. Dieses Kapitel analysiert auch die Probleme, die sich aus dem institutionellen Rahmen ergeben und bietet verschiedene Interventionsmöglichkeiten an, um die Unabhängigkeit von Bewohnern zu fördern.
Das sechste Kapitel thematisiert Würde, Autonomie und Fremdbestimmung von Bewohnern in Pflegeeinrichtungen. Es werden verschiedene Aspekte wie die Bedeutung von Privatsphäre, geschlechtsspezifische Pflege, Körperpflege, Bekleidung, Weckzeiten und Ernährung behandelt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Diplomarbeit sind die Interaktion zwischen Personal und Bewohnern in der stationären Altenhilfe, Stereotypen und Stereotypisierungen im Kontext der Pflege, Kommunikationsformen im Pflegealltag, Abhängigkeits- und Unabhängigkeitsmuster im Alter, Würde, Autonomie und Fremdbestimmung von Bewohnern sowie Handlungsempfehlungen für eine gelingende Interaktion.
- Quote paper
- Dipl.-Sozialpädagoge Bernd Hoffmann (Author), 2004, Interaktionsmuster zwischen Personal und Bewohnern in der stationären Altenhilfe. Würde, Autonomie und Fremdbestimmung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/88570