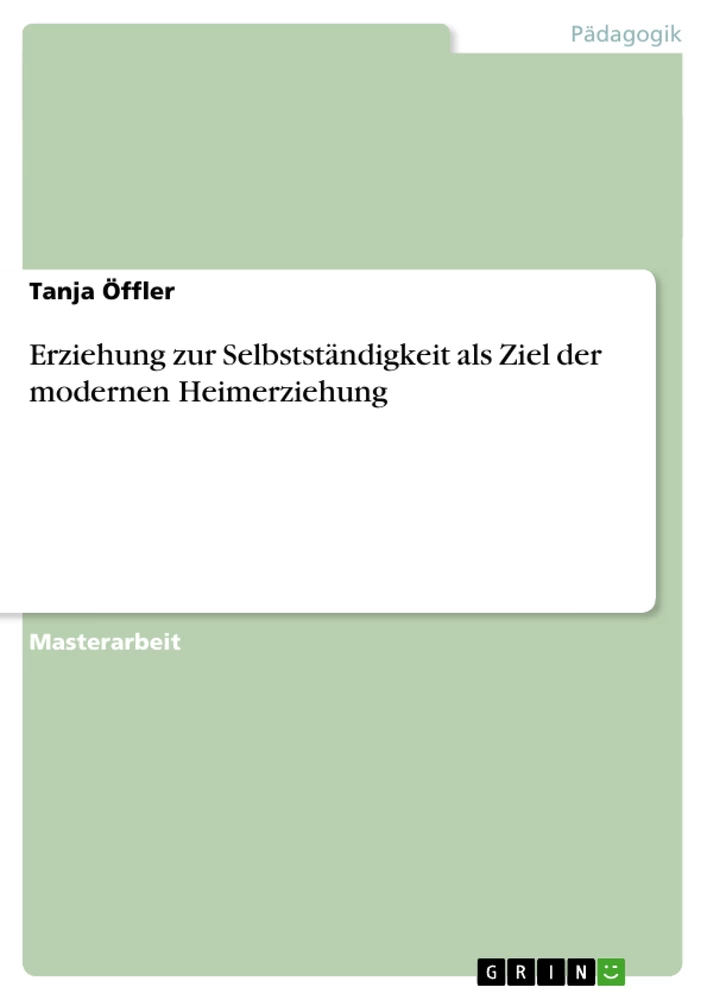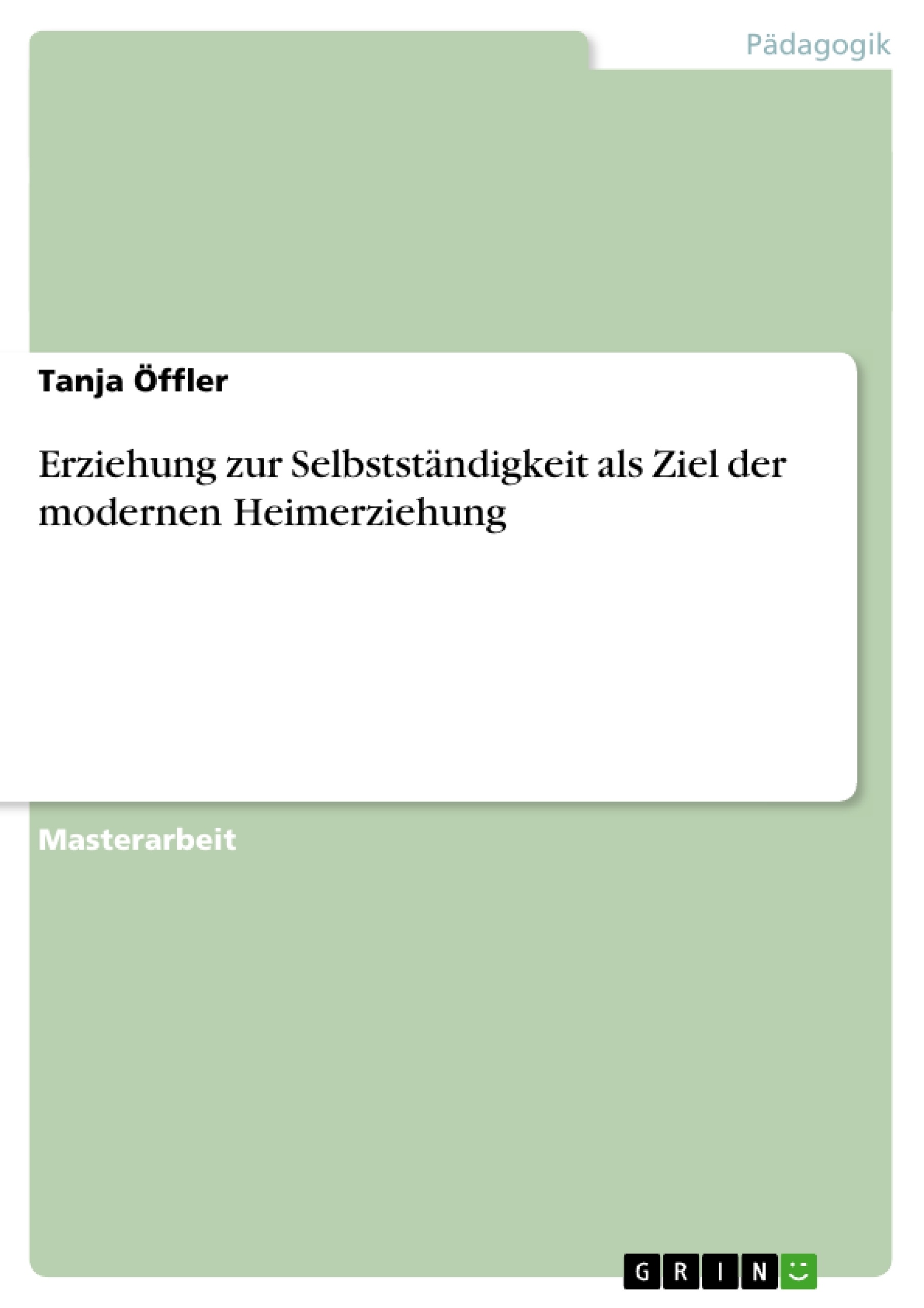„Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“
Nicht erst seit der Aufklärung und Kant ist es das Ziel der Erziehung, den Menschen aus seiner ‚selbstverschuldeten Unmündigkeit’ zu führen. Menschliches Denken hat seit den Anfängen der griechischen Philosophie daran festgehalten, dass zu einem menschlichen Leben Freiheit und Selbstständigkeit dazugehören.
Von Rousseau über Pestalozzi und Schleiermacher zeichnete sich ein Bedeutungszuwachs der Selbstständigkeit innerhalb der Pädagogik ab. Selbstständigkeit ist damit ein erstrebenswertes Erziehungsziel und wird heute immer mehr erkannt und gefordert.Was für ein Kind als selbstständig oder unselbstständig gilt, wird stark von den Erwartungen der Gesellschaft beeinflusst. Diese Erwartungen werden bei jüngeren Kindern überwiegend von seinen Bezugspersonen transportiert. Im Verlauf seines Aufwachsens kommen jedoch auch andere Vermittler hinzu, wie beispielsweise Gleichaltrige, Lehrer oder gar fremde Menschen auf der Strasse. In der Auseinandersetzung mit diesen Erwartungen erweist sich das Kind dann als relativ selbstständig oder nicht. Die Selbstständigkeit eines Kindes wird damit in der Bewältigung der aktuellen Anforderungen deutlich, wenn es das, was andere Kinder seines Alters selbstständig tun können, auch kann.
Selbstständig werden muss jedoch nicht immer zwangsläufig gelingen. Es kann durchaus sein, dass manche Kinder und Jugendliche nicht oder erst sehr spät selbstständig werden, da sie aufgrund massiver Probleme und Konflikte innerhalb ihrer Familie schlechtere Startchancen für den Weg in ein eigenverantwortliches Leben haben. Die Trennung von einem vielleicht gewalttätigen und vernachlässigenden Elternhaus stellt damit für viele junge Menschen eine notwendige Bedingung dar, um unter günstigeren Bedingungen aufzuwachsen, frühe Traumatisierungen zu verarbeiten und die Behinderungen in der Persönlichkeitsentwicklung zu korrigieren.
Der Weg in ein selbstständiges und eigenverantwortliches Leben ist für diese jungen Menschen jedoch meist lang und schwer. Der Rückhalt und die Unterstützung aus der Herkunftsfamilie sind, in den meisten Fällen, mehr als gering. Die Jugendlichen sind an vielen Punkten völlig auf sich alleine gestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Allgemeinen Verständnis – Institution Heim
- 2.1 Definition von Heimerziehung
- 2.2 Entwicklungen der Heimerziehung in ihrem historischen Kontext
- 2.2.1 Kinder- und Jugendfürsorge in der Epoche des Mittelalters
- 2.2.2 Armenkinderpflege zu Beginn der Neuzeit
- 2.2.3 Kinder- und Jugendfürsorge unter dem Einfluss von Pietismus und Aufklärung
- 2.2.4 Die Entwicklung der privatorganisierten Anstaltserziehung im 19. Jahrhundert
- 2.2.5 Die Anfänge der öffentlichen Jugendfürsorge im 19. Jahrhundert - Rechtsentwicklung
- 2.2.6 Die Einführung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes (RJWG)
- 2.2.7 Die Fürsorgeerziehung zur Zeit des Nationalsozialismus
- 2.2.8 Heimerziehung nach 1945
- 2.2.9 Die „Heimkampagne“
- 2.2.10 Reformen und ihre Auswirkungen
- 2.2.11 Zusammenfassung
- 2.3 Der neue gesetzliche Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
- 2.3.1 Hilfen zur Erziehung
- 2.3.2 Der Hilfeplan
- 3. Selbstständigkeitserziehung - Vom Fremdzwang zum Selbstzwang
- 3.1 Begriffsabgrenzung
- 3.1.1 Was ist Erziehung?
- 3.1.2 Was ist Selbstständigkeit?
- 3.2 Vom Fremdzwang zum Selbstzwang
- 3.3 Bindung als Voraussetzung für Selbstständigkeitsentwicklung
- 3.4 Die Ablösung vom Elternhaus
- 4. Erziehung zur Selbstständigkeit in der Heimerziehung
- 4.1 Beziehungen und Bindungen im Heim
- 4.1.1 Die Beziehungen zu den Erwachsenen im Heim
- 4.1.2 Das Beziehungsdreieck von Kind, Heim und Familie
- 4.1.3 Die Notwendigkeit von Elternarbeit zur Unterstützung des Ablösevorgangs
- 4.2 In welchem Spannungsfeld steht die Selbstständigkeitserziehung in der Heimerziehung?
- 4.2.1 Belastende Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen
- 4.2.2 Institutionsbedingte Erschwernisse
- 4.2.3 Erschwernisse durch rechtliche Rahmenbedingungen
- 4.3 Konsequenzen für die Einrichtung und ihre Mitarbeiter
- 4.3.1 Der Erzieher als Mittler zur Selbstständigkeit
- 4.3.2 Konsequenzen für die Heimerziehung
- 4.4 Der Beitrag zur Selbstständigkeitserziehung im betreuten Wohnen
- 5. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Erziehung zur Selbstständigkeit im Kontext der Heimerziehung. Sie beleuchtet die historischen Entwicklungen der Heimerziehung und analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten, die die Selbstständigkeitserziehung von Kindern und Jugendlichen in Heimen mit sich bringt. Ziel ist es, die Bedingungen zu identifizieren, die eine gelingende Selbstständigkeitserziehung im Heim ermöglichen.
- Historische Entwicklung der Heimerziehung
- Definition von Selbstständigkeit und deren Bedeutung in der Pädagogik
- Spezifische Herausforderungen der Selbstständigkeitserziehung in der Heimerziehung
- Die Rolle der Beziehungen und Bindungen in der Heimerziehung
- Der Beitrag von Elternarbeit und betreuten Wohnformen zur Selbstständigkeitserziehung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz der Selbstständigkeitserziehung im Kontext der Heimerziehung dar und führt das Thema der Arbeit ein.
- Kapitel 2: Zum Allgemeinen Verständnis – Institution Heim: Dieses Kapitel bietet eine Definition von Heimerziehung und beleuchtet die historischen Entwicklungen der Heimerziehung von der Antike bis zur Gegenwart. Dabei werden die Veränderungen im Verständnis der Heimerziehung und die rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt.
- Kapitel 3: Selbstständigkeitserziehung - Vom Fremdzwang zum Selbstzwang: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Selbstständigkeitserziehung. Es werden verschiedene Perspektiven auf Selbstständigkeit beleuchtet und die Bedeutung von Bindung und Ablösung für die Selbstständigkeitsentwicklung diskutiert.
- Kapitel 4: Erziehung zur Selbstständigkeit in der Heimerziehung: Dieses Kapitel untersucht die spezifischen Bedingungen und Herausforderungen der Selbstständigkeitserziehung in Heimen. Es betrachtet die Bedeutung von Beziehungen und Bindungen, die Belastungen und Erschwernisse für die Selbstständigkeitserziehung sowie die Rolle des Erziehers und die Möglichkeiten der Unterstützung durch Eltern und betreutes Wohnen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Heimerziehung, Selbstständigkeitserziehung, Bindung, Ablösung, Hilfen zur Erziehung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, institutionelle Rahmenbedingungen, Elternarbeit, betreutes Wohnen, Entwicklung, Pädagogik, Geschichte, Recht.
- Quote paper
- Tanja Öffler (Author), 2007, Erziehung zur Selbstständigkeit als Ziel der modernen Heimerziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/88333