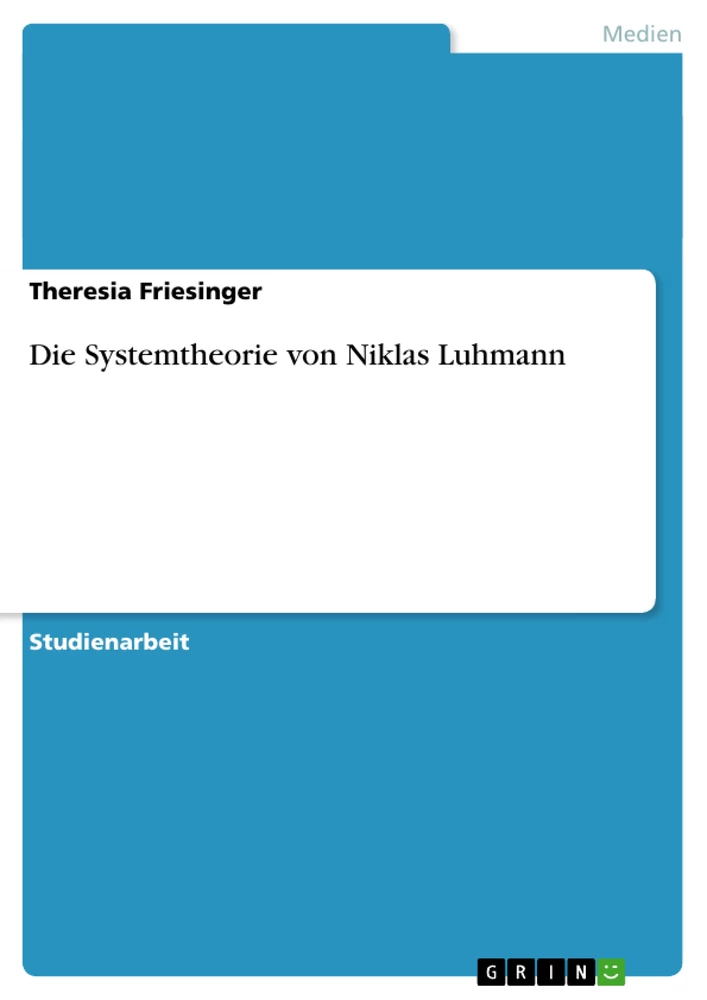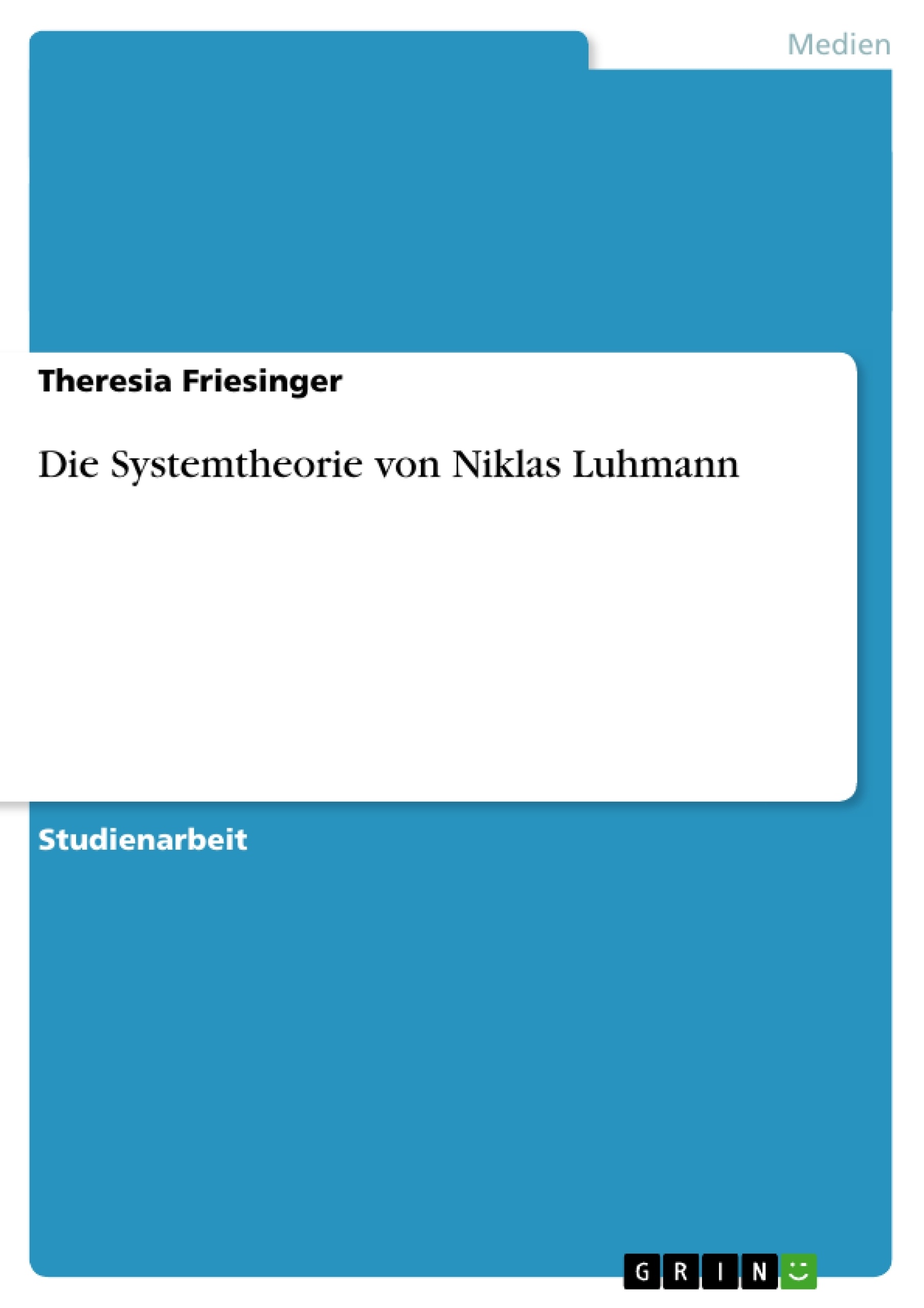Um das komplexe Feld „Soziale Arbeit“ transparent beschreiben zu können benötigen wir Theorien. Der Ursprung des Begriffes „Theorie“ stammt aus dem altgriechischen „theorein“ und bedeutet nichts anderes als „schauen“ bzw. noch genauer formuliert: „erschauen.“ Vereinfacht ausgedrückt machen Theorien Aussagen über die beobachtete Welt und sie geben gegebenenfalls auch Anleitung wie die Welt beobachtet werden kann, mit jeweils unterschiedlichen Perspektiven der Betrachtungweise, welche gerade die Vielfalt der Theorien begründen.
Es gibt viele sozialtheoretische Ansätze, die Soziale Arbeit wirklichkeitsnah beschreiben und erklären, jeweils mit unterschiedlichen Handlungsanweisungen und –alternativen, jedoch kann es keine kausal formulierte Theorie geben, die ganz konkrete Zuordnungen und Handlungsansätze für die in der Realität mannigfaltigen Situationen beschreibt. Trotzdem haben alle Theorien ihre Berechtigung, denn aufgrund der enormen Komplexität unserer Welt kann keine Theorie für sich den Anspruch erheben, die ganze Welt oder das ganze Feld der Sozialen Arbeit erfassen zu können. Am Beispiel der zum Teil diametral angelegten diversen Systemtheorien erkennt man den Versuch das Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit aus mannigfaltigen Winkeln zu betrachten. Es geht in den Erhebungen nicht um die Frage wer letztendlich Recht hat, sondern um den Zugewinn neuer Aspekte und Möglichkeiten des Agierens und des Handelns. Die in soziologischen Kreisen berühmte Luhmann/Habermas-Kontroverse (siehe Kap. 5.1) ist ein Beispiel dafür, wie unterschied-lich Thesen und Theorien ausfallen können. Beide Theorien sind Beobachtungstheorien, jedoch wird die Position des Menschen in der Gesellschaft unterschiedlich definiert und gehandhabt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2. Biografie und wie Luhmann die Welt sieht
- 2.1 Wer war Niklas Luhmann?
- 2.2 Luhmann und der „blinde Fleck“
- 2.3 Luhman und der Konstruktivismus
- 3 Die Systemtheorie von Niklas Luhmann
- 3.1 Was ist ein System nach Luhmann?
- 3.2 Wo bleibt bei Luhmann der Mensch?
- 3.3 Der Mensch fliegt aus der Gesellschaft raus
- 3.4 Die Autopoiesis
- 3.5 System/Umwelt-Differenz
- 3.6 Wer und was ist Umwelt?
- 3.7 Die Anpassung von System und Umwelt
- 3.8 Die Reduktion der Komplexität
- 3.9 Luhmann stellt die Kommunikation auf den Kopf!
- 4 Luhmann's Systemtheorie und die Soziale Arbeit
- 4.1 1st Soziale Arbeit ein Funktionssystem?
- 4.2 Was bedeutet Systemdenken konkret für die Soziale Arbeit?
- 4.3 Luhmann'sches Systemdenken anhand des nachfolgenden Beispiels von Schulsozialarbeit
- 4.4 Ist Luhmann für die Soziale Arbeit aktuell?
- 4.5 1st Luhmann für die Soziale Arbeit zu abstrakt?
- 4.6 Soziale Arbeit - Im Systemdenken von Luhmann nur unter Hilfe zur Selbsthilfe zu verstehen
- 4.7 Soziale Arbeit - Nach Luhmann: Beobachten, reflektieren, variieren
- 5 Kritik an Niklas Luhmann
- 5.1 Die Luhmann-Habermas-Kontroverse
- 5.2 Allgemeine Kritik an Niklas Luhmann
- 5.3 Persönliche Kritik an Luhmann
- 5.4 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit hat zum Ziel, die Systemtheorie von Niklas Luhmann im Kontext der Sozialen Arbeit zu erörtern und zu analysieren, insbesondere am Beispiel der Schulsozialarbeit. Sie soll die zentralen Konzepte der Luhmannschen Theorie verständlich machen und deren Relevanz für die Praxis der Sozialen Arbeit aufzeigen.
- Die Biografie von Niklas Luhmann und die Entstehung seiner Systemtheorie
- Die zentralen Konzepte der Systemtheorie, wie Autopoiesis, System/Umwelt-Differenz und die Reduktion von Komplexität
- Die Anwendung der Systemtheorie auf die Soziale Arbeit, insbesondere auf die Schulsozialarbeit
- Die Kritik an Niklas Luhmann und die Relevanz seiner Theorie für die Gegenwart
- Die Bedeutung des "blinden Flecks" in Luhmanns Systemtheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung von Theorien für die Soziale Arbeit dar und führt in die Systemtheorie von Niklas Luhmann ein. Kapitel 2 beleuchtet Luhmanns Biografie und seine Sichtweise auf die Welt. Dabei wird auf seine zentralen Ideen, wie den "blinden Fleck" und den Konstruktivismus, eingegangen. Kapitel 3 erklärt die wichtigsten Konzepte der Systemtheorie, wie Autopoiesis, System/Umwelt-Differenz und die Reduktion von Komplexität. In Kapitel 4 wird die Anwendbarkeit der Luhmannschen Systemtheorie auf die Soziale Arbeit und insbesondere die Schulsozialarbeit untersucht. Die Relevanz von Luhmanns Theorie für die Gegenwart wird in Kapitel 5 diskutiert, wobei auch kritische Punkte beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Systemtheorie, Niklas Luhmann, Soziale Arbeit, Schulsozialarbeit, Autopoiesis, System/Umwelt-Differenz, Komplexität, Kommunikation, "blinder Fleck", Konstruktivismus, Beobachtung, Reflexion, Handlungsorientierung
- Quote paper
- Theresia Friesinger (Author), 2005, Die Systemtheorie von Niklas Luhmann, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/88236