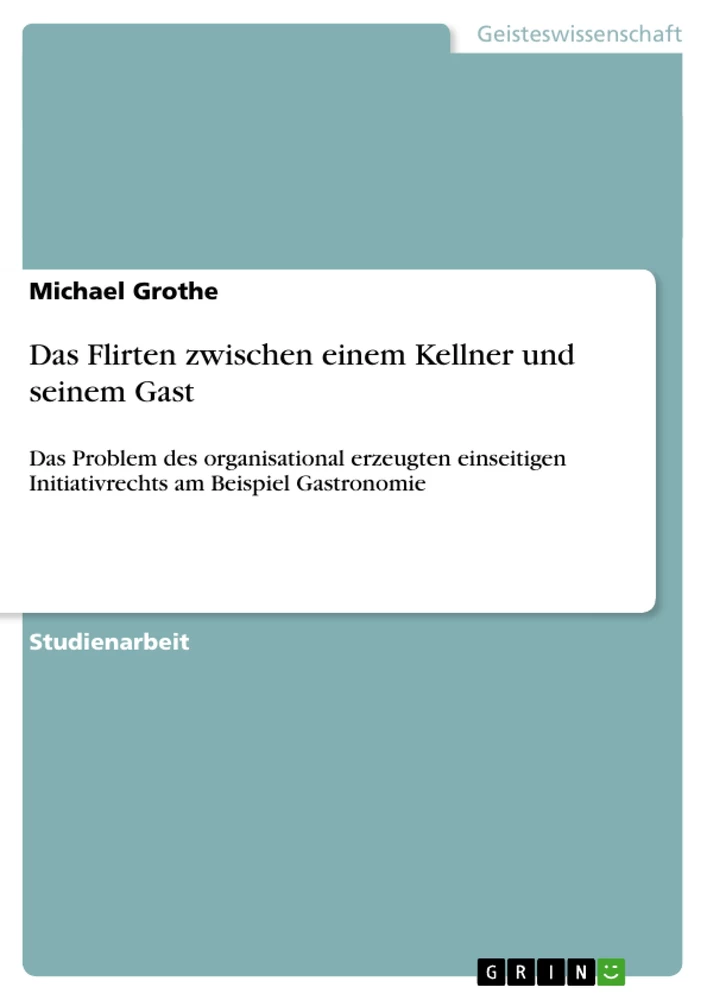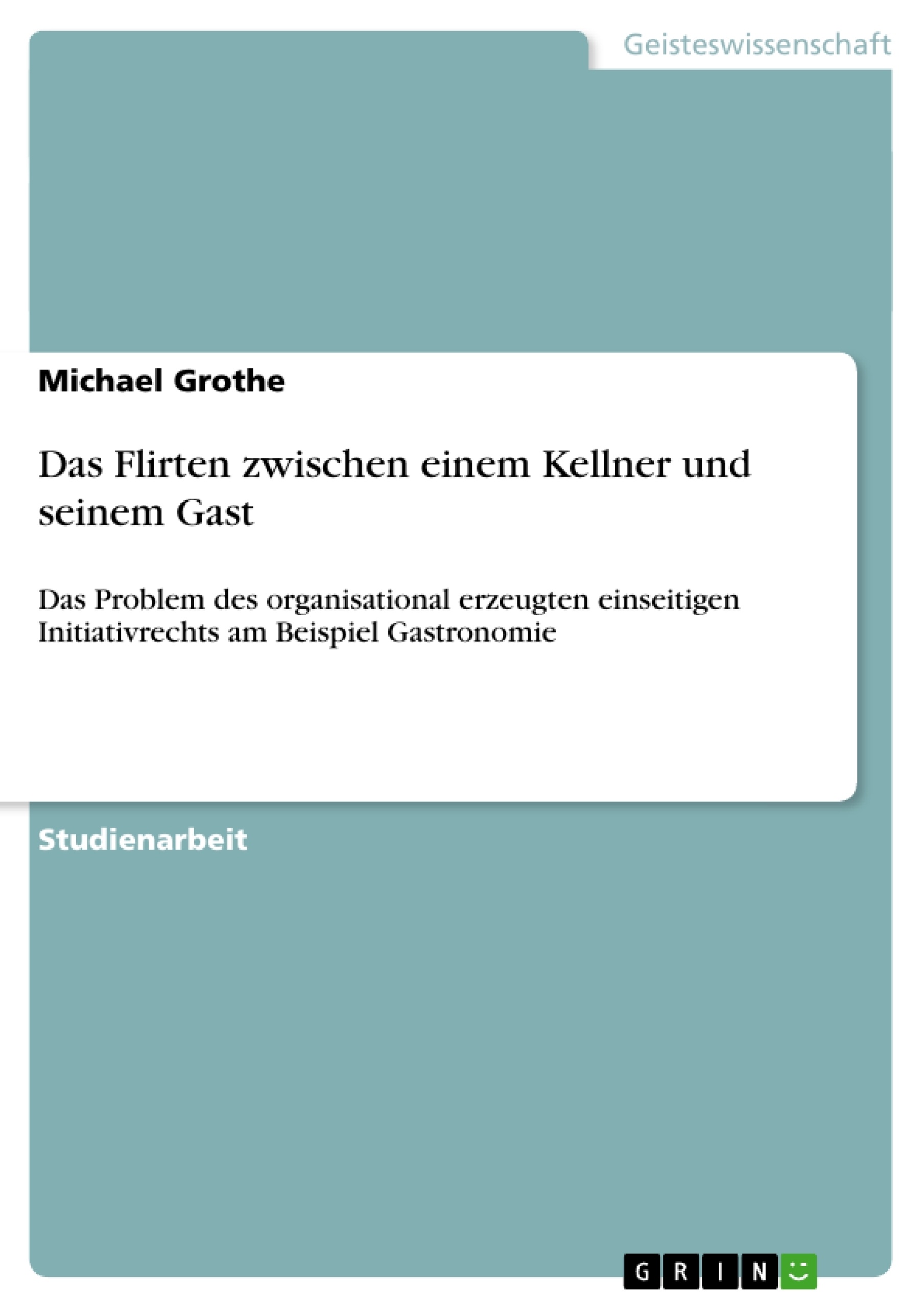Soziologische Werke zum Thema Flirt finden sich selten. „Nur die spröde Schöne Soziologie verweigert sich standhaft dem Gegenstand“, wurde es einmal in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie beschrieben (1993).
Die existierenden Ausarbeitungen fanden zumeist nur wenig Beachtung, wurden erst gar nicht veröffentlicht oder entstanden als Nebenprodukte.
Im Rahmen der folgenden Arbeit werden daher die bisherigen Erkenntnisse zusammengeführt und im Hinblick auf die Wirkungsmöglichkeiten von Organisationen erweitert.
Bisherige Ausarbeitungen gehen nämlich i.d.R. von einem zweiseitigen Initiativrecht beim Beginn mit intimer Kommunikation aus. D.h.: Beide Flirtbeteiligten können den ersten Schritt machen. Dies ist allerdings gar nicht immer der Fall. So kommt es auch vor, dass dieses Verhältnis einseitig liegt, also nur einer der Flirtenden den ersten Schritt tun kann.
Dieses einseitige Initiativrecht wird vorrangig durch Organisationen geschaffen (wenn es denn geschaffen wird). Sie können die Möglichkeiten ihrer Mitglieder durch formale Regeln beschränken und somit auch in das Flirtgeschehen eingreifen.
Besonders gut lässt sich dies vor allem an Gastronomiebetrieben beobachten.
Während sich bei der Annäherung, sowohl zwischen Bekannten als auch zwischen Unbekannten, das Problem der Initiative (also welcher von beiden den ersten Schritt wagt) auf beiden Seiten einstellt (beide können die Initiative ergreifen) liegt die Möglichkeit zur Initiative in diesem Sonderfall nur beim Gast.
Geflirtet wird zwischen Kellnern und Gästen aber trotzdem, auch wenn es verboten sein sollte. Der Kellner verfügt immer noch indirekte Mitteilungsmöglichkeiten. Abschließend wird daher noch auf die Möglichkeiten eines Gastronomiebetriebes eingegangen, auch auf diese Formen des indirekten Flirts einzuwirken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung – Das Thema Flirt in der Soziologie und das Ziel dieser Arbeit
- 2. Das Annäherungsverhalten – Indirekte Kommunikation und das Problem der Initiative
- 2.1 Der Flirt - Eine kurze Einleitung
- 2.2 Was ist Kommunikation?
- 2.3 Was ist indirekte Kommunikation?
- 2.4 Was ist das eigentlich genau: Flirten?
- 3. Das Flirten in Organisationen – informal oder formal illegal?
- 4. Warum der Kellner nicht den ersten Schritt tun kann - Das einseitige Problem der Initiative beim Flirten zwischen Kellner und Gast
- 4.1 Die Rolle des Kellners – Flirtbegünstiger und -behinderer zugleich
- 4.2 Die Sozialstruktur eines Gastronomiebetriebes
- 5. Wie der Kellner flirten kann – Möglichkeiten der Motivation zur Initiative
- 6. Wie der Gast flirten kann – Das Problem der Einschätzung der Lage
- 7. Wieso der Chef zum Flirten anstiftet – Funktionen, Folgen und Möglichkeiten für die Organisation
- 8. Abschließende Bemerkungen – Kellner-Gast-Beziehungen unter Bekannten, Geschlechterunterschiede und der formal illegal handelnde Vorgesetzte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Flirts in organisationalen Kontexten, insbesondere in der Gastronomie, unter besonderer Berücksichtigung des einseitigen Initiativrechts. Sie beleuchtet die soziologischen Aspekte des Flirts, analysiert Kommunikationsmuster und untersucht die Rolle von formalen und informellen Regeln im Flirtverhalten.
- Soziologische Betrachtung des Flirts und dessen bisherige Forschungslücke
- Das einseitige Initiativrecht im Flirt zwischen Kellner und Gast
- Indirekte Kommunikation und ihre Rolle beim Flirten
- Der Einfluss organisationaler Strukturen auf Flirtverhalten
- Möglichkeiten und Grenzen des Flirts in Abhängigkeit von Rollen und Hierarchien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung – Das Thema Flirt in der Soziologie und das Ziel dieser Arbeit: Die Einleitung konstatiert die Seltenheit soziologischer Arbeiten zum Thema Flirt und benennt die Forschungslücke. Sie führt ein in die Problematik des einseitigen Initiativrechts, das insbesondere in Organisationen wie der Gastronomie auftritt, wo beispielsweise der Kellner aufgrund seiner beruflichen Rolle oft nicht den ersten Schritt zum Flirten machen kann. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse dieser Asymmetrie anhand des Beispiels Kellner-Gast-Interaktion.
2. Das Annäherungsverhalten - Indirekte Kommunikation und das Problem der Initiative: Dieses Kapitel definiert den Flirtbegriff und beleuchtet die Bedeutung von Kommunikation, insbesondere indirekter Kommunikation, für das Annäherungsverhalten. Es wird zwischen direkter und indirekter Kommunikation unterschieden und der Begriff der „Initiative“ im Flirtkontext präzisiert. Das Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Analyse der einseitigen Initiativrechte im Kontext von Kellner-Gast-Interaktionen.
3. Das Flirten in Organisationen – informal oder formal illegal?: Dieses Kapitel thematisiert den Flirt in organisationalen Zusammenhängen und die Ambivalenz zwischen formalen Regeln und informellen Praktiken. Es legt den Fokus auf die Spannungen zwischen den offiziellen Regeln und dem tatsächlichen Verhalten in Organisationen, insbesondere die Grenzen, die Organisationen durch formale Regeln setzen und wie diese die Möglichkeiten des Flirtens beeinflussen.
4. Warum der Kellner nicht den ersten Schritt tun kann - Das einseitige Problem der Initiative beim Flirten zwischen Kellner und Gast: Dieses Kapitel analysiert das einseitige Initiativrecht im Flirt zwischen Kellner und Gast. Es untersucht die Rolle des Kellners als gleichzeitig Flirtbegünstiger und -behinderer, bedingt durch seine berufliche Position und die damit verbundenen sozialen Erwartungen und Regeln. Die Sozialstruktur des Gastronomiebetriebs und seine Auswirkungen auf das Flirtverhalten werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Flirt, Soziologie, Kommunikation, Indirekte Kommunikation, Organisation, Gastronomie, Initiativrecht, Asymmetrie, Rollenverständnis, formale Regeln, informelle Praktiken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Flirtverhalten in der Gastronomie
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Flirts in organisationalen Kontexten, insbesondere in der Gastronomie. Ein besonderer Fokus liegt auf dem einseitigen Initiativrecht, das heißt, wer den ersten Schritt beim Flirten machen kann und wer nicht. Analysiert werden soziologische Aspekte des Flirts, Kommunikationsmuster und der Einfluss formeller und informeller Regeln.
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Arbeit konstatiert die Seltenheit soziologischer Arbeiten zum Thema Flirt und die damit verbundene Forschungslücke. Sie konzentriert sich auf die Analyse der Asymmetrie beim Initiativrecht im Flirt, insbesondere im Kontext der Kellner-Gast-Interaktion.
Welche Aspekte des Flirts werden untersucht?
Die Arbeit untersucht soziologische Aspekte des Flirts, die Rolle indirekter Kommunikation beim Annäherungsverhalten, den Einfluss organisationaler Strukturen (insbesondere in der Gastronomie) auf das Flirtverhalten, Möglichkeiten und Grenzen des Flirts in Abhängigkeit von Rollen und Hierarchien sowie die Ambivalenz zwischen formellen Regeln und informellen Praktiken.
Warum wird die Gastronomie als Beispiel gewählt?
Die Gastronomie bietet einen idealen Kontext, um das einseitige Initiativrecht beim Flirten zu analysieren. Die berufliche Rolle des Kellners, seine Position und die damit verbundenen sozialen Erwartungen und Regeln machen ihn oft zu einem Akteur, der den ersten Schritt beim Flirten nur eingeschränkt machen kann.
Welche Rolle spielt die indirekte Kommunikation?
Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung indirekter Kommunikation für das Annäherungsverhalten beim Flirten. Es wird untersucht, wie indirekte Signale im Kontext von formellen und informellen Regeln in der Gastronomie interpretiert und eingesetzt werden.
Wie wird das einseitige Initiativrecht zwischen Kellner und Gast analysiert?
Die Arbeit analysiert die Rolle des Kellners als gleichzeitig Flirtbegünstiger und -behinderer. Die Sozialstruktur des Gastronomiebetriebs und ihre Auswirkungen auf das Flirtverhalten werden untersucht, um zu verstehen, warum der Kellner oft nicht den ersten Schritt zum Flirten machen kann.
Welche Möglichkeiten und Grenzen des Flirts werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen des Flirts in Abhängigkeit von Rollen und Hierarchien innerhalb der Gastronomie. Sie analysiert, wie formale Regeln und informelle Praktiken das Flirtverhalten beeinflussen und welche Spannungen zwischen offiziellen Regeln und tatsächlichem Verhalten bestehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Flirt, Soziologie, Kommunikation, Indirekte Kommunikation, Organisation, Gastronomie, Initiativrecht, Asymmetrie, Rollenverständnis, formale Regeln, informelle Praktiken.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, zum Annäherungsverhalten und indirekter Kommunikation, zum Flirten in Organisationen, zum einseitigen Initiativrecht beim Flirt zwischen Kellner und Gast, zu Möglichkeiten des Flirts für Kellner und Gast, zum Einfluss des Chefs auf das Flirten und abschließende Bemerkungen zu Kellner-Gast-Beziehungen, Geschlechterunterschieden und formal illegal handelnden Vorgesetzten.
- Quote paper
- Michael Grothe (Author), 2008, Das Flirten zwischen einem Kellner und seinem Gast, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/88043