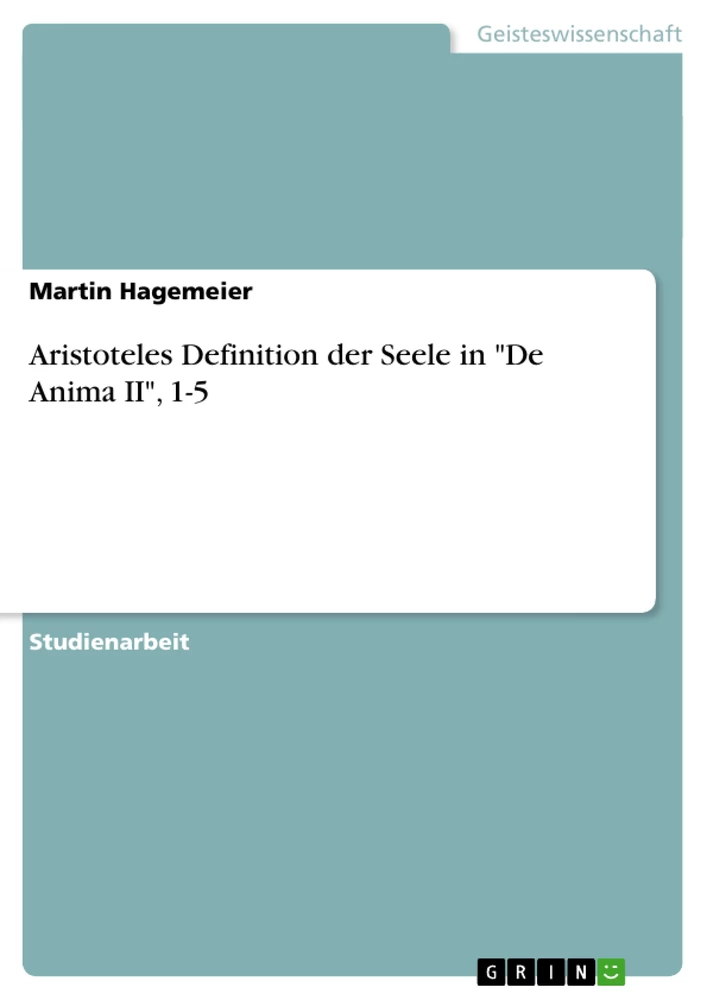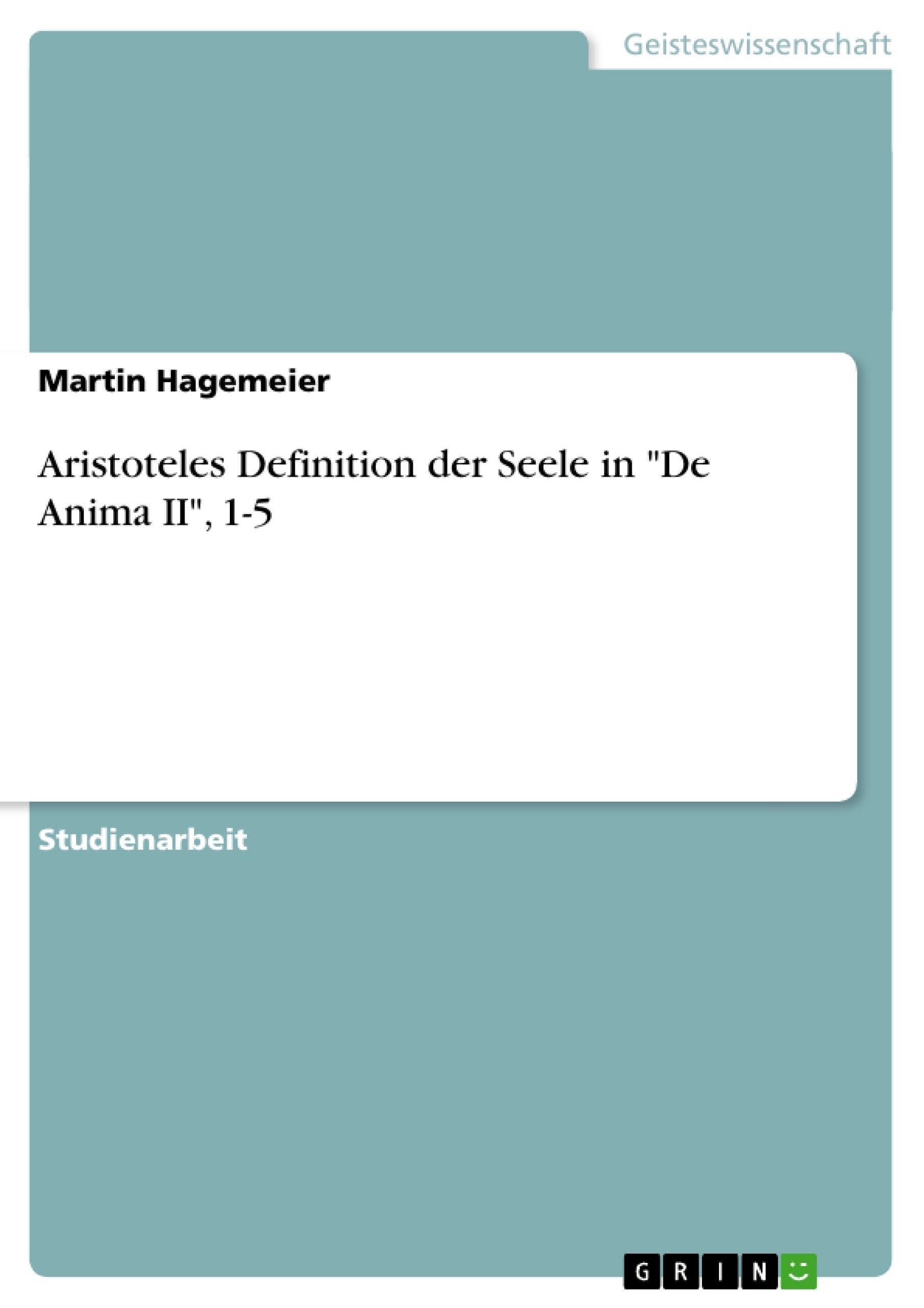Die von Aristoteles in seiner Schrift De Anima getroffene Definition der Seele bildet den Gegenstand der vorliegenden Hausarbeit. Die Definition befindet sich am Anfang des zweiten Buches in den Kapiteln 1-4, zu Beginn der Untersuchung über die einzelnen Seelenvermögen.
Im ersten Buch beginnt Aristoteles, indem er hinsichtlich seiner Vorgehensweise die Punkte benennt, die bei der Untersuchung zu beachten sind:
"Zuerst muss man wohl klären, in welcher von den (kategorialen) Gattungen sie (=die Seele) auftritt und was sie ist, nämlich ob sie ein Dies-da (Einzelding) und Wesen (Substanz) ist, oder etwas Qualitatives und Quantitatives, oder auch eine andere von den unterschiedlichen Kategorien, ferner ob sie zu dem in Möglichkeit Seienden gehört, oder ob sie eine Vollendung (Wirklichkeit) ist; denn dies macht keinen geringen Unterschied aus."(Zitat: an402a23-b1)
An dieses erste Kapitel, welches die Problemstellung erörtert, schließt sich in den Kapiteln 2-5 eine kritische Auseinandersetzung mit den Ansichten seiner Vorgänger an. Diese Auseinandersetzungen bilden allerdings nicht die Grundlage, für die im zweiten Buch aufgestellte Definition der Seele. Vielmehr greift Aristoteles dort auf sein Verständnis von ousía zurück, wie er es in den Metaphysikschriften erklärte, um mit Hilfe seines aus der Metaphysik übernommenen Hylemorphismus, anhand der zentralen Begriffe von hyle, morphe, dýnamis und entelécheia zur Definition der Seele zu gelangen.
Die in Buch II gemachte Definition der Seele bereitet aber nun mehrere Probleme: Zum einen ist es der Charakter der "Vorlesungsnotizen", der ein Nachvollziehen der Beweisstruktur erschwert. Dabei soll durch Rückgriffe, auf anderen Orts getroffene Bestimmungen, das Verständnis des Textes erleichtert werden. Zum anderen gibt es in Buch II mindestens zwei verschiedene Ansätze zu einer Definition der Seele. Deren Ansprüche und Funktionen werden untersucht und falls möglich in einen gemeinsamen Zusammenhang gestellt.
Eines der berühmtesten Probleme in Aristoteles De Anima ist die Umschreibung der Seele, mit Hilfe des Begriffs der "próte entelécheia". Dieser ist zugleich auch ein gutes Beispiel für Aristoteles Hang zu Begriffsbildungen, die häufig nur an vereinzelten Stellen auftauchen und ein Verständnis des Textes erschweren. Demzufolge befasst sich auch ein großer Teil der Literatur mit dieser Definition der Seele als próte entelécheia.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Hinführung
- 2. Die Definitionen der Seele
- 2.1. Der Rahmen der Seelendefinitionen
- 2.2. Das Aufgreifen der Ontologie aus der Metaphysik
- 2.3. Die Definition α
- 2.4. Der "allgemeinste Begriff" der Seele
- 2.5. Die Definition β
- 2.6. Eine Zusammenfassung der Definitionen
- 3. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Aristoteles' Definition der Seele in seiner Schrift De Anima. Der Fokus liegt auf den Definitionen im zweiten Buch, insbesondere auf den Herausforderungen, die sich aus der Mehrdeutigkeit und der komplexen Terminologie ergeben. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Ansätze Aristoteles' und versucht, diese in einen kohärenten Zusammenhang zu bringen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Interpretation des Begriffs "próte entelécheia".
- Aristoteles' Definition der Seele in De Anima
- Analyse der unterschiedlichen Seelendefinitionen bei Aristoteles
- Interpretation des Begriffs "próte entelécheia"
- Der Einfluss der aristotelischen Ontologie auf die Seelendefinition
- Funktionalistische Interpretationen der aristotelischen Seelenkonzeption
Zusammenfassung der Kapitel
1. Hinführung: Diese Einführung beschreibt den Gegenstand der Arbeit: Aristoteles' Seelendefinition in De Anima, insbesondere im zweiten Buch. Es wird auf die methodischen Schwierigkeiten hingewiesen, die sich aus dem Charakter des Textes als "Vorlesungsnotizen" und der Mehrdeutigkeit der Definitionen ergeben. Die Arbeit kündigt die Auseinandersetzung mit verschiedenen Interpretationen, besonders im Hinblick auf den Begriff "próte entelécheia" und die funktionalistische Lesart, an.
2. Die Definitionen der Seele: Dieses Kapitel analysiert die zwei unterschiedlichen Ansätze Aristoteles' zur Definition der Seele in De Anima II. Es wird der Unterschied zwischen Definition α, die den "allgemeinsten Begriff" der Seele sucht, und Definition β, welche über die reine Wesensbestimmung hinausgeht und auch die Ursachen benennt, herausgearbeitet. Die Kapitel 2.1 bis 2.5 untersuchen diese Definitionen im Detail, und Kapitel 2.6 kündigt die Zusammenfassung der Definitionen mit Bezug auf Robert Bolton’s Unterscheidung zwischen nominaler und realer Seelendefinition an.
2.2. Das Aufgreifen der Ontologie aus der Metaphysik: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss der aristotelischen Metaphysik auf seine Seelendefinition. Aristoteles bezieht seine Substanzlehre (ousía) mit den Begriffen hyle (Materie), morphe (Form), dýnamis (Möglichkeit) und entelécheia (Vollendung) in seine Definitionen ein. Der hylemorphistische Ansatz wird erklärt und seine Bedeutung für das Verständnis der Seele als Form eines natürlichen Körpers herausgestellt.
2.3. Die Definition α: Hier wird die erste Seelendefinition (α) detailliert analysiert. Aristoteles definiert die Seele als "erste Vollendung (próte entelécheia)" eines natürlichen Körpers mit der Fähigkeit zum Leben. Die Arbeit diskutiert die Identifikation von Seele und Leben und die Probleme der Unterscheidung zwischen erster und zweiter Vollendung. Der Bezug auf Karen Gloy und ihre funktionalistische Interpretation wird hergestellt.
Schlüsselwörter
Aristoteles, De Anima, Seelendefinition, próte entelécheia, Hylemorphismus, ousía, hyle, morphe, dýnamis, entelécheia, Funktionalismus, Leib-Seele-Problem, Ontologie, Metaphysik.
Häufig gestellte Fragen zu Aristoteles' Seelendefinition in *De Anima*
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht Aristoteles' Definition der Seele in seinem Werk De Anima, mit besonderem Fokus auf die Definitionen im zweiten Buch und den Herausforderungen, die sich aus Mehrdeutigkeit und komplexer Terminologie ergeben. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Ansätze Aristoteles' und versucht, diese in einen kohärenten Zusammenhang zu bringen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Interpretation des Begriffs "próte entelécheia".
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Aristoteles' Definition der Seele in De Anima, die Analyse der unterschiedlichen Seelendefinitionen, die Interpretation von "próte entelécheia", den Einfluss der aristotelischen Ontologie auf die Seelendefinition und funktionalistische Interpretationen der aristotelischen Seelenkonzeption.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Die Definitionen der Seele"), welches die beiden Hauptansätze Aristoteles' (Definition α und β) detailliert untersucht, und eine Schlussbemerkung. Das Hauptkapitel beinhaltet Unterkapitel, die die "erste Vollendung" (próte entelécheia), den Einfluss der aristotelischen Metaphysik und Ontologie, sowie die einzelnen Definitionen im Detail analysieren.
Was sind die wichtigsten Begriffe, die in der Arbeit erläutert werden?
Schlüsselbegriffe sind Aristoteles, De Anima, Seelendefinition, próte entelécheia, Hylemorphismus, ousía, hyle, morphe, dýnamis, entelécheia, Funktionalismus, Leib-Seele-Problem, Ontologie und Metaphysik.
Wie werden Aristoteles' Definitionen der Seele analysiert?
Die Arbeit analysiert zwei unterschiedliche Ansätze Aristoteles': Definition α, die den "allgemeinsten Begriff" der Seele sucht, und Definition β, die über die reine Wesensbestimmung hinausgeht und auch die Ursachen benennt. Der Unterschied zwischen diesen Definitionen wird herausgearbeitet, und die Kapitel untersuchen diese im Detail, unter Berücksichtigung von Robert Bolton’s Unterscheidung zwischen nominaler und realer Seelendefinition.
Welche Rolle spielt die aristotelische Ontologie?
Die aristotelische Metaphysik und Ontologie spielen eine entscheidende Rolle. Aristoteles' Substanzlehre (ousía) mit den Begriffen hyle (Materie), morphe (Form), dýnamis (Möglichkeit) und entelécheia (Vollendung) beeinflusst seine Seelendefinitionen maßgeblich. Der hylemorphistische Ansatz und seine Bedeutung für das Verständnis der Seele als Form eines natürlichen Körpers werden erklärt.
Wie wird der Begriff "próte entelécheia" interpretiert?
Die Arbeit diskutiert die Interpretation des Begriffs "próte entelécheia" ("erste Vollendung") in Aristoteles' Definition der Seele. Sie analysiert die Identifikation von Seele und Leben und die Probleme der Unterscheidung zwischen erster und zweiter Vollendung und bezieht sich dabei auf verschiedene Interpretationen, insbesondere auf Karen Gloy und ihre funktionalistische Interpretation.
Welche methodischen Herausforderungen werden angesprochen?
Die Arbeit geht auf die methodischen Schwierigkeiten ein, die sich aus dem Charakter des Textes De Anima als "Vorlesungsnotizen" und der Mehrdeutigkeit der Definitionen ergeben. Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Interpretationen und die Berücksichtigung funktionalistischer Lesarten werden als methodischer Ansatz genannt.
- Quote paper
- M. A. Martin Hagemeier (Author), 2001, Aristoteles Definition der Seele in "De Anima II", 1-5, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/87816