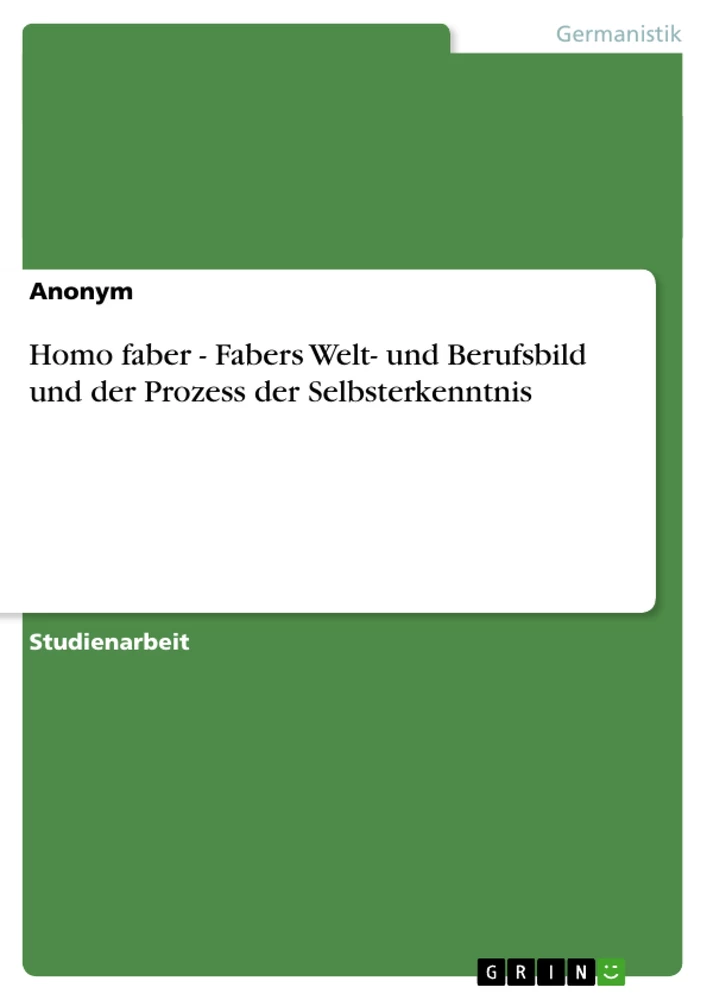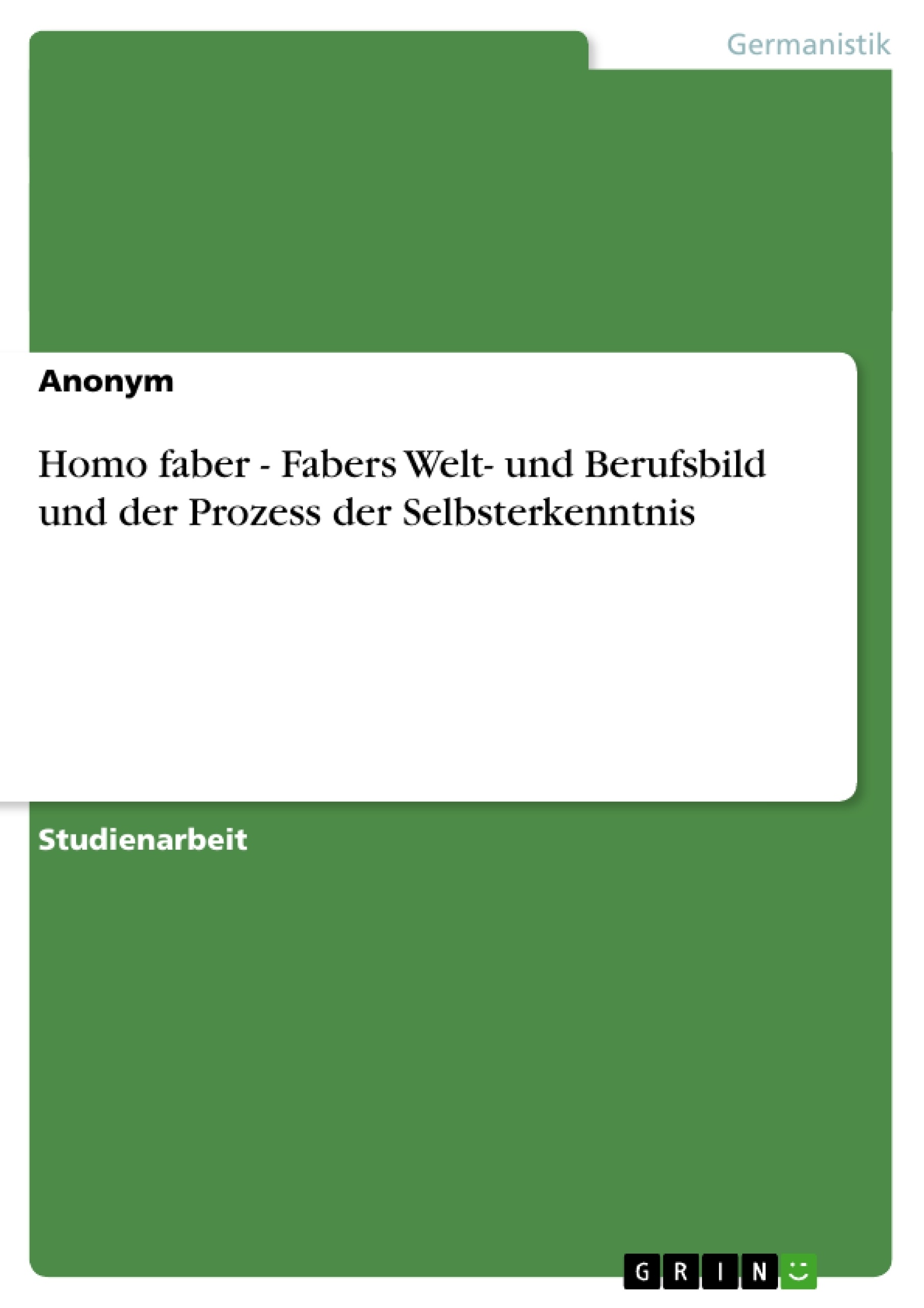Der Titel eines jeden Werkes verleitet dazu, sich ein Bild vom Inhalt und der Thematik zu machen, ohne das Werk zuvor gelesen zu haben. So auch der Roman des Schweizer Autors Max Frisch ,,Homo faber". Übersetzt bedeutet ,,homo faber" nichts anderes als ,,der schaffende Mensch", wörtlich gemeint also ein Mensch, der mit seiner Hände Arbeit etwas erschafft. Diese Übersetzung scheint jedoch das Wesen des Protagonisten Walter Faber auf den ersten Blick nicht zu erfüllen: Er arbeitet mit dem Kopf und nicht mit seinen Händen oder seiner Muskelkraft.
Bei näherem Betrachten fällt jedoch auf, daß Walter Faber, der von seiner ehemaligen Freundin Hanna den Spitznamen ,,homo faber" seines rationalen Wesens wegen erhielt, im Laufe der Handlung dem Bild des schaffenden Menschen immer näher kommt: Er beginnt, sich und seine Sicht der Dinge neu zu erschaffen.
Wie sich das ursprüngliche Weltbild des Walter Faber darstellt und wie es sich während des Romans verändert, soll im folgenden untersucht werden. Ob es Faber gelingt, seine Ansichten wirklich zu ändern und die Erkenntnisse auch anzunehmen und umzusetzen, wird Gegenstand des zweiten Teils meiner Arbeit sein.
Die Frage nach der Erkenntnisfähigkeit Fabers wirft auch die Frage nach der Schuld am Tod seiner eigenen Tochter Elisabeth auf, hierauf möchte ich erst im Schlussteil nach Beantwortung der übrigen Fragen genauer eingehen. Auch Fabers Beziehungen zu den Frauen in seinem Leben ist ein Teil der angesprochenen Problematik, kann aber hier des Umfangs wegen nur kurz umrissen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Walter Fabers Welt- und Berufsbild
- 2.1 Fabers Berufsleben
- 2.2 Das technikzentrierte Weltbild
- 2.3 Beobachtung statt Erlebnis
- 2.4 Natur als Bedrohung
- 2.5 Zwischenmenschliche Beziehungen
- 3. Der Prozess der Selbsterkenntnis
- 3.1 Erste Anzeichen des Wandels
- 3.2 Irrationale Impulse
- 3.3 Erlebnis statt Beobachtung
- 3.4 Selbstannahme
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Welt- und Berufsbild des Protagonisten Walter Faber in Max Frischs Roman „Homo faber“ und analysiert den Prozess seiner Selbsterkenntnis. Der Fokus liegt auf der Entwicklung seiner Ansichten und der Frage, ob er seine Erkenntnisse annimmt und umsetzt. Die Rolle seiner Beziehungen zu Frauen und die Frage nach seiner Schuld am Tod seiner Tochter werden ebenfalls kurz angesprochen.
- Entwicklung von Fabers technikzentriertem Weltbild
- Der Gegensatz zwischen Beobachtung und Erlebnis bei Faber
- Fabers Prozess der Selbsterkenntnis und die damit verbundene Veränderung seiner Ansichten
- Die Bedeutung von Fabers Beruf für seine Identität und sein Selbstverständnis
- Fabers Beziehungen zu den Frauen in seinem Leben
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Romans „Homo faber“ von Max Frisch ein. Sie stellt die Frage nach der Bedeutung des Titels „homo faber“ („der schaffende Mensch“) im Kontext des Protagonisten Walter Faber, der zunächst nicht dem Bild eines schaffenden Menschen entspricht, da er mit dem Kopf und nicht mit den Händen arbeitet. Die Einleitung deutet an, dass Faber im Laufe der Handlung dem Bild des schaffenden Menschen näherkommt, indem er seine Sicht der Dinge neu erschafft. Die Arbeit wird in zwei Teile gegliedert: den ersten Teil, der sich mit Fabers ursprünglichem Weltbild befasst, und den zweiten Teil, der sich mit dem Prozess seiner Veränderung und der Annahme seiner Erkenntnisse beschäftigt. Die Frage nach Fabers Schuld am Tod seiner Tochter und seine Beziehungen zu Frauen werden als weitere zentrale Aspekte angekündigt.
2. Walter Fabers Welt- und Berufsbild: Dieses Kapitel beschreibt ausführlich Walter Fabers Welt- und Berufsbild. Sein Berufsleben als erfolgreicher Maschineningenieur bei der UNESCO wird dargestellt, wobei betont wird, dass sein Beruf für ihn mehr als nur ein Job ist; er gibt ihm ein Gefühl der Kontrolle und des Sinns. Fabers technikzentriertes Weltbild wird als rational, logisch und frei von metaphysischen Elementen beschrieben. Er betrachtet die Welt als berechenbar und durchschaubar und lehnt mystische Erklärungen ab. Das Kapitel hebt Fabers Präferenz für Beobachtung über Erlebnis hervor, seine Unfähigkeit, sich irrationalen Impulsen zu öffnen, und die Folgen dieser Einstellung für seine Wahrnehmung der Natur und seiner Beziehungen zu anderen Menschen. Sein Beruf wird als untrennbar mit seiner Identität und seiner Definition von Männlichkeit verbunden dargestellt.
Schlüsselwörter
Homo faber, Max Frisch, Walter Faber, Technik, Rationalität, Selbsterkenntnis, Weltbild, Beobachtung, Erlebnis, Zwischenmenschliche Beziehungen, Schuld, Mystik.
Häufig gestellte Fragen zu Max Frischs "Homo faber"
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Übersicht über eine akademische Arbeit zu Max Frischs Roman "Homo faber". Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse des Welt- und Berufsbilds des Protagonisten Walter Faber und seines Prozesses der Selbsterkenntnis.
Welche Themen werden in der Arbeit zu "Homo faber" behandelt?
Die Arbeit untersucht hauptsächlich Walter Fabers technikzentriertes Weltbild, den Gegensatz zwischen Beobachtung und Erlebnis in seinem Leben, seinen Prozess der Selbsterkenntnis und die damit verbundene Veränderung seiner Ansichten. Zusätzlich werden die Bedeutung seines Berufs für seine Identität, seine Beziehungen zu Frauen und die Frage nach seiner Schuld am Tod seiner Tochter behandelt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über Walter Fabers Welt- und Berufsbild (einschließlich seiner Berufsauffassung, seines technikzentrierten Weltbildes, seiner Bevorzugung von Beobachtung statt Erlebnis, seiner Wahrnehmung der Natur und seiner zwischenmenschlichen Beziehungen), ein Kapitel über Fabers Prozess der Selbsterkenntnis (mit Unterkapiteln zu ersten Anzeichen des Wandels, irrationalen Impulsen, dem Umschwenken von Beobachtung zu Erlebnis und Selbstannahme) und abschließend ein Schluss.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit analysiert das Welt- und Berufsbild von Walter Faber und den Prozess seiner Selbsterkenntnis. Sie untersucht, ob Faber seine Erkenntnisse annimmt und umsetzt und betrachtet dabei auch seine Beziehungen zu Frauen und die Frage nach seiner Schuld am Tod seiner Tochter.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Homo faber, Max Frisch, Walter Faber, Technik, Rationalität, Selbsterkenntnis, Weltbild, Beobachtung, Erlebnis, Zwischenmenschliche Beziehungen, Schuld, Mystik.
Wie wird Walter Fabers Weltbild beschrieben?
Walter Fabers Weltbild wird als stark technikzentriert, rational und logisch beschrieben. Er bevorzugt Beobachtung über Erlebnis und lehnt mystische Erklärungen ab. Sein Beruf als Ingenieur ist untrennbar mit seiner Identität und seinem Selbstverständnis verbunden.
Wie wird der Prozess der Selbsterkenntnis bei Faber dargestellt?
Der Prozess der Selbsterkenntnis bei Faber wird als ein Wandel von einem rationalen, technikzentrierten Weltbild hin zu einer größeren Offenheit für Emotionen und Erlebnisse beschrieben. Dieser Prozess wird durch verschiedene Ereignisse und Beziehungen in seinem Leben ausgelöst.
Welche Rolle spielen Fabers Beziehungen zu Frauen?
Die Beziehungen zu Frauen spielen eine wichtige Rolle im Prozess der Selbsterkenntnis Fabers und werden im Kontext seiner Schuld am Tod seiner Tochter kurz angesprochen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2000, Homo faber - Fabers Welt- und Berufsbild und der Prozess der Selbsterkenntnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/8763