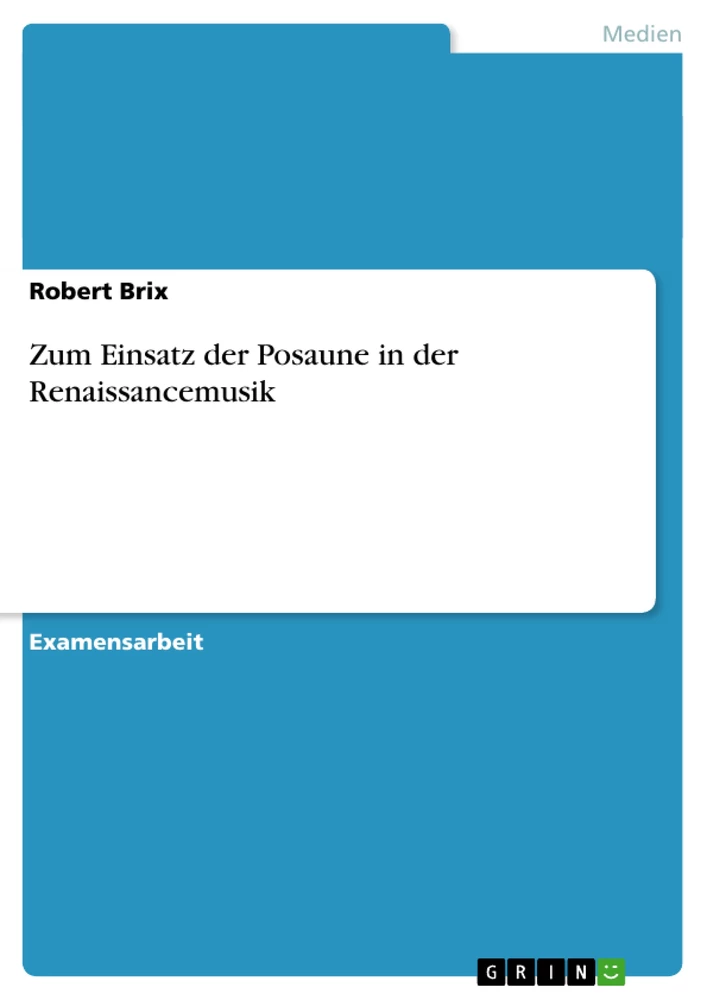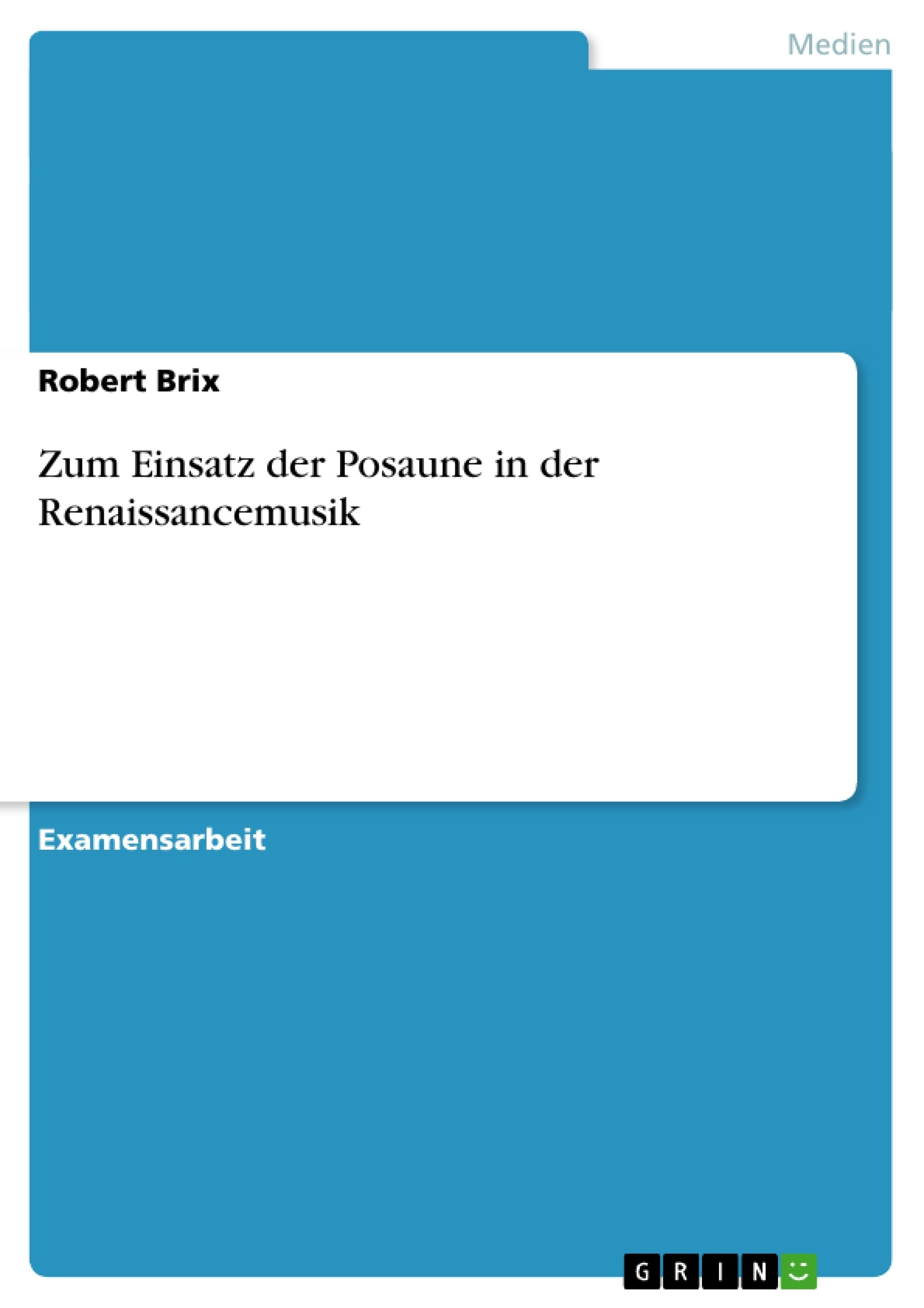Der klangliche Unterschied zwischen den Posaunen der verschiedenen Jahrhunderte ist offensichtlich, aber worin liegt er begründet? Die Konstruktion der Instrumente bietet eine Erklärung. Die Herstellungsmethoden und das verwandte Rohmaterial sind jedoch ebenfalls entscheidend. So wurden Renaissanceposaunen zum Beispiel in aller Regel nicht gelötet, sondern meist nur mit Harz verklebt, was ein Stimmen der Instrumente durch eine leichte Erwärmung der Klebestellen ermöglichte. Zudem waren die Instrumente reich mit meist silbernen Verzierungen versehen.
Auf dem ersten Blick gibt es Unterschiede, aber sind die eben genannten für den Klang entscheidend? Es bleibt also zu untersuchen, wo die genauen baulichen Differenzierungen liegen und wie sie sich auf den Klang des Instruments auswirken.
Mit Beginn der neuen Epoche, dem Barock, setzte sich eine allmähliche Spezialisierung der Musiker auf einzelnen Instrumenten durch. Wurde noch im 16. Jahrhundert von einem Musiker das Beherrschen mehrerer Instrumente verschiedener Instrumentenfamilien und -gattungen verlangt, so hob sich dies mit Beginn des 17. Jahrhunderts auf. Lediglich von den Stadtpfeifern wurde ein Beherrschen eines breiten Instrumentariums noch bis ins 20. Jahrhundert gefordert. Es stellt sich daraus die Frage, welche Fähigkeiten die Musik der Renaissance den Posaunisten ihrer Zeit abverlangte. Da der U-förmige Zug die erste Erfindung war, die einem Blechblasinstrument zu einem chromatischen Spiel in sämtlichen Lagen verhalf, ist ein reger Einsatz dieses Instruments in sämtlichen Gebieten der Musik anzunehmen. In welchen Ensembles hielt aber die Posaune erstmalig Einzug, wo durfte sie wirken oder gab es gar eine strenge Reglementierung ähnlich zu den Trompeten, die ihren Einsatz dem gemeinen Volk vorenthielt?
Schalmeien war es in der Kirche untersagt, mit der Gemeinde zusammen zu erklingen. Gab es solche Beschränkungen auch für Posaunen? In dieser Arbeit soll der Versuch unternommen werden, in die ersten Jahrzehnte der Posaune etwas Licht zu bringen. Ihre Entstehung, ihre klangentscheidenden Merkmale und ihr Vorkommen in den verschiedenen Ensembles der Renaissance sollen dazu näher betrachtet werden. Auch die Frage nach dem Reifegrad der Spieltechnik der ausübenden Musiker soll dabei tangiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Entstehung der Posaune
- 2.1 Frühe Vorformen und Entwicklungsschritte
- 2.2 Die Zugtrompete
- 2.3 Die Erfindung des U-förmigen Zuges
- 2.3.1 Der mögliche Entstehungsort Burgund
- 2.3.2 Der mögliche Entstehungsort Nürnberg
- 3. Die Posaunen der Renaissance
- 3.1 Die Posaunenfamilie
- 3.2 Klangbestimmende Faktoren
- 3.2.1 Das Schallstück
- 3.2.2 Die Mensur
- 3.2.3 Das Mundstück
- 3.2.4 Die verwendeten Materialien und ihre Verarbeitung
- 4. Der Einsatz der Renaissanceposaune
- 4.1 Instrumentale Besetzungen mit Posaune
- 4.1.1 Das Zusammenspiel mit dem Zink
- 4.1.2 Die alta capella
- 4.2 Die Turmmusik
- 4.3 Die Posaune in der Kirchenmusik der Reformationszeit
- 4.4 Giovanni Gabrielis Verwendung der Posaune
- 4.4.1 Gabrielis instrumentale Mehrchörigkeit am Beispiel der „Sonata pian e forte“ aus der Sammlung „sacrae symphoniae“
- 4.4.2 Gabrielis Canzonen am Beispiel der Canzon IV (C198) aus der Sammlung „canzoni et sonate“
- 4.1 Instrumentale Besetzungen mit Posaune
- 5. Das Posaunenspiel in der Renaissance
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Posaune in der Renaissancemusik. Ziel ist es, die Entstehung des Instruments, seine klanglichen Eigenschaften und seinen Einsatz in verschiedenen Ensembles zu beleuchten. Dabei wird auch der technische Reifegrad der Posaunisten der damaligen Zeit betrachtet.
- Entstehung und Entwicklung der Posaune
- Klangcharakteristika der Renaissanceposaune
- Einsatz der Posaune in verschiedenen musikalischen Kontexten der Renaissance
- Spieltechnik und Fähigkeiten der Posaunisten in der Renaissance
- Giovanni Gabrieli und seine Verwendung der Posaune
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Renaissancemusik und die spezifische Rolle der Posaune in dieser Epoche ein. Sie hebt Giovanni Gabrieli und seine „Sonata pian e forte“ als ein Schlüsselbeispiel für den innovativen Einsatz der Posaune hervor und stellt die Forschungsfrage nach der Entstehung und Entwicklung des Instruments in den Mittelpunkt. Die Einleitung skizziert den Umfang der Arbeit und die zu behandelnden Aspekte.
2. Die Entstehung der Posaune: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung der Posaune von frühen Vorformen bis zur Erfindung des U-förmigen Zuges. Es werden verschiedene Entwicklungsstufen und mögliche Entstehungsorte (Burgund und Nürnberg) diskutiert. Der Fokus liegt auf den technischen Innovationen, die zur Entstehung des modernen Posaunenkonzeptes führten.
3. Die Posaunen der Renaissance: Hier werden die klangbestimmenden Faktoren der Renaissanceposaune detailliert beschrieben, darunter Schallstück, Mensur, Mundstück und die verwendeten Materialien. Es wird der Unterschied zur modernen Posaune herausgestellt und die Bedeutung der handwerklichen Aspekte für den Klang der Instrumente betont. Die Beschaffenheit und Verarbeitung beeinflussten das Instrument deutlich.
4. Der Einsatz der Renaissanceposaune: Dieses Kapitel untersucht den Einsatz der Posaune in verschiedenen Ensembles der Renaissance, wie instrumentalen Besetzungen (inkl. des Zusammenspiels mit dem Zink und der „alta capella“), Turmmusik und Kirchenmusik der Reformationszeit. Ein Schwerpunkt liegt auf Giovanni Gabrielis Verwendung der Posaune und seinen innovativen Besetzungen, wie in der „Sonata pian e forte“ und seinen Canzonen. Der Unterschied in den Klangvorstellungen wird herausgestellt.
5. Das Posaunenspiel in der Renaissance: Dieses Kapitel befasst sich mit den technischen Fähigkeiten und dem Reifegrad des Posaunenspiels in der Renaissance, einschließlich des Einflusses des U-förmigen Zuges auf die chromatische Spielweise und mögliche Einschränkungen des Instrumenteneinsatzes in verschiedenen Kontexten. Das Kapitel reflektiert über die Entwicklung der Spieltechnik.
Schlüsselwörter
Renaissanceposaune, Giovanni Gabrieli, Instrumentenbau, Klang, Ensemble, Spieltechnik, „Sonata pian e forte“, sacrae symphoniae, canzoni et sonate, venezianische Musik, Zugtrompete, U-förmiger Zug.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Renaissanceposaune
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Renaissanceposaune. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Entstehung, den klanglichen Eigenschaften, dem Einsatz in verschiedenen Ensembles und der Spieltechnik der Posaune in der Renaissance, wobei Giovanni Gabrieli und seine Werke besondere Aufmerksamkeit erhalten.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Die Entstehung der Posaune, 3. Die Posaunen der Renaissance, 4. Der Einsatz der Renaissanceposaune und 5. Das Posaunenspiel in der Renaissance. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Renaissanceposaune, von ihren Vorläufern bis hin zu ihrer Verwendung in der Musik Giovanni Gabrielis.
Worum geht es in Kapitel 2 ("Die Entstehung der Posaune")?
Kapitel 2 verfolgt die Entwicklung der Posaune von ihren frühen Vorformen bis zur Erfindung des U-förmigen Zuges. Es werden verschiedene Entwicklungsstufen und mögliche Entstehungsorte (Burgund und Nürnberg) diskutiert und die technischen Innovationen, die zur Entstehung des modernen Posaunenkonzeptes führten, beleuchtet.
Was sind die klangbestimmenden Faktoren der Renaissanceposaune (Kapitel 3)?
Kapitel 3 beschreibt detailliert die klangbestimmenden Faktoren der Renaissanceposaune: Schallstück, Mensur, Mundstück und die verwendeten Materialien. Es hebt den Unterschied zur modernen Posaune hervor und betont die Bedeutung der handwerklichen Aspekte für den Klang der Instrumente.
Wie wurde die Renaissanceposaune eingesetzt (Kapitel 4)?
Kapitel 4 untersucht den Einsatz der Posaune in verschiedenen Ensembles der Renaissance, wie instrumentalen Besetzungen (mit Zink und „alta capella“), Turmmusik und Kirchenmusik der Reformationszeit. Ein Schwerpunkt liegt auf Giovanni Gabrielis innovativem Gebrauch der Posaune in Werken wie der „Sonata pian e forte“ und seinen Canzonen.
Welche Rolle spielt Giovanni Gabrieli?
Giovanni Gabrieli spielt eine zentrale Rolle in diesem Dokument. Seine innovative Verwendung der Posaune in seinen Werken, insbesondere in der „Sonata pian e forte“ und seinen Canzonen, wird ausführlich analysiert und dient als Beispiel für den innovativen Einsatz des Instruments in der Renaissancemusik.
Was wird im Kapitel über das Posaunenspiel in der Renaissance (Kapitel 5) behandelt?
Kapitel 5 befasst sich mit den technischen Fähigkeiten und dem Reifegrad des Posaunenspiels in der Renaissance. Es untersucht den Einfluss des U-förmigen Zuges auf die chromatische Spielweise und mögliche Einschränkungen des Instrumenteneinsatzes in verschiedenen Kontexten, sowie die Entwicklung der Spieltechnik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Renaissanceposaune, Giovanni Gabrieli, Instrumentenbau, Klang, Ensemble, Spieltechnik, „Sonata pian e forte“, sacrae symphoniae, canzoni et sonate, venezianische Musik, Zugtrompete, U-förmiger Zug.
Welche Zielsetzung verfolgt dieses Dokument?
Das Dokument untersucht die Posaune in der Renaissancemusik. Ziel ist es, die Entstehung des Instruments, seine klanglichen Eigenschaften und seinen Einsatz in verschiedenen Ensembles zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet auch den technischen Reifegrad der Posaunisten der damaligen Zeit.
- Quote paper
- Robert Brix (Author), 2006, Zum Einsatz der Posaune in der Renaissancemusik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/87529