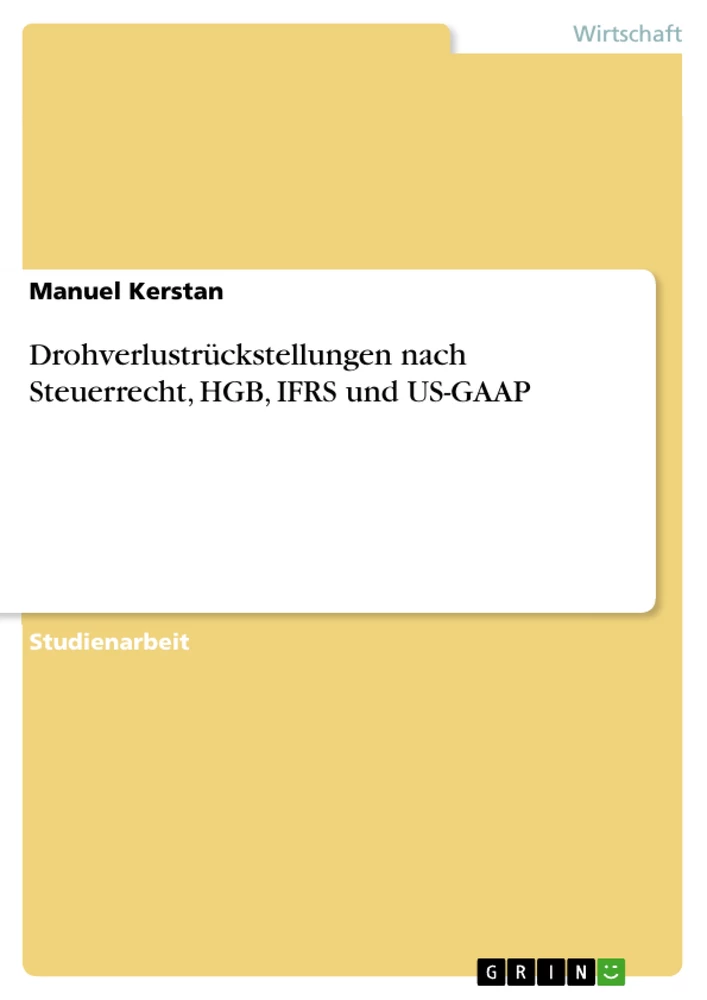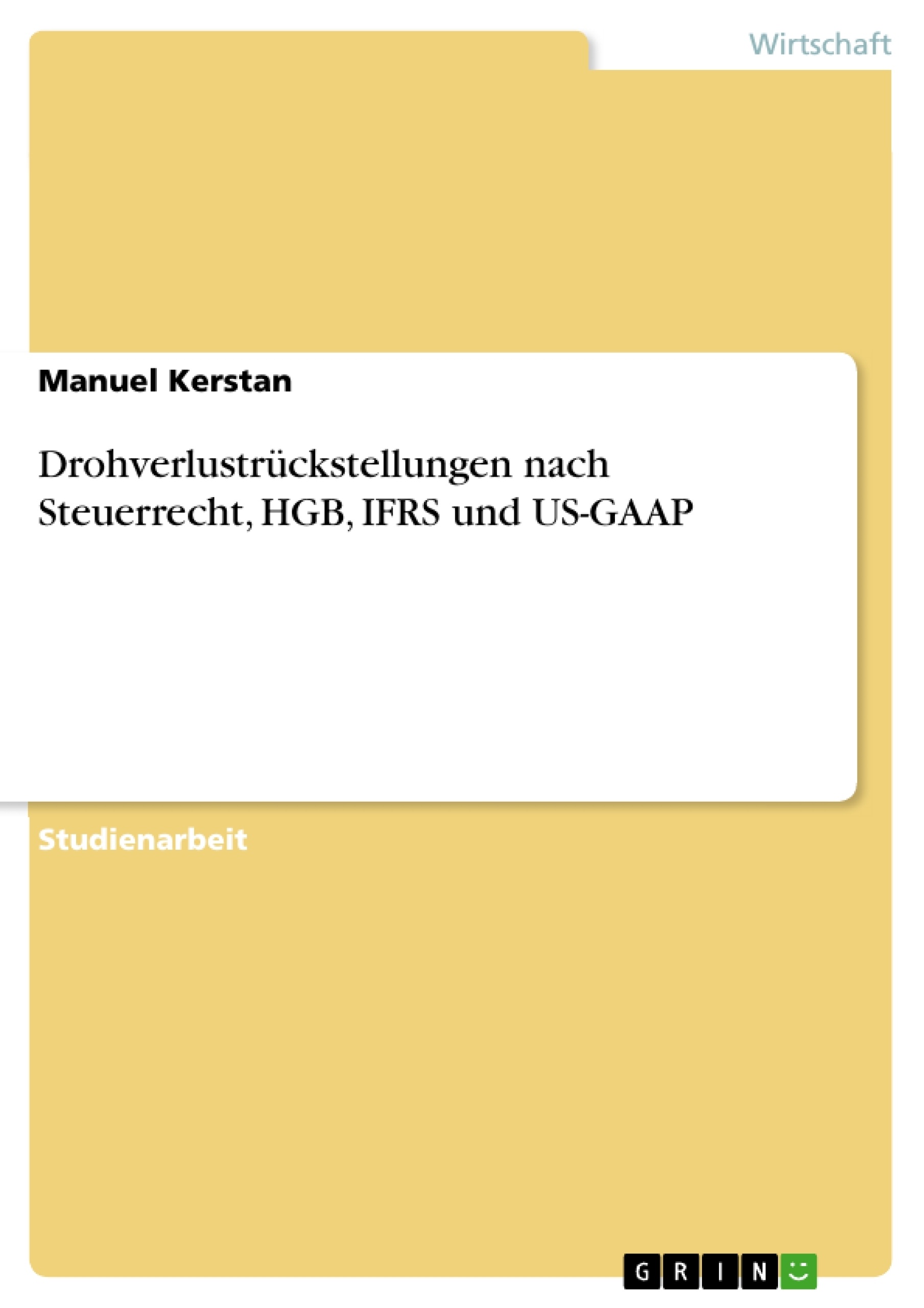Rückstellungen sind in ihren Ausprägungen sehr einflussreiche Bilanzierungsinstrumente. Durch sie können nachträgliche Ausgaben vollständig erfasst, gebuchte Erträge nachträglich richtig gestellt oder ungewisse Verbindlichkeiten, beispielsweise für drohende Verluste, wirksam passiviert werden.
Diese Arbeit hat das Ziel, insbesondere die Vorschriften der Bilanzierung von Rückstellungen drohender Verluste (nachfolgend auch "Drohverlustrückstellungen" genannt) nach Handelsrecht des HGB und den etablierten internationalen Bilanzierungsstandards IFRS/IAS und US-GAAP zu vergleichen.
Dieser Vergleich gelingt nur bei ähnlicher Struktur der Bilanzierungsregeln. Als ermittelte Schnittmenge der drei Bilanzverfahren, lassen sich die Ansatzkriterien (die sogenannte "Bilanzierung dem Grunde nach"), welche die Passivierung von Verlusten zunächst begründen müssen und die darauf abgestellten Bewertungskriterien (welche die Bilanzierung einer Rückstellung "der Höhe nach" beschränken) gegenüberstellen.
Die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden dadurch transparent dargestellt und zeigen die Ermessensspielräume auf, welche für Unternehmen im Sinne der Bilanzpolitik von Bedeutung sein könnten.
Zur besseren Veranschaulichung werden jeweils auch die rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Aspekte, aus Unternehmersicht, an einem Praxisfall exemplarisch untersucht. Zugunsten der Übersichtlichkeit des anstehenden Vergleiches, erfolgt die Behandlung einer Rückstellung für drohende Verluste nach deutschem Steuerrecht separat.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Prinzipien, Ziele und Adressaten der Bilanzierungsstandards
- 3. Ansatzkriterien für Drohverluste zur Bilanzierung dem Grunde nach
- 3.1 Die Ansatzkriterien für Drohverlustrückstellungen nach HGB
- 3.2 Die Ansatzkriterien für Drohverlustrückstellungen nach IFRS
- 3.3 Die Ansatzkriterien für Drohverlustrückstellungen nach US-GAAP
- 3.4 Die Ansatzkriterien für Drohverlustrückstellungen nach EStG
- 4. Bewertungskriterien für Drohverluste zur Bilanzierung der Höhe nach
- 4.1 Die Bewertungskriterien für Drohverlustrückstellungen nach HGB
- 4.2 Die Bewertungskriterien für Drohverlustrückstellungen (Provisions) nach IFRS
- 4.3 Die Bewertungskriterien für Drohverlustrückstellungen (Accrued Liabilities) nach US-GAAP
- 5. Schlussbetrachtungen
- Rechtssprechungsverzeichnis
- Internetverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Vorschriften zur Bilanzierung von Rückstellungen drohender Verluste nach HGB, IFRS/IAS und US-GAAP. Der Fokus liegt auf den Ansatz- und Bewertungskriterien dieser Rückstellungen. Der Vergleich soll Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzeigen und die Ermessensspielräume für Unternehmen transparent machen. Ein Praxisfall dient der Veranschaulichung. Die Bilanzierung nach deutschem Steuerrecht wird separat behandelt.
- Vergleich der Bilanzierung von Drohverlustrückstellungen nach HGB, IFRS/IAS und US-GAAP
- Analyse der Ansatzkriterien für Drohverlustrückstellungen
- Untersuchung der Bewertungskriterien für Drohverlustrückstellungen
- Aufzeigen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Bilanzierungsstandards
- Exemplarische Untersuchung eines Praxisfalls
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Rückstellungen als einflussreiche Bilanzierungsinstrumente ein und beschreibt das Ziel der Arbeit: einen Vergleich der Bilanzierung von Drohverlustrückstellungen nach HGB, IFRS/IAS und US-GAAP. Es wird die Methodik des Vergleichs anhand von Ansatz- und Bewertungskriterien erläutert und die separate Behandlung der steuerrechtlichen Aspekte angekündigt. Die Einleitung betont die Bedeutung des Verständnisses der Gemeinsamkeiten und Unterschiede für die Unternehmensbilanzpolitik.
2. Prinzipien, Ziele und Adressaten der Bilanzierungsstandards: Dieses Kapitel (welches im vorliegenden Auszug fehlt) würde voraussichtlich die grundlegenden Prinzipien, Ziele und Adressaten der drei Bilanzierungsstandards (HGB, IFRS, US-GAAP) vorstellen und die jeweiligen Unterschiede in den zugrundeliegenden Philosophien hervorheben. Es würde wahrscheinlich den Kontext für den späteren Vergleich der Drohverlustrückstellungen schaffen, indem es die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen der jeweiligen Standards beleuchtet.
3. Ansatzkriterien für Drohverluste zur Bilanzierung dem Grunde nach: Dieses Kapitel analysiert die Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ein drohender Verlust überhaupt als Rückstellung in der Bilanz ausgewiesen wird. Es vergleicht die jeweiligen Regelungen nach HGB, IFRS, US-GAAP und EStG. Der Vergleich würde sich auf die Wahrscheinlichkeit des Verlustes, die Zuverlässigkeit der Schätzung und die Unterscheidung zwischen möglichen und wahrscheinlichen Verlusten konzentrieren. Die Kapitel 3.1 bis 3.4 würden die jeweiligen spezifischen Anforderungen der einzelnen Standards detailliert darstellen und ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten hervorheben.
4. Bewertungskriterien für Drohverluste zur Bilanzierung der Höhe nach: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, wie hoch eine erkannte Drohverlustrückstellung in der Bilanz anzusetzen ist. Es vergleicht die Bewertungskriterien nach HGB, IFRS und US-GAAP. Hierbei würden die unterschiedlichen Methoden zur Schätzung des erwarteten Verlustbetrags im Mittelpunkt stehen. Die Kapitel 4.1 bis 4.3 würden die jeweiligen Bewertungsansätze detailliert erläutern und die Auswirkungen auf die Bilanzierung veranschaulichen. Der erwähnte Praxisfall würde in diesem Kapitel konkrete Beispiele liefern und die Anwendung der verschiedenen Bewertungsmethoden illustrieren.
Schlüsselwörter
Drohverlustrückstellungen, HGB, IFRS, US-GAAP, EStG, Bilanzierung, Ansatzkriterien, Bewertungskriterien, Wahrscheinlichkeit, Schätzung, Ermessensspielraum, Bilanzpolitik, Praxisfall.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der Bilanzierung von Drohverlustrückstellungen nach HGB, IFRS/IAS und US-GAAP
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Vorschriften zur Bilanzierung von Rückstellungen drohender Verluste nach HGB, IFRS/IAS und US-GAAP. Der Fokus liegt auf den Ansatz- und Bewertungskriterien dieser Rückstellungen. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und die Ermessensspielräume für Unternehmen transparent zu machen. Die Bilanzierung nach deutschem Steuerrecht wird separat behandelt.
Welche Bilanzierungsstandards werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die drei Hauptstandards HGB (Handelsgesetzbuch), IFRS (International Financial Reporting Standards) und US-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Der Vergleich umfasst sowohl die Ansatz- als auch die Bewertungskriterien für Drohverlustrückstellungen.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Die Arbeit ist strukturiert in Kapitel, die sich mit folgenden Themen befassen: Einleitung, Prinzipien und Ziele der Bilanzierungsstandards, Ansatzkriterien für Drohverluste nach HGB, IFRS, US-GAAP und EStG, Bewertungskriterien für Drohverluste nach HGB, IFRS und US-GAAP, und Schlussbetrachtungen. Ein Praxisfall dient der Veranschaulichung.
Was sind die Ansatzkriterien für Drohverlustrückstellungen?
Das Kapitel zu den Ansatzkriterien analysiert die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein drohender Verlust überhaupt als Rückstellung in der Bilanz ausgewiesen wird. Der Vergleich konzentriert sich auf die Wahrscheinlichkeit des Verlustes, die Zuverlässigkeit der Schätzung und die Unterscheidung zwischen möglichen und wahrscheinlichen Verlusten nach HGB, IFRS, US-GAAP und EStG.
Was sind die Bewertungskriterien für Drohverlustrückstellungen?
Das Kapitel zu den Bewertungskriterien behandelt die Frage, wie hoch eine erkannte Drohverlustrückstellung anzusetzen ist. Verglichen werden die Bewertungskriterien nach HGB, IFRS und US-GAAP, mit Fokus auf die unterschiedlichen Methoden zur Schätzung des erwarteten Verlustbetrags. Ein Praxisfall veranschaulicht die Anwendung der verschiedenen Bewertungsmethoden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Drohverlustrückstellungen, HGB, IFRS, US-GAAP, EStG, Bilanzierung, Ansatzkriterien, Bewertungskriterien, Wahrscheinlichkeit, Schätzung, Ermessensspielraum, Bilanzpolitik, Praxisfall.
Wie wird der Vergleich der Bilanzierungsstandards durchgeführt?
Der Vergleich der Bilanzierungsstandards erfolgt durch eine systematische Analyse der Ansatz- und Bewertungskriterien für Drohverlustrückstellungen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden herausgearbeitet, um die Ermessensspielräume für Unternehmen transparent zu machen.
Wird ein Praxisfall behandelt?
Ja, ein Praxisfall dient der Veranschaulichung der Anwendung der verschiedenen Ansatz- und Bewertungskriterien in der Praxis.
Wie wird die steuerrechtliche Bilanzierung behandelt?
Die steuerrechtliche Bilanzierung nach deutschem Steuerrecht (EStG) wird separat von den handelsrechtlichen Standards (HGB, IFRS, US-GAAP) behandelt.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Kaufmann Manuel Kerstan (Autor:in), 2006, Drohverlustrückstellungen nach Steuerrecht, HGB, IFRS und US-GAAP, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/87258