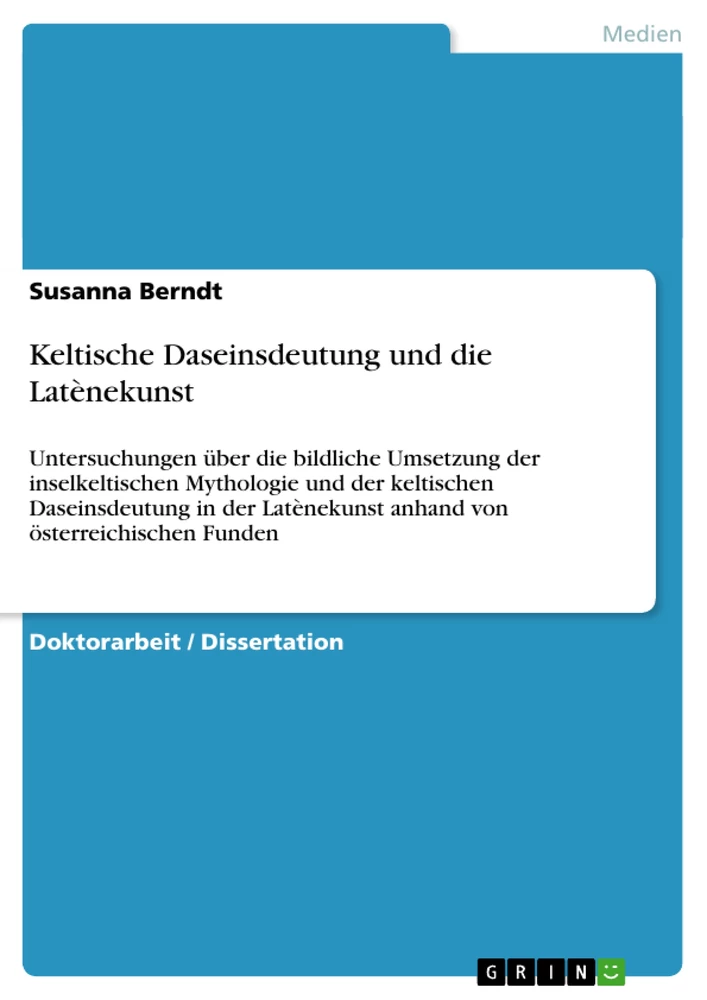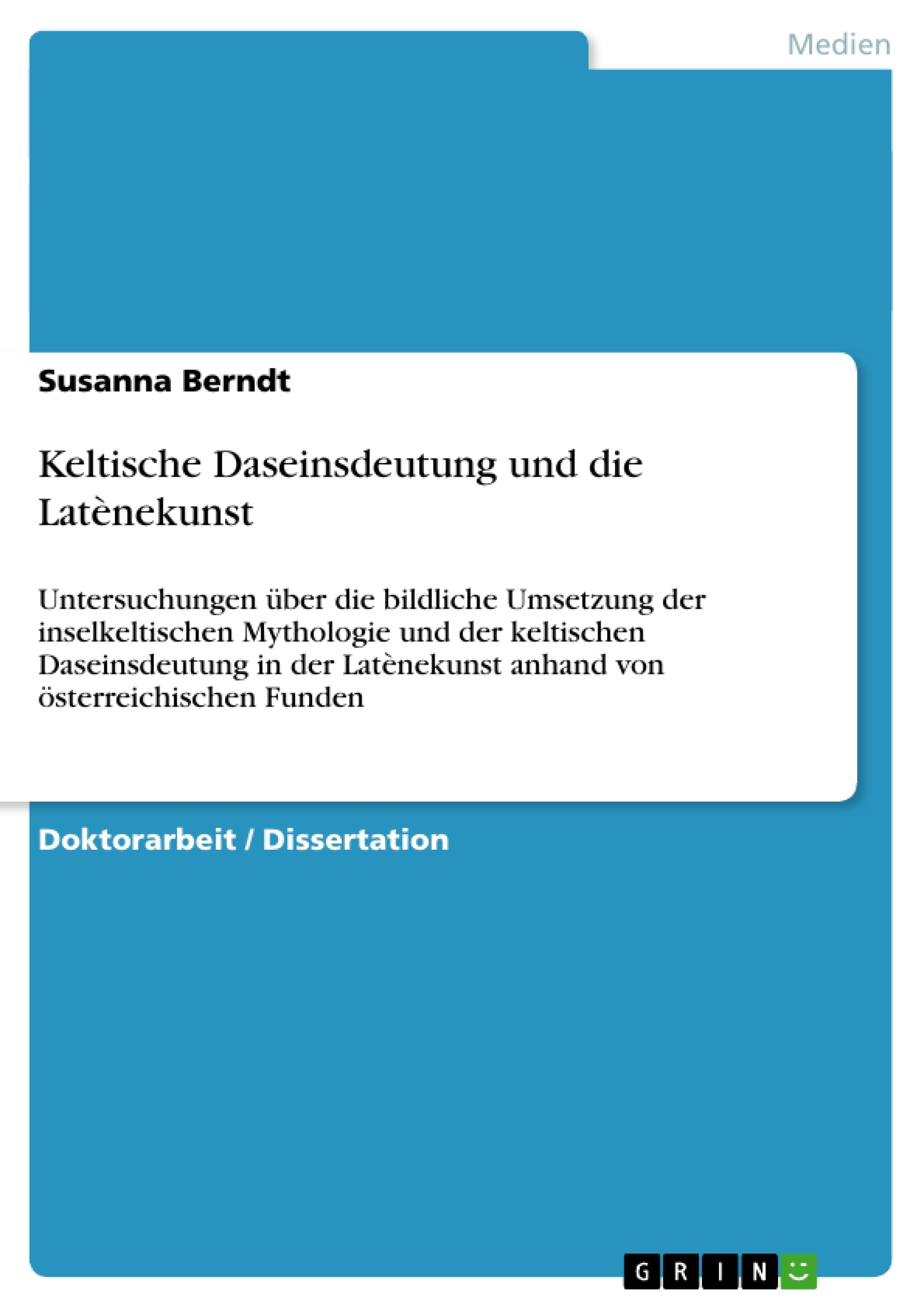Die folgende Arbeit gibt einen Einblick in die geistigen Vorstellungen der keltischen Bevölkerung Österreichs von der Mitte bis gegen Ende des ersten vorchristlichen Jahrtausends. Mit Hilfe ihrer Darstellungen und Symbole konnten durch einen Vergleich mit jenen auf archäologischen Funden aus besser dokumentierten keltischen Siedlungsgebieten, aber auch durch das Einbeziehen antiker Überlieferungen sowie der inselkeltischen Mythologie neue Erkenntnisse über ihre Daseinsdeutung und mythischen Ansichten gewonnen werden.
Im Rahmen dieser Arbeit war es nur möglich auf die keltischen Funde aus der Latènezeit näher einzugehen, obwohl viele der in der Latènekunst verwendeten Motive bereits auf Werken der Urnenfelder- und Hallstattkultur abgebildet worden waren und es zu untersuchen wäre, ob die Träger dieser vorangegangenen Kulturen nicht bereits ähnliche religiöse Vorstellungen sowie Mythen hatten und somit als „Kelten“ zu bezeichnen sind.
Der erste Teil beginnt mit einer Beschreibung der Wesenszüge und Fremdeinflüsse der Latènekunst und beinhaltet eine chronologische Einteilung ihrer Kunststile. Daran schließt ein Kapitel über die keltische Daseinsdeutung an. Die Beschreibungen keltischer Gottheiten, Jenseitsvorstellungen und Kulthandlungen beziehen sich sowohl auf die Literatur antiker Schriftsteller, die Mythen der Inselkelten als auch auf moderne Forschungsergebnisse. Der erste Teil schließt mit einer Zusammenfassung der keltischen Mythologie ab.
Der zweite Teil geht auf die Fundsituation verschiedener Gebiete im heutigen österreichischen Raum während der Latènezeit ein. Es folgt eine Analyse ausgewählter Latènefunde, deren Formen oder Verzierungen Aufschluss über die geistigen Vorstellungen der Bevölkerung geben können.
Es war übersichtlicher, die Funde nicht nach ihren Kunststilen in chronologischer Reihenfolge anzuführen, sondern bestimmte Themen und Bildinhalten aus der keltischen Mythologie und Daseinsdeutung herauszuarbeiten und Beispiele für ihre Verwendung im österreichischen Raum anzuführen. Durch Vergleiche dieser Themen mit antiken und inselkeltischen Überlieferungen konnte eine Interpretation des gedanklichen Hintergrundes der Darstellungen unternommen werden. Letztendlich sei darauf hingewiesen, dass die Erforschung einer prähistorischen Kultur nur erfolgreich sein kann, wenn die Ergebnisse der Studien aus allen Bereichen der Geistes- und Naturwissenschaften zu gemeinsamen Thesen führen.
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Einleitung
- ERSTER TEIL
- I. DIE LATÈNEKUNST
- I.1. Einführung
- I.2. Allgemeines über das Kunsthandwerk
- I.2.1. Die Verzierungsgegenstände
- I.2.2. Das Material
- I.2.3. Die Verarbeitungs- und Verzierungstechniken
- I.3. Keltische Münzen
- I.4. Die Einflüsse
- I.4.1. Orientalische Einflüsse
- I.4.2. Mediterrane Einflüsse
- I.4.3. Skythen und Thraker
- I.4.4. Die Hallstattkultur
- I.4.5. Die Situlenkunst
- I.5. Über die Entstehung der Latènekunst
- I.6. Die Kunststile während der Latènezeit
- I.6.1. Der Frühe Stil
- I.6.1.1. Die ersten Werke
- I.6.1.2. Enge Beziehungen zu den Mittelmeerkulturen während der Frühlatènezeit
- I.6.1.3. Das „Fürstengrab“ von Kleinaspergle
- I.6.1.4. Das „Fürstengrab“ von Reinheim
- I.6.1.5. Der Goldschmuck aus Erstfeld
- I.6.2. Der Waldalgesheimer Stil
- I.6.3. Der Plastische Stil
- I.6.4. Die Zeit der Oppida
- I.6.5. Die Schwerter
- II. DIE KELTISCHE DASEINSDEUTUNG
- II.1. Das Quellenmaterial
- II.1.1. Keltische Aufzeichnungen
- II.1.2. Archäologische Funde
- II.1.3. Berichte und Erwähnungen bei antiken Autoren
- II.1.4. Ethnologie, Mythenvergleiche, Linguistische Auswertungen und Etymologien
- II.1.5. Inselkeltische Handschriften
- II.1.6. Brauchtum und Volksglaube
- II.2. Untersuchungen über die keltische Weltdeutung
- II.3. Die Druiden
- II.4. Über die „Lehre“ der Druiden
- II.4.1. Über schamanistische Elemente in der keltischen Daseinsdeutung
- II.4.2. Opferriten und Kopfjagd
- II.5. Der Naturkult
- II.5.1. Der Fruchtbarkeitskult
- II.5.2. Pflanzenkunde
- II.5.3. Heilige Tiere
- II.5.3.1. Die Schlange
- II.5.3.2. Der Hirsch
- II.5.3.3. Das Rind
- II.5.3.4. Das Pferd
- II.5.3.5. Das Schwein
- II.5.3.6. Der Vogel
- II.5.3.7. Der Hund
- II.6. Untersuchungen über die Keltische Götterwelt
- II.7. Gottheiten mit römischen Namen
- II.7.1. Der keltische Mercurius
- II.7.2. Der keltische Apollo
- II.7.3. Der keltische Mars
- II.7.4. Der keltische Jupiter
- II.7.5. Die keltische Minerva
- II.7.6. Der keltische Dis Pater
- II.8. Männliche Gottheiten mit keltischen Namen
- II.8.1. Taranis
- II.8.2. Teutates
- II.8.3. Esus
- II.8.4. Cernunnos
- II.8.5. Sucellos
- II.8.6. Belenus und Grannus
- II.8.7. Smertrius
- II.8.8. Ogmios
- II.9. Weibliche Gottheiten
- II.9.1. Epona
- II.9.2. Rosmerta
- II.9.3. Weibliche Gottheiten der Natur und der Himmelskörper
- II.10. In der inselkeltischen Mythologie genannte Götter
- II.10.1 Der irische Dagda
- II.10.2. Der irische Aengus mac Oc
- II.10.3. Die irische Brigit
- II.10.4. Der irische Midyr
- II.10.5. Der irische Diancecht
- II.10.6. Der irische Balor
- II.10.7. Der irische Bress
- II.10.8. Die irische Dana/Ana - kymrische Don
- II.10.9. Der irische Manannan mac Lir - kymrische Manawyddan
- II.10.10. Der irische Lugh - kymrische Gwyddion
- II.10.11. Der irische Goibniu - kymrische Govannon
- II.10.12. Der irische Nuada - kymrische Nudd / Llud
- II.10.13. Der kymrische Mabon mac Modron
- II.10.14. Der kymrische Bendigeidvran
- II.10.15. Der kymrische Pwyll-Arawn
- II.10.16. Die kymrische Rhiannon
- II.11. Götterdarstellungen ohne Namensnennungen
- II.11.1. Der Radgott
- II.11.2. Der Gott in der „Buddhahaltung“
- II.11.3. Der dreiköpfige Gott
- II.11.4. Der Genius Cucullatus
- II.11.5. Der Hammer- oder Schlegelgott
- II.11.6. Die Schlange mit dem Widderkopf
- III. DIE KELTISCHE MYTHOLOGIE
- III.1. Einführung
- III.1.1. Über die Bedeutung der Mythen
- III.2 Über die Bedeutung des Tieres in den inselkeltischen Mythen
- III.3. Über die inselkeltische Gesellschaft
- III.3.1. Die Stellung der Frau
- III.3.2. Das Königtum
- III.3.3. Die Priesterklasse
- III.3.4. Die Krieger
- III.3.5. Die Handwerker
- III.3.6. Die Ackerbauern und Viehzüchter
- III.4. Die irischen Mythen
- III.4.1. Die Besiedlung Irlands und die Kämpfe zwischen der einheimischen Bevölkerung und den Einwanderern
- III.4.2. Die erste Schlacht und ihre Folgen
- III.4.3. Die zweite Schlacht und ihre Folgen
- III.4.4. Der Kampf gegen die „Söhne des Mile“
- III.4.5. Der Rückzug in die „Andere Welt“
- III.4.5.1. Erzählungen über die „Andere Welt“
- III.4.5.2. Erzählungen über die Bewohner der „Anderen Welt“
- III.4.6. Der Sagenkreis von Ulster
- III.4.6.1. Tochmarc Etaine, „Das Werben um Etain“
- III.4.6.2. Togail bruidne ui Dergae, „Die Zerstörung der Halle von Ua Dergae“
- III.4.6.3. Scel mucce Maic Datho, „Die Geschichte vom Schwein des Mac Datho“
- III.4.6.4. Longas mac n-Uislenn, „Die Verbannung der Söhne Uisliu´s“
- III.4.6.5. Tain Bo Fraech, „Das Wegtreiben von Fraechs Rindern“
- III.4.6.6. Die Cu Chulainn-Sage
- III.4.6.6.1. CuChulainns Geburt und Jugendtaten
- III.4.6.6.2. Tochmarc Emire, „Die Werbung um Emer“
- III.4.6.6.3. Die CuRoi-Sage
- III.4.6.6.4. Fled Bricrenn, „Bricruis Gastmahl“
- III.4.6.6.5. Serglige ConCulainn ocus aemet Emire, „CuChulainns Krankenlager und Emers einzige Eifersucht“
- III.4.6.6.6. De cophur in da mucado, „Vom....der zwei Schweinehirten“
- III.4.6.6.7. Die Sidhe Macha
- III.4.6.6.8. Tain Bo Cuailnge
- Die Latènekunst und ihre Stile
- Die keltische Weltanschauung und ihre religiösen Konzepte
- Die Rolle von Mythen und Ritualen im keltischen Leben
- Die Darstellung keltischer Gottheiten in der Kunst
- Der Einfluss mediterraner und orientalischen Kulturen auf die keltische Kunst
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation untersucht die bildliche Darstellung keltischer Mythologie und Daseinsdeutung in der Latènekunst anhand österreichischer Funde. Ziel ist es, die Wechselwirkungen zwischen den kulturellen Vorstellungen der Kelten und ihrer künstlerischen Ausdrucksformen zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
I. DIE LATÈNEKUNST: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in die Latènekunst, beginnend mit einer allgemeinen Beschreibung des Kunsthandwerks, der verwendeten Materialien und Techniken. Es analysiert keltische Münzen und untersucht eingehend die Einflüsse verschiedener Kulturen, wie der orientalischen, mediterranen, skythischen, thrakischen und der Hallstattkultur, auf die Entwicklung der Latènekunst. Die Entstehung und die verschiedenen Kunststile während der Latènezeit, vom frühen Stil über den Waldalgesheimer und plastischen Stil bis hin zur Zeit der Oppida, werden detailliert beschrieben und anhand von Beispielen wie dem Fürstengrab von Kleinaspergle oder dem Goldschmuck aus Erstfeld illustriert. Die Analyse der Schwerter als wichtiges Element der Latènekunst rundet das Kapitel ab.
II. DIE KELTISCHE DASEINSDEUTUNG: Das zweite Kapitel widmet sich der Erforschung der keltischen Weltanschauung, wobei verschiedene Quellen wie keltische Aufzeichnungen, archäologische Funde, Berichte antiker Autoren und ethnologische Vergleiche herangezogen werden. Es untersucht die Rolle der Druiden und ihre „Lehre“, mit einem Fokus auf schamanistische Elemente und Opferriten. Der Naturkult, einschließlich Fruchtbarkeitskulten und der Bedeutung heiliger Tiere (Schlange, Hirsch, Rind, Pferd, Schwein, Vogel, Hund), wird detailliert analysiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der keltischen Götterwelt, wobei sowohl Gottheiten mit römischen (Mercurius, Apollo, Mars, Jupiter, Minerva, Dis Pater) als auch keltischen Namen (Taranis, Teutates, Esus, Cernunnos, Sucellos, Belenus, Grannus, Smertrius, Ogmios, Epona, Rosmerta) sowie inselkeltischen Mythen genannte Gottheiten (Dagda, Aengus mac Oc, Brigit, u.a.) untersucht und verglichen werden. Das Kapitel schließt mit einer Analyse von Götterdarstellungen ohne Namensnennung.
III. DIE KELTISCHE MYTHOLOGIE: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die inselkeltische Mythologie und deren Bedeutung. Es beleuchtet die Rolle von Tieren in den Mythen, die Struktur der inselkeltischen Gesellschaft (Stellung der Frau, Königtum, Priesterklasse, Krieger, Handwerker, Ackerbauern und Viehzüchter) und analysiert detailliert die irischen Mythen. Die Besiedlung Irlands, die Kämpfe zwischen Einheimischen und Einwanderern und der Rückzug in die „Andere Welt“ werden thematisiert. Der Sagenkreis von Ulster mit wichtigen Sagen wie „Das Werben um Etain“, „Die Zerstörung der Halle von Ua Dergae“ und die Cu Chulainn-Sage bilden den Höhepunkt dieses Kapitels. Die umfassende Darstellung der Mythen dient dazu, die keltische Weltanschauung und ihre religiösen Vorstellungen weiter zu veranschaulichen und in Verbindung zur Kunst zu setzen.
Schlüsselwörter
Keltische Latènekunst, keltische Mythologie, inselkeltische Mythen, Daseinsdeutung, Gottheiten, Naturkult, Archäologie, Österreich, Kunststile, Druiden, Symbolik, Religion, Gesellschaft, Quellenmaterial.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Dissertation: Keltische Latènekunst in Österreich
Was ist der Gegenstand der Dissertation?
Die Dissertation untersucht die bildliche Darstellung keltischer Mythologie und Daseinsdeutung in der Latènekunst anhand österreichischer Funde. Sie beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen den kulturellen Vorstellungen der Kelten und ihrer künstlerischen Ausdrucksformen.
Welche Themen werden in der Dissertation behandelt?
Die Arbeit behandelt die Latènekunst und ihre verschiedenen Stile, die keltische Weltanschauung und religiöse Konzepte, die Rolle von Mythen und Ritualen im keltischen Leben, die Darstellung keltischer Gottheiten in der Kunst und den Einfluss mediterraner und orientalischen Kulturen auf die keltische Kunst.
Welche Kapitel umfasst die Dissertation?
Die Dissertation gliedert sich in drei Hauptteile: I. DIE LATÈNEKUNST (umfassende Einführung in die Latènekunst, Material, Techniken, Einflüsse, Kunststile), II. DIE KELTISCHE DASEINSDEUTUNG (keltische Weltanschauung, Druiden, Naturkult, keltische Götterwelt mit römischen und keltischen Namen, inselkeltische Gottheiten), und III. DIE KELTISCHE MYTHOLOGIE (inselkeltische Mythologie, Rolle von Tieren, inselkeltische Gesellschaft, irische Mythen, Sagenkreis von Ulster, z.B. Cu Chulainn-Sage).
Welche Quellen werden in der Dissertation verwendet?
Die Dissertation stützt sich auf vielfältige Quellen, darunter keltische Aufzeichnungen, archäologische Funde, Berichte antiker Autoren, ethnologische Vergleiche, linguistische Auswertungen, Etymologien, inselkeltische Handschriften und Brauchtum/Volksglaube.
Welche Gottheiten werden in der Dissertation behandelt?
Die Arbeit behandelt sowohl keltische Gottheiten mit römischen Namen (Mercurius, Apollo, Mars, Jupiter, Minerva, Dis Pater) als auch Gottheiten mit keltischen Namen (Taranis, Teutates, Esus, Cernunnos, Sucellos, Belenus, Grannus, Smertrius, Ogmios, Epona, Rosmerta) und inselkeltische Gottheiten (Dagda, Aengus mac Oc, Brigit, etc.). Auch Götterdarstellungen ohne Namensnennung werden analysiert.
Welche Aspekte der keltischen Kultur werden im Detail untersucht?
Die Dissertation untersucht detailliert den Naturkult der Kelten (Fruchtbarkeitskult, heilige Tiere), die Rolle der Druiden und ihre "Lehre" (schamanistische Elemente, Opferriten), die Struktur der inselkeltischen Gesellschaft (Stellung der Frau, Königtum, Priesterklasse etc.) und die Bedeutung von Mythen und Ritualen im keltischen Alltag.
Welche konkreten Beispiele aus der Latènekunst werden genannt?
Die Arbeit analysiert unter anderem das Fürstengrab von Kleinaspergle, das Fürstengrab von Reinheim, den Goldschmuck aus Erstfeld und die keltischen Schwerter als wichtige Elemente der Latènekunst.
Welche Mythen werden im Detail behandelt?
Die Dissertation analysiert ausführlich den Sagenkreis von Ulster, einschließlich Mythen wie "Das Werben um Etain", "Die Zerstörung der Halle von Ua Dergae" und die umfangreiche Cu Chulainn-Sage mit ihren verschiedenen Episoden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Dissertation?
Schlüsselwörter sind: Keltische Latènekunst, keltische Mythologie, inselkeltische Mythen, Daseinsdeutung, Gottheiten, Naturkult, Archäologie, Österreich, Kunststile, Druiden, Symbolik, Religion, Gesellschaft, Quellenmaterial.
Für wen ist diese Dissertation relevant?
Diese Dissertation ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten, die sich mit keltischer Kultur, Archäologie, Kunstgeschichte und Religionsgeschichte beschäftigen. Die Arbeit bietet eine umfassende Analyse der keltischen Weltanschauung und ihrer künstlerischen Darstellung.
- Quote paper
- Dr. Susanna Berndt (Author), 1998, Keltische Daseinsdeutung und die Latènekunst, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/86291