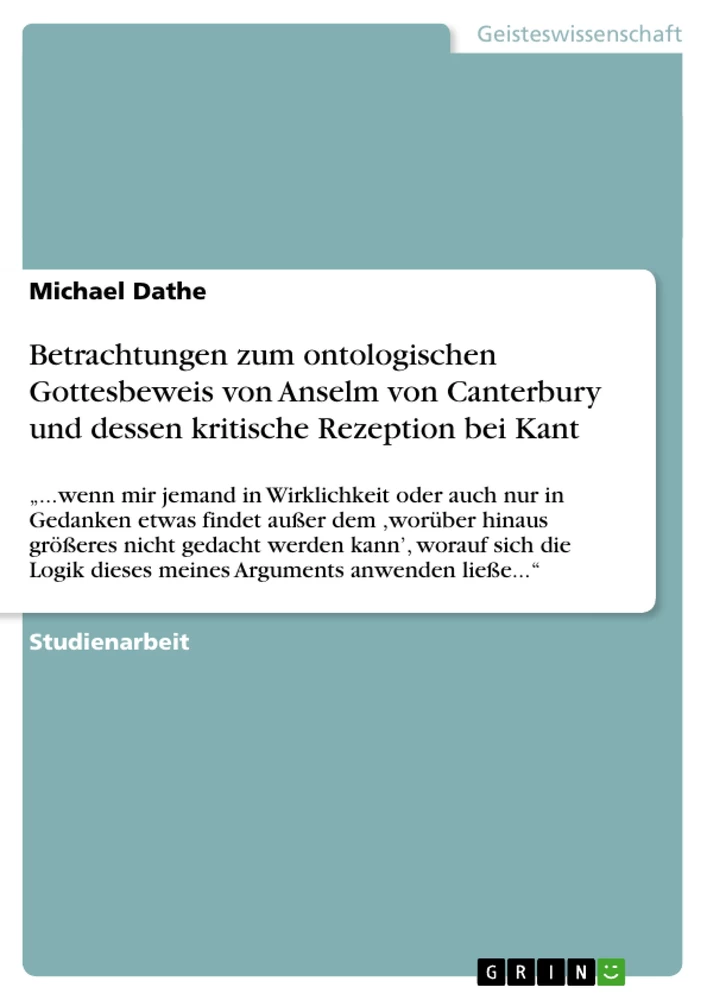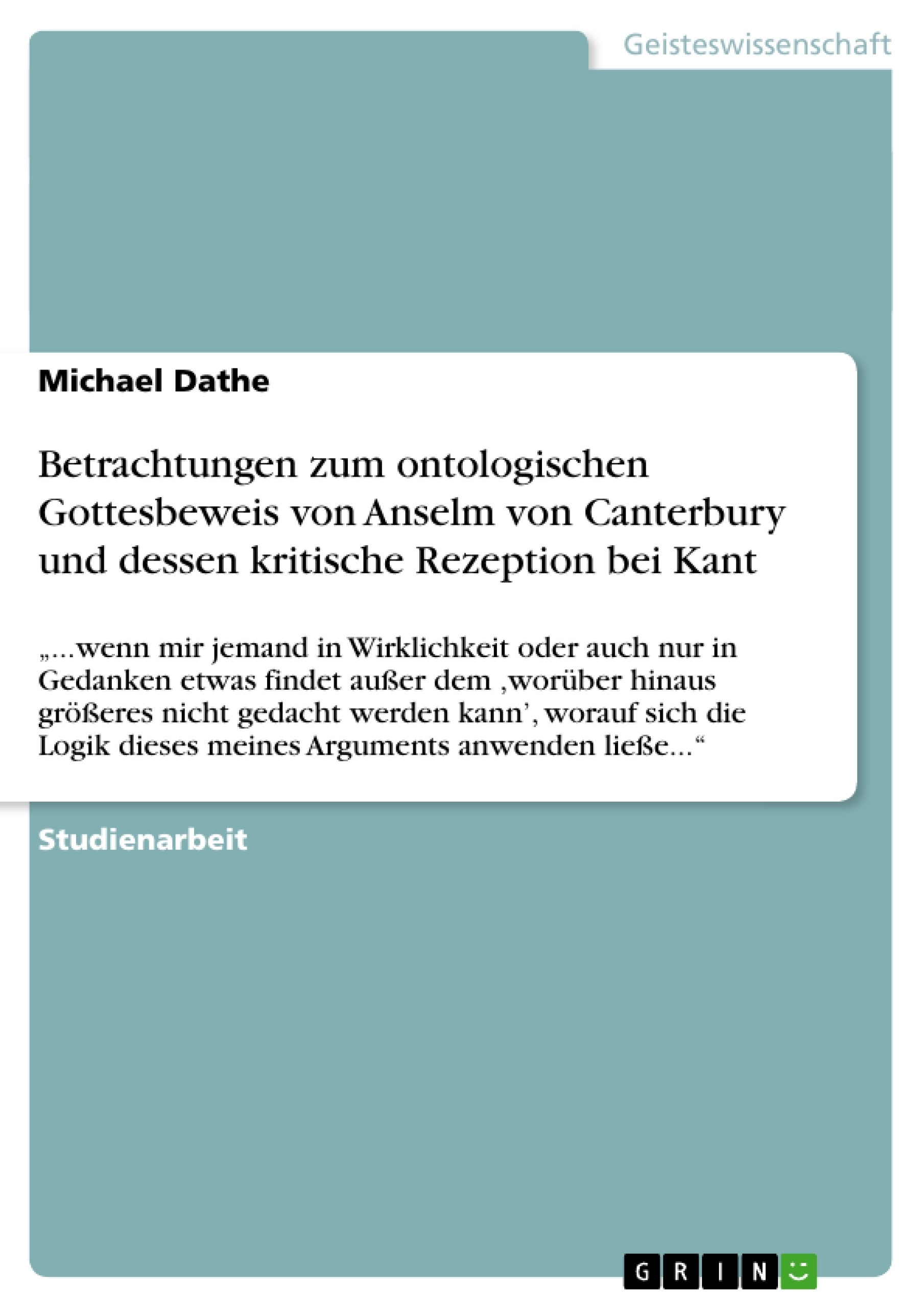1. Einleitung
Die Thematik „Gottesbeweise“ zieht eine Vielzahl an Fragen und Problematiken nach sich, welche eine vertiefende Bearbeitung dieser erschweren. Die vorliegende Arbeit stellt einen Versuch dar, sich mit einem der Gottesbeweise, nämlich dem von Immanuel Kant als „ontologischen Gottesbeweis“ bezeichneten, auseinander zu setzen.
Dabei wird zunächst der Begriff „Gottesbeweis“ definiert und anschließend der wohl bekannteste unter ihnen, der „ontologische Gottesbeweis“ bzw. das so genannte „anselmianische Argument“ mit seiner Geschichte vorgestellt. Wie der Name schon sagt, ist dieser auf Anselm von Canterbury zurückzuführen.
Zuletzt folgt ein Einblick in die Kritik Kants bezüglich des ontologischen Gottesbeweises.
Die Auswahl der beiden Philosophen unter der Vielzahl derer, die sich mit dem ontologischen Gottesbeweis beschäftigten, begründet sich auf ihre Stellung, die sie ihm bezüglich einnehmen: Anselm von Canterbury als Begründer und Immanuel Kant als schärfster Kritiker und gleichzeitig Über¬winder desselben.
Zunächst aber muss an dieser Stelle kurz auf grundsätzliche Probleme der Thematik eingegangen werden. Die Gottesbeweise an sich grenzen an zwei große Disziplinen. Zum Einen an die Theologie und die zum Anderen an die Philosophie. Am unproblematischsten lassen sie sich wohl in den Bereich der Religionsphilosophie einordnen, der philosophischen Disziplin, welche „[t]rotz aller damit verbundenen Vorbehalte [...] eine mehr oder minder reflektierte Unterscheidung zwischen dem religiösen Vollzug einerseits und der menschlichen Vernunft andererseits“ voraussetzt und sich mit diesem „religiösen Vollzug“ eben auf Basis „der menschlichen Vernunft“ auseinandersetzt.
Des Weiteren hat die uralte Frage nach Gott und somit die Suche nach Gottesbeweisen besonders durch die Aufklärung an Bedeutung verloren. Sie zählt nicht mehr zu den existentiellen Fragen der Menschheit, aber sie steht trotzdem nach wie vor im Interesse der Geisteswissenschaften. Gerade der ontologische Beweis hat innerhalb seiner bald tausendjährigen Existenz zahlreiche Angriffe und Kritiken überdauert und geriet niemals endgültig ins Abseits. Auch heute setzen sich immer wieder Religionsphilosophen mit ihm auseinander. Aus diesem Grund erscheint eine nähere Auseinandersetzung mit dem ontologischen Gottesbeweis im Rahmen einer Hausarbeit als eine durchaus interessante Herausforderung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Begriff „Gottesbeweis“
- 3. Der ontologische Gottesbeweis nach Anselm von Canterbury
- 3.1 Zur Person Anselm von Canterbury
- 3.2 Der ontologische Gottesbeweis
- 3.2.1 Zur Entstehung des Gottesbeweises
- 3.2.2 Gottesbeweise in der Schrift „Monologion“
- 3.2.3 Der Gottesbeweis in der Schrift „Proslogion“
- 3.3 Zur Rezeption des ontologischen Gottesbeweises
- 4. Immanuel Kants Kritik am ontologischen Gottesbeweis
- 4.1 Zur Person Immanuel Kants
- 4.2 Kants Kritik
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den ontologischen Gottesbeweis, insbesondere dessen Entstehung bei Anselm von Canterbury und dessen kritische Rezeption durch Immanuel Kant. Sie beleuchtet die beiden Philosophen als zentrale Figuren in der Geschichte dieses bedeutenden Arguments. Die Arbeit strebt nach einem verständlichen Überblick über den ontologischen Gottesbeweis und die zentralen Punkte der Kritik Kants.
- Der Begriff des Gottesbeweises und seine verschiedenen Arten
- Anselms ontologischer Gottesbeweis und seine philosophischen Grundlagen
- Die Entstehung und Entwicklung des ontologischen Gottesbeweises
- Kants Kritik am ontologischen Gottesbeweis und seine Argumentationslinien
- Die Bedeutung des ontologischen Gottesbeweises für die Religionsphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Gottesbeweise ein und erläutert die Herausforderungen ihrer Erforschung. Sie begründet die Auswahl von Anselm von Canterbury und Immanuel Kant als zentrale Figuren für die Untersuchung des ontologischen Gottesbeweises – Anselm als Begründer und Kant als dessen schärfster Kritiker. Die Einleitung hebt die Bedeutung des ontologischen Gottesbeweises in der Religionsphilosophie hervor, trotz des Rückgangs an Bedeutung existentieller Fragen nach Gott durch die Aufklärung. Die Arbeit positioniert sich somit innerhalb des Diskurses der Religionsphilosophie, der die Vernunft und den religiösen Vollzug in Beziehung setzt.
2. Zum Begriff „Gottesbeweis“: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Gottesbeweis“ und differenziert zwischen aposteriorischen und apriorischen Gottesbeweisen. Es diskutiert die scheinbare Diskrepanz zwischen rationalen Gottesbeweisen und dem im Wesentlichen irrationalen Charakter religiösen Glaubens, verweist aber gleichzeitig auf die historische Rationalisierung religiöser Überzeugungen. Der ontologische Gottesbeweis wird im Kontext der scholastischen Philosophie und dem Versuch der Versöhnung von Vernunft und Glauben positioniert. Das Kapitel beleuchtet auch die unterschiedlichen Arten von Gottesbeweisen und ihre historische Entwicklung und Bedeutung. Es endet mit der Erwähnung der Wende durch Kants Kritik und dem andauernden Interesse an Gottesbeweisen in der Religionsphilosophie.
3. Der ontologische Gottesbeweis nach Anselm von Canterbury: Dieses Kapitel befasst sich mit Anselm von Canterbury, seinem Leben und seiner Bedeutung für die christliche Philosophie, insbesondere als „Vater der Scholastik“. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung und Erklärung seines ontologischen Gottesbeweises, der Entstehung und der Rezeption in der Geschichte der Philosophie. Die verschiedenen Versionen des Beweises in Anselms Schriften „Monologion“ und „Proslogion“ werden angesprochen, ohne jedoch detailliert auf deren Unterschiede einzugehen. Der Fokus liegt auf der Gesamtheit des Anselmischen Arguments und seiner Bedeutung als Grundlage für spätere Diskussionen und Kritiken.
4. Immanuel Kants Kritik am ontologischen Gottesbeweis: Dieses Kapitel widmet sich Immanuel Kant, seinem Leben und Werk. Die Hauptpunkte von Kants Kritik am ontologischen Gottesbeweis werden detailliert dargelegt. Das Kapitel analysiert Kants Argumentation, wie er die Gültigkeit des Beweises durch seine transzendentale Ästhetik und Logik widerlegt, ohne dabei spezifische Unterkapitel einzeln zu referenzieren. Der Fokus bleibt auf der Gesamtheit von Kants Kritik und ihrer Bedeutung für die spätere Philosophie.
Schlüsselwörter
Ontologischer Gottesbeweis, Anselm von Canterbury, Immanuel Kant, Religionsphilosophie, Gottesbeweise, Apriorische und Aposteriorische Beweise, Scholastik, Kritik der reinen Vernunft, Vernunft und Glaube.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum ontologischen Gottesbeweis
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über den ontologischen Gottesbeweis, insbesondere dessen Entstehung bei Anselm von Canterbury und die Kritik durch Immanuel Kant. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzungserläuterung, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Gottesbeweises, seiner philosophischen Grundlagen und der Auseinandersetzung mit Kants Kritik.
Wer sind die zentralen Figuren in diesem Text?
Die zentralen Figuren sind Anselm von Canterbury, der den ontologischen Gottesbeweis entwickelte, und Immanuel Kant, der diesen Beweis kritisch hinterfragte. Der Text beleuchtet Leben und Werk beider Philosophen im Kontext ihrer Auseinandersetzung mit dem Gottesbeweis.
Was ist der ontologische Gottesbeweis?
Der Text erklärt den ontologischen Gottesbeweis als ein apriorisches Argument für die Existenz Gottes. Er geht auf Anselms Argumentation in seinen Schriften "Monologion" und "Proslogion" ein, ohne jedoch in detaillierte Unterschiede zwischen den Versionen einzutauchen. Der Fokus liegt auf dem Kernargument und seiner Bedeutung für die Philosophiegeschichte.
Wie kritisiert Kant den ontologischen Gottesbeweis?
Der Text beschreibt Kants Kritik am ontologischen Gottesbeweis, ohne einzelne Unterkapitel von Kants Argumentation explizit zu nennen. Es wird jedoch deutlich gemacht, dass Kant den Beweis mithilfe seiner transzendentalen Ästhetik und Logik widerlegt. Der Text konzentriert sich auf das Gesamtbild von Kants Kritik und deren Einfluss auf die Philosophie.
Welche Arten von Gottesbeweisen werden unterschieden?
Der Text unterscheidet zwischen aposteriorischen und apriorischen Gottesbeweisen. Er diskutiert die scheinbare Diskrepanz zwischen rationalen Gottesbeweisen und dem religiösen Glauben und positioniert den ontologischen Gottesbeweis im Kontext der scholastischen Philosophie und dem Versuch, Vernunft und Glauben zu versöhnen.
Welche Bedeutung hat der ontologische Gottesbeweis für die Religionsphilosophie?
Der Text betont die Bedeutung des ontologischen Gottesbeweises für die Religionsphilosophie, obwohl die existentiellen Fragen nach Gott durch die Aufklärung an Bedeutung verloren haben. Er positioniert seine Untersuchung innerhalb des Diskurses der Religionsphilosophie, der die Vernunft und den religiösen Vollzug in Beziehung setzt.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Zum Begriff „Gottesbeweis“, Der ontologische Gottesbeweis nach Anselm von Canterbury, Immanuel Kants Kritik am ontologischen Gottesbeweis und Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Die Schlüsselwörter sind: Ontologischer Gottesbeweis, Anselm von Canterbury, Immanuel Kant, Religionsphilosophie, Gottesbeweise, Apriorische und Aposteriorische Beweise, Scholastik, Kritik der reinen Vernunft, Vernunft und Glaube.
- Quote paper
- Michael Dathe (Author), 2007, Betrachtungen zum ontologischen Gottesbeweis von Anselm von Canterbury und dessen kritische Rezeption bei Kant, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/85794