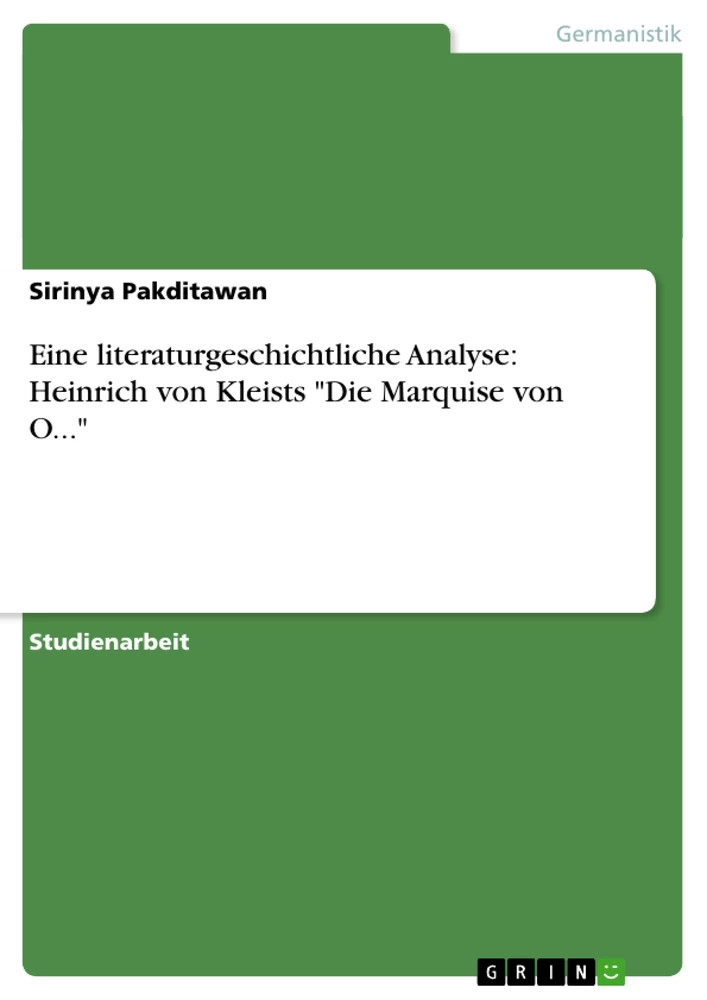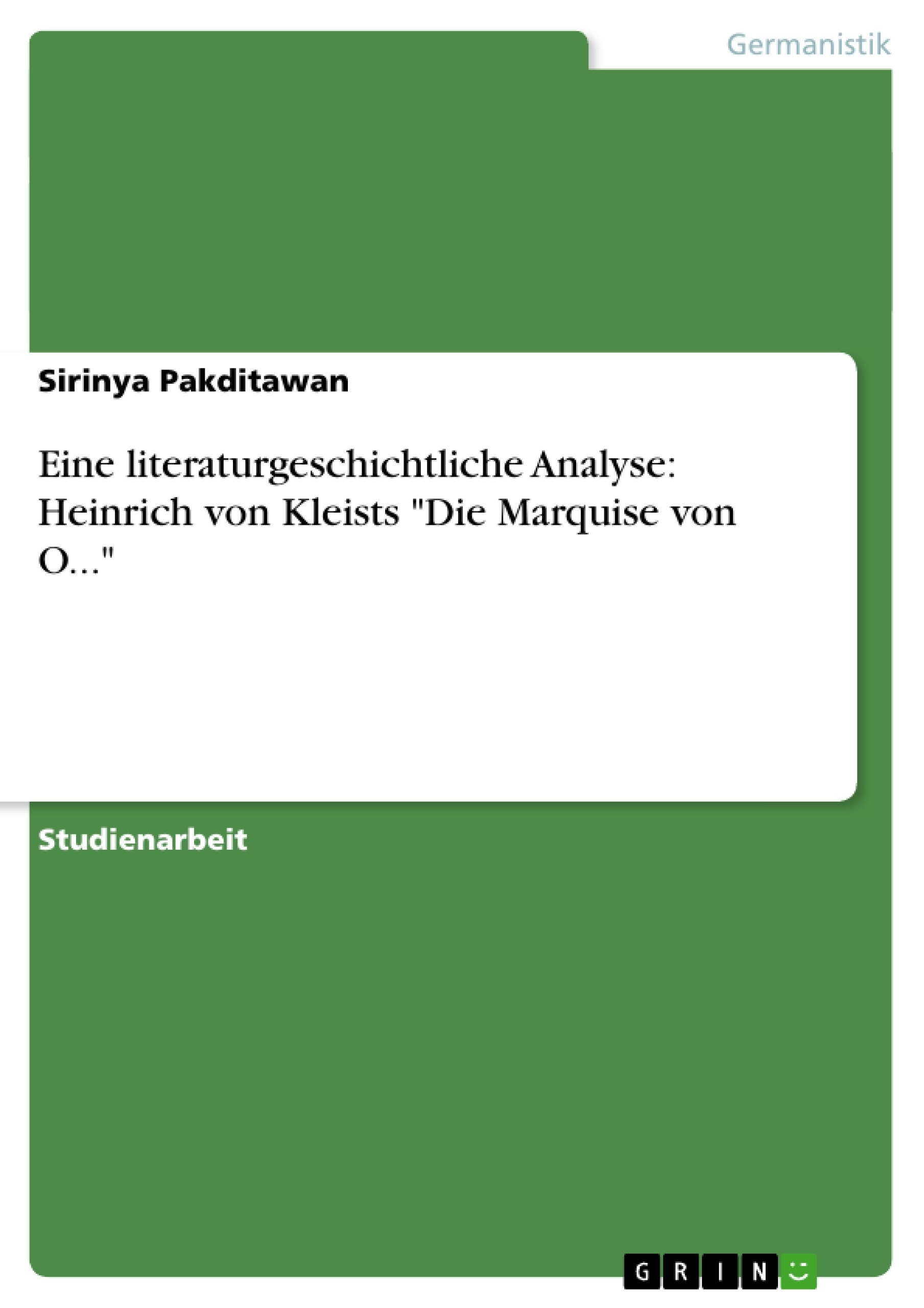Heinrich von Kleists Fragestellungen wurden im Wesentlichen durch die Aufklärung des 18. Jahrhunderts und durch den krisenhaften Umbruch, der seit der Französischen Revolution Europa erfasste, geprägt. Hierbei kann Kleist sowohl als Vertreter der Aufklärung als auch der Romantik angesehen werden, denn er mutete sich eine „Aufklärung [zu], ohne die romantischen Bedürfnisse des menschlichen Herzens zu verkennen oder gar zu missachten.“
Auf diese Weise setzte sich Kleist kritisch mit der Romantik auseinander. Mit anderen Worten, er verwendete in seinem Werk zwar Elemente der Romantik, jedoch analysierte er sie psychologisch und historisch aus einem aufgeklärten Geist heraus. So zeigt seine Erzählung „Die Marquise von O…“ zwar romantische Züge, jedoch sind auch eindeutig aufklärerische Tendenzen enthalten.
Diese Erzählung ist einerseits romantisch, da Gefühle die Menschen oft sprachlos machen. So sind Leichenblässe, Erröten, Ohnmachten und Schweigen beredte, wenn auch stumme Zeugen. Darüber hinaus zeigt Kleist auch Ambivalenzen in den Figuren, in der Handlung und die höchsten subjektiven Empfindungen. Dies sind allesamt eindeutig romantische Züge. Andererseits wird bei ihm der Leser aber durch den unzuverlässigen Erzähler zum Selbstdenken verleitet, was der Erfüllung einer zentralen aufklärerischen Forderung nahe kommt.
Im Folgenden wird eine literaturgeschichtliche Analyse der „Marquise von O…“ geleistet und dabei untersucht, inwiefern diese Erzählung zwischen Aufklärung und Romantik angesiedelt werden kann. Zunächst wird die aufklärerische Funktion der unzuverlässigen Erzählinstanz betrachtet werden und anschließend auf Gefühl und Sprachlosigkeit als romantische Elemente eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Die Marquise von O...“ zwischen Aufklärung und Romantik
- Die aufklärerische Funktion der unzuverlässigen Erzählinstanz
- Gefühl und Sprachlosigkeit als romantische Elemente
- Zusammenfassung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Analyse untersucht die literarische Einordnung von Heinrich von Kleists Erzählung „Die Marquise von O...“ im Kontext der Aufklärung und Romantik. Die Arbeit beleuchtet, wie Kleist in seinem Werk Elemente beider Epochen aufgreift und miteinander verwebt. Dabei werden die spezifischen Merkmale der Aufklärung und Romantik anhand der Erzählstruktur, der Figuren und der Themen der Erzählung analysiert.
- Die Funktion der unzuverlässigen Erzählinstanz in der Aufklärung
- Die Rolle von Gefühl und Sprachlosigkeit in der Romantik
- Die Ambivalenz der Figuren und Handlungen
- Die kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen
- Die Bedeutung des Lesers als aktiver Interpret
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über Heinrich von Kleists literarisches Schaffen im Kontext der Aufklärung und Romantik. Sie stellt heraus, dass Kleists Werke sowohl aufklärerische als auch romantische Elemente aufweisen. Anschließend wird der Fokus auf die Erzählung „Die Marquise von O...“ gerichtet und die wichtigsten Themen und Aspekte vorgestellt.
Das erste Kapitel untersucht die aufklärerische Funktion der unzuverlässigen Erzählinstanz in der Erzählung. Die Analyse zeigt, wie der Erzähler den Leser zum Selbstdenken und zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Geschehen anregt. Es werden Beispiele aus dem Text herangezogen, die die unzuverlässige Erzählweise verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Analyse sind: Aufklärung, Romantik, Heinrich von Kleist, „Die Marquise von O...“, Erzählinstanz, Unzuverlässigkeit, Gefühl, Sprachlosigkeit, Ambivalenz, Gesellschaftliche Normen, Leserrezeption.
- Quote paper
- Sirinya Pakditawan (Author), 2003, Eine literaturgeschichtliche Analyse: Heinrich von Kleists "Die Marquise von O...", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/85652