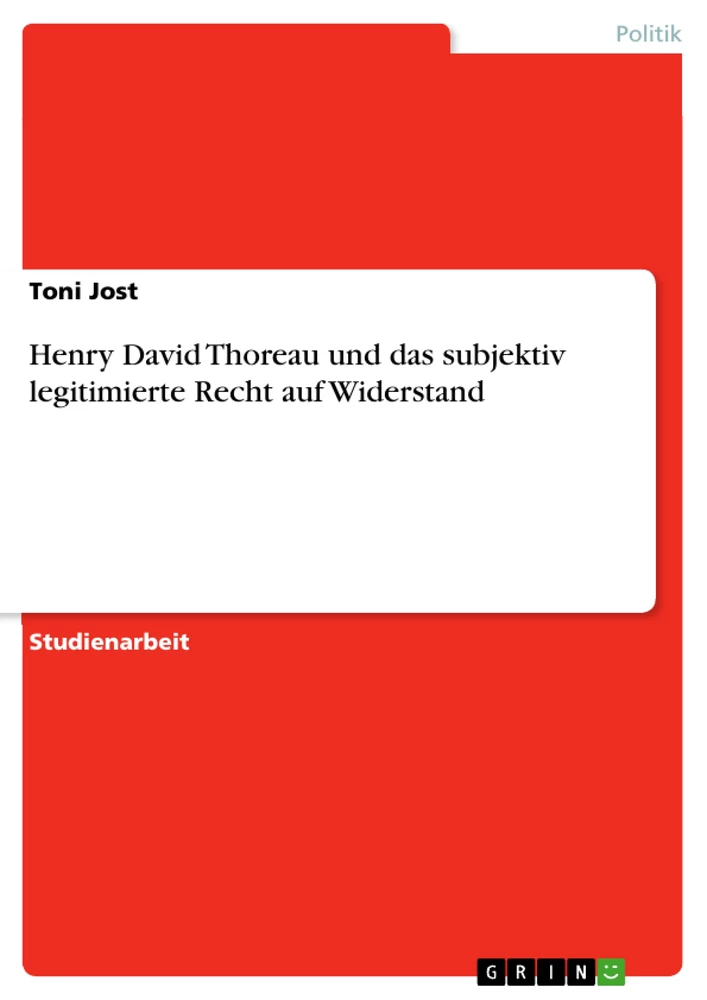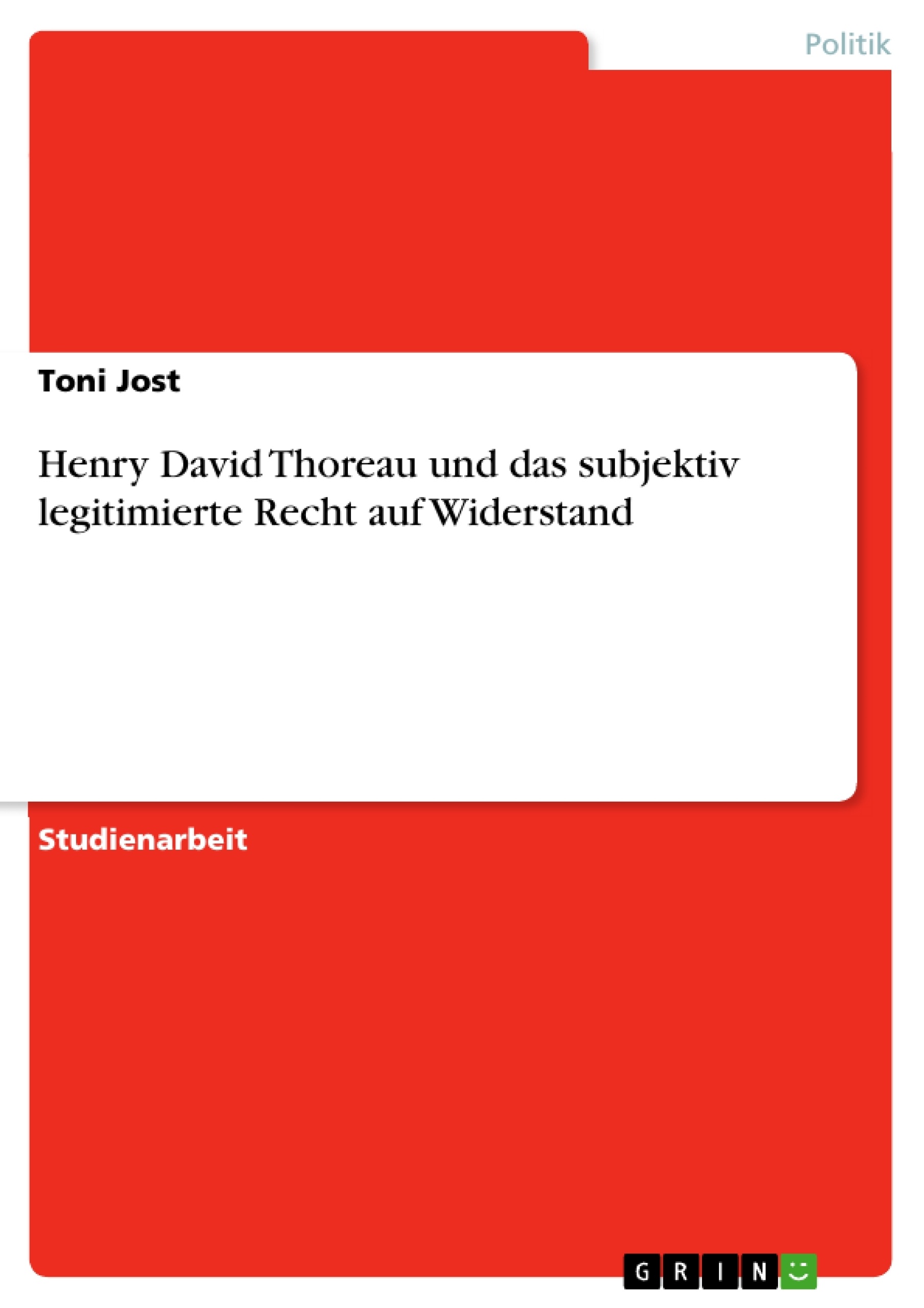Es mag gerechtfertigt sein, Thoreau als Vater der Diskussion um den zivilen Ungehorsams zu betrachten, aber eine Reduzierung auf diese Rezeption ist falsch. Diese Arbeit führt den Nachweis, dass Thoreau der Nachwelt aufgrund von begrifflichen Ungenauigkeiten und der Überbewertung der Entscheidungskompetenz des Individuums bei der Überwindung von gesellschaftlichen Übeln einen sehr weiten Rahmen von Widerstandsformen, die von der Steuerverweigerung bis zu gewaltsamen Maßnahmen reichen, überlassen hat. Deshalb darf es nicht verwundern, dass dies an den Beispielen Mahatma Gandhi, der gewaltlos für die Unabhängigkeit Indiens stritt, und Theodore Kaczynski, der als „Unabomber“ zwischen 1978 und 1995 die USA im Kampf gegen den technologischen Fortschritt mit Briefbomben terrorisierte, demonstriert wird. Zweifellos handelte ersterer moralisch gerechtfertigt, indem er den gesellschaftlichen und völkerrechtlichen Normen zur Geltung verhalf, während Kaczynski Verschwörungstheorien nacheiferte und seine Lust an der Rache am „System“ befriedigen wollte, aber dieser Unterschied löst sich auf, wenn – wie an Thoreaus Gedanken ersichtlich werden wird – dem Begriff „Moral“ seine gesellschaftsnormative Bedeutung entzogen und stattdessen das individuelle Gewissen frei wird, selbst Maßstäbe zur Bewertung der Gesellschaft und ihrer Prozesse aufzustellen, anzulegen und entsprechend danach zu handeln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand, Methodik und Fragestellung
- Thoreaus Widerstandslehre
- Konstanten: Natur, Sklaverei, Prinzipien
- Thoreaus Prinzipien im Kontext staatlichen Handelns
- Die Legitimation des Widerstands: Das eigene Gewissen
- Die Ziele: Zwischen Selbstläuterung und gesellschaftlichem Engagement
- Die Strategie: Zwischen Ungehorsam und Widerstand
- Zusammenfassung: Thoreau als Gesinnungsethiker
- Wirkungsgeschichte
- Mahatma Gandhi
- Theodore Kaczynski
- Das Manifest
- Die Erkenntnis
- Zum Widerstand
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Widerstandslehre von Henry David Thoreau im Kontext der klassischen Widerstandslehre und dem zivilen Ungehorsam im demokratischen Rechtsstaat. Sie analysiert Thoreaus Argumentation für ein subjektiv legitimiertes Recht auf Widerstand und untersucht die Auswirkungen seiner Lehre auf verschiedene historische und aktuelle Beispiele von Widerstand.
- Das Recht auf Widerstand in demokratischen Gesellschaften
- Thoreaus Kritik am Rechtspositivismus und seine Argumentation für das natürliche Recht
- Die Rolle des Gewissens und der individuellen Moral in der Widerstandsentscheidung
- Die unterschiedlichen Strategien und Ziele des Widerstands
- Die Wirkungsgeschichte von Thoreaus Lehre in verschiedenen Kontexten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Debatte um das Recht auf Widerstand in demokratischen Gesellschaften und stellt die Problematik der Verbindung von nichtinstitutionalisiertem Widerstand und einer demokratisch legitimierten Herrschaft dar. Die zweite Sektion untersucht den Forschungsstand zu Thoreaus Widerstandslehre und beleuchtet kritisch die Tendenz der Thoreau-Forschung, seine Widersprüche und begrifflichen Defizite zu übersehen. Die dritte Sektion analysiert Thoreaus Widerstandslehre im Detail und stellt seine zentralen Prinzipien und Argumentationslinien dar, einschließlich seiner Kritik am Rechtspositivismus und der Betonung des eigenen Gewissens als Grundlage für die Legitimation des Widerstands. In der vierten Sektion wird die Wirkungsgeschichte von Thoreaus Lehre anhand der Beispiele Mahatma Gandhi und Theodore Kaczynski beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Themen wie Widerstandsrecht, ziviler Ungehorsam, Rechtspositivismus, natürliches Recht, Gewissen, individuelle Moral, politische Philosophie, Thoreau, Gandhi, Kaczynski.
- Quote paper
- Toni Jost (Author), 2006, Henry David Thoreau und das subjektiv legitimierte Recht auf Widerstand, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/85439