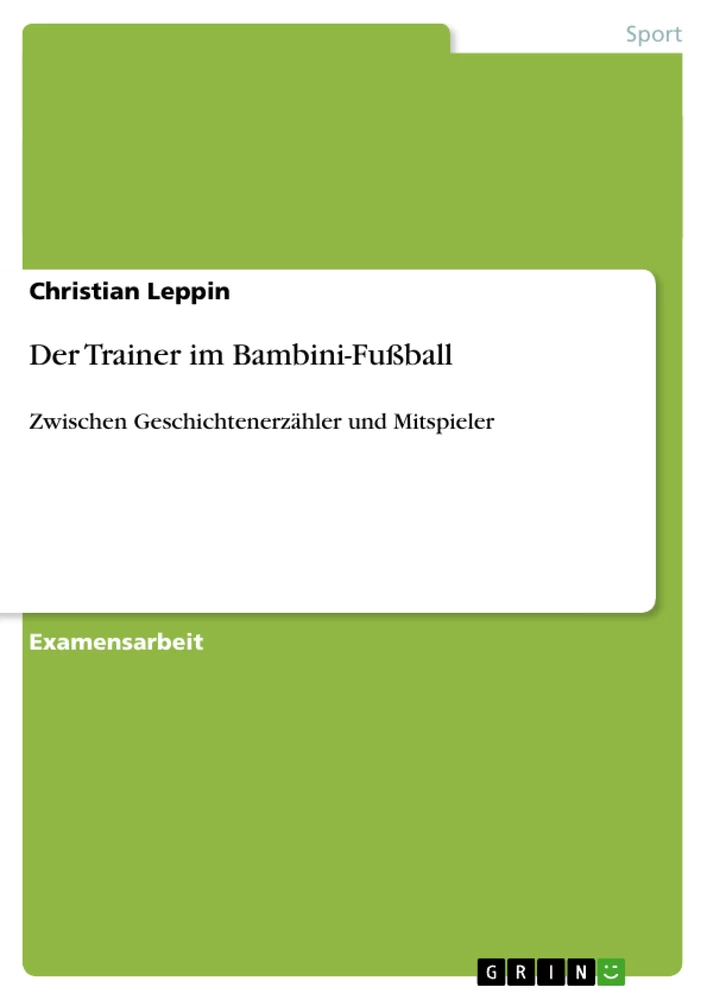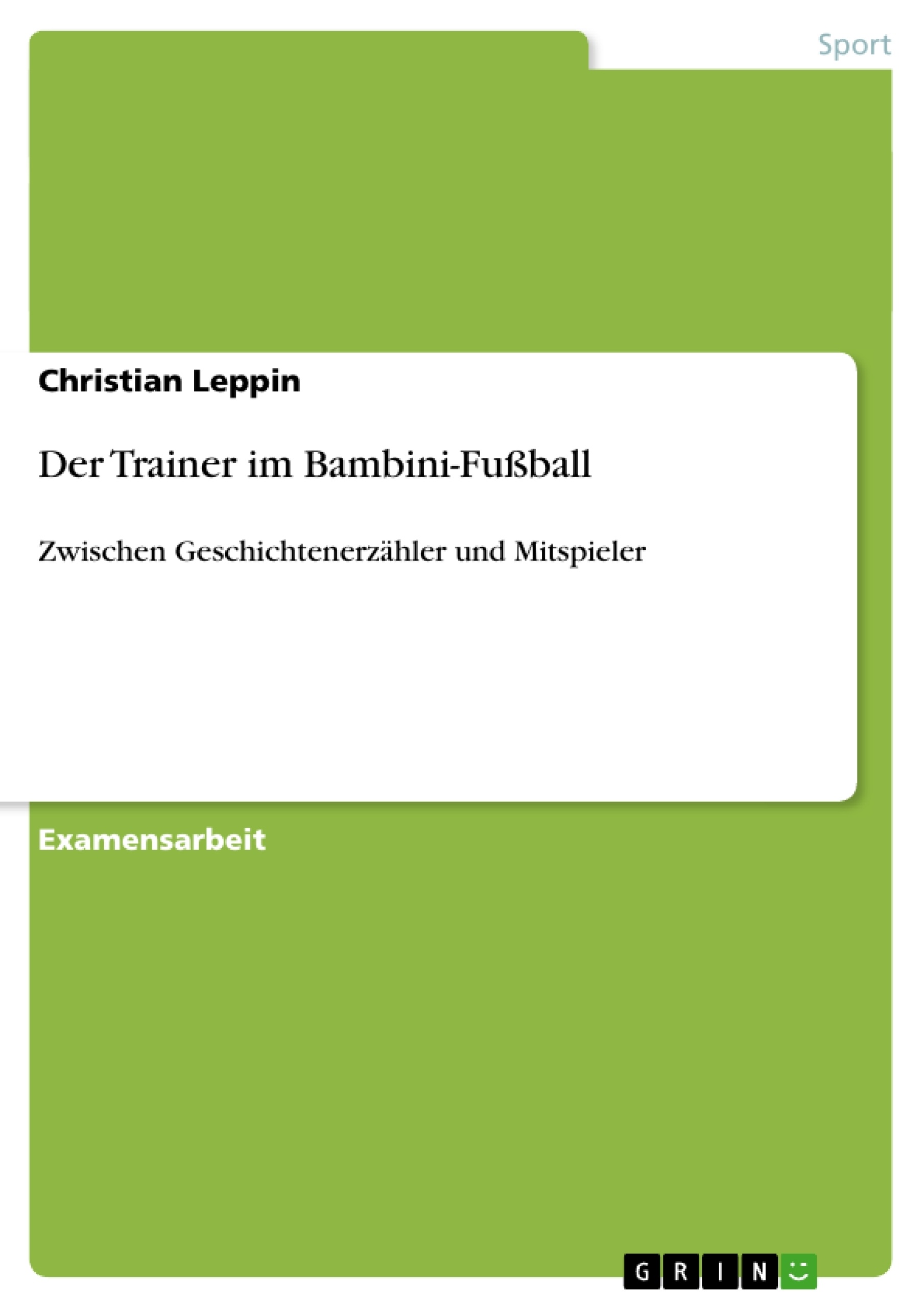Im Jahr der Fußballweltmeisterschaft im eigenen Lande herrscht ähnlich wie nach den Titelgewinnen der deutschen Nationalmannschaft in den Jahren 1974 und 1990 (vgl. Wagner, 1991, S. 5) eine Begeisterungswelle für den Fußball, die zu neuen Anmeldeschüben in den Jugendabteilungen der Fußballvereine führt. 2005 waren im Deutschen Fußball-Bund (DFB) mehr als zwei Millionen Jungen und Mädchen in über 25.000 Vereinen mit ca. 100.000 Mannschaften gemeldet (vgl. DFB) . Demnach bleibt Fußball die Sportart Nummer eins in Deutschland und der DFB der größte Fachverband im Deutschen Sportbund (DSB).
Insbesondere in den jüngsten Altersklassen der Vereine spielen so viele Kinder wie nie zuvor Fußball. Dieser erfreulichen Entwicklung tragen die Vereine Rechnung: Zahllose Trainer und Übungsleiter arbeiten mit viel Herz und Engagement „mit den kleinen Stars von morgen“ (Bischops & Gerards, 1995, S. 9).
Kinder kommen mittlerweile bereits im Alter von vier bis sechs Jahren in Fußballvereine, um in Bambini-Mannschaften zu spielen. „Den Eintritt in den Verein vollziehen sie mit einer ‚vorsichtigen’ Freude. Freude wegen der Hoffnung auf Spiel und Bewegung sowie auf das Gewinnen neuer Freunde; Vorsicht wegen der neuen Situation, die dem Kind unbekannt ist“ (Bischops & Gerards, 1995, S. 11). Überdies handelt es sich bei Bambini um Vorschulkinder, die zuvor in der Regel keinerlei Kontakt mit angeleitetem Sport hatten. Folglich ist der Trainer meist die erste Kontaktperson in Sachen Sport. Klaus Bischops und Heinz-Willi Gerards stellen heraus, dass es daher sehr entscheidend sei, wie ein neues Kind vom Trainer an das Spiel Fußball herangeführt wird: „Wenn es unser Ziel sein soll, dass Sechsjährige auch noch mit 40 Jahren Freude am aktiven Fußball haben sollen, müssen wir alles tun, was Kinder an die Sache ‚Fußball’ fesselt, ihnen Freude und Erlebnis vermittelt und ihnen einen kräftigen Motivationsschub verleiht“ (Bischops & Gerards, 1995, S. 11).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Definition und Abgrenzung der Kernbegriffe
- Training
- Trainer
- Übungsleiter
- Bambini
- Richtlinien für Fußballspiele im Bambini-Bereich
- Trainingsgruppe
- Entwicklung im Kindesalter
- Zur Bedeutung der Bewegungserziehung
- Kinderfußball im Wandel
- Die Bewegungswelt von damals
- Die heutige Bewegungs- und Lebensumwelt von Kindern
- Zur veränderten Kindheit
- Freizeitaktivitäten von Kindern
- Wandel des Sportzuganges
- Historischer Vergleich methodischer Zugänge im Kinderfußball
- Trainer
- Soziale Rolle des Trainers
- Ehrenamtliche Mitarbeit und Freiwilligenarbeit
- Bambini-Trainer
- Wie wird man Bambini-Trainer?
- Anforderungen an Bambini-Trainer
- Fähigkeiten
- Verhalten
- Aufgaben
- Zusätzliche sportliche Vereinsangebote
- Zusätzliche außersportliche Vereinsangebote
- Zusammenarbeit mit Eltern
- Kooperation mit Kindergärten
- Kooperation mit Schulen
- Bewegungsangebote für Klein- und Vorschulkinder
- Aufbau einer Bambini-Mannschaft
- Zusammenarbeit mit dem eigenen Verein
- Konsequenzen für die Betreuung
- Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Von der Theorie zur Praxis: Überprüfung der Anwendbarkeit
- Empirische Untersuchung
- Untersuchungsverfahren
- Untersuchungsdurchführung
- Untersuchungsauswertung
- Versuch der Beantwortung von Forschungsfragen
- Chancen und Perspektiven
- Kritische Betrachtung: Probleme und Defizite
- Erhaltenes Feedback
- Fazit
- Die Entwicklung des Kindes im Alter von vier bis sechs Jahren
- Die Bedeutung der Bewegungserziehung für Kinder in diesem Alter
- Der Wandel im Kinderfußball von den 1950er Jahren bis heute
- Die spezifische Rolle des Bambini-Trainers und seine Anforderungen
- Mögliche Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Bambini-Trainer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der spezifischen Rolle des Trainers im Bambini-Fußball und den damit verbundenen Anforderungen. Ziel der Arbeit ist es, die Notwendigkeit einer pädagogischen und fachlichen Ausbildung für Bambini-Trainer aufzuzeigen und Problembereiche sowie Lösungsansätze zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit führt in die Thematik des Bambini-Fußballs ein und beleuchtet die steigende Beliebtheit dieser Sportart bei Kindern im Vorschulalter. Der Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung des Trainers als erste Kontaktperson für Kinder im Bereich des organisierten Sports und der Herausforderungen, die sich aus dieser Rolle ergeben.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Definition und Abgrenzung von Kernbegriffen wie Training, Trainer, Übungsleiter und Bambini. Weiterhin werden Richtlinien des DFB für Fußballspiele im Bambini-Bereich beleuchtet.
Das zweite Kapitel widmet sich der Lerngruppe der vier- bis sechsjährigen Kinder. Es beleuchtet die kindliche Entwicklung in diesem Alter und betont die Bedeutung der Bewegungserziehung für die körperliche und geistige Entwicklung.
Im dritten Kapitel wird die Entwicklung des Kinderfußballs von den 1950er Jahren bis heute betrachtet. Es wird ein Vergleich der damaligen und heutigen Bewegungs- und Lebensumwelt von Kindern durchgeführt, um die Veränderungen im Bereich des Kinderfußballs aufzuzeigen.
Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die spezifische Rolle des Trainers im Bambini-Fußball. Es werden die soziale Rolle des Trainers, die Thematik der ehrenamtlichen Mitarbeit sowie die Anforderungen an Bambini-Trainer beleuchtet. Zudem werden Aufgabenbereiche, Konsequenzen für die Betreuung und Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Trainer beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Bambini-Fußball, Trainerrolle, Kinderentwicklung, Bewegungserziehung, ehrenamtliche Mitarbeit, Aus- und Weiterbildung, sowie empirische Untersuchung von Traineranforderungen. Die Untersuchung befasst sich mit den Besonderheiten des Kinderfußballs im Bereich der Bambini-Mannschaften und der Rolle des Trainers als wichtige Bezugsperson für die jungen Spieler.
- Quote paper
- Christian Leppin (Author), 2006, Der Trainer im Bambini-Fußball, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/84432