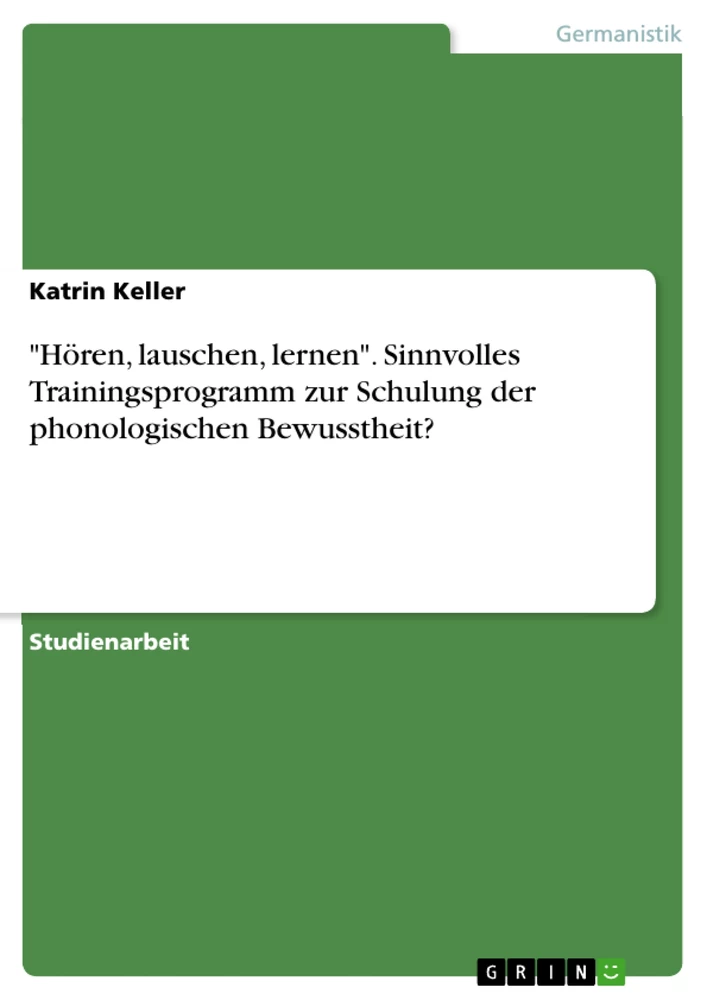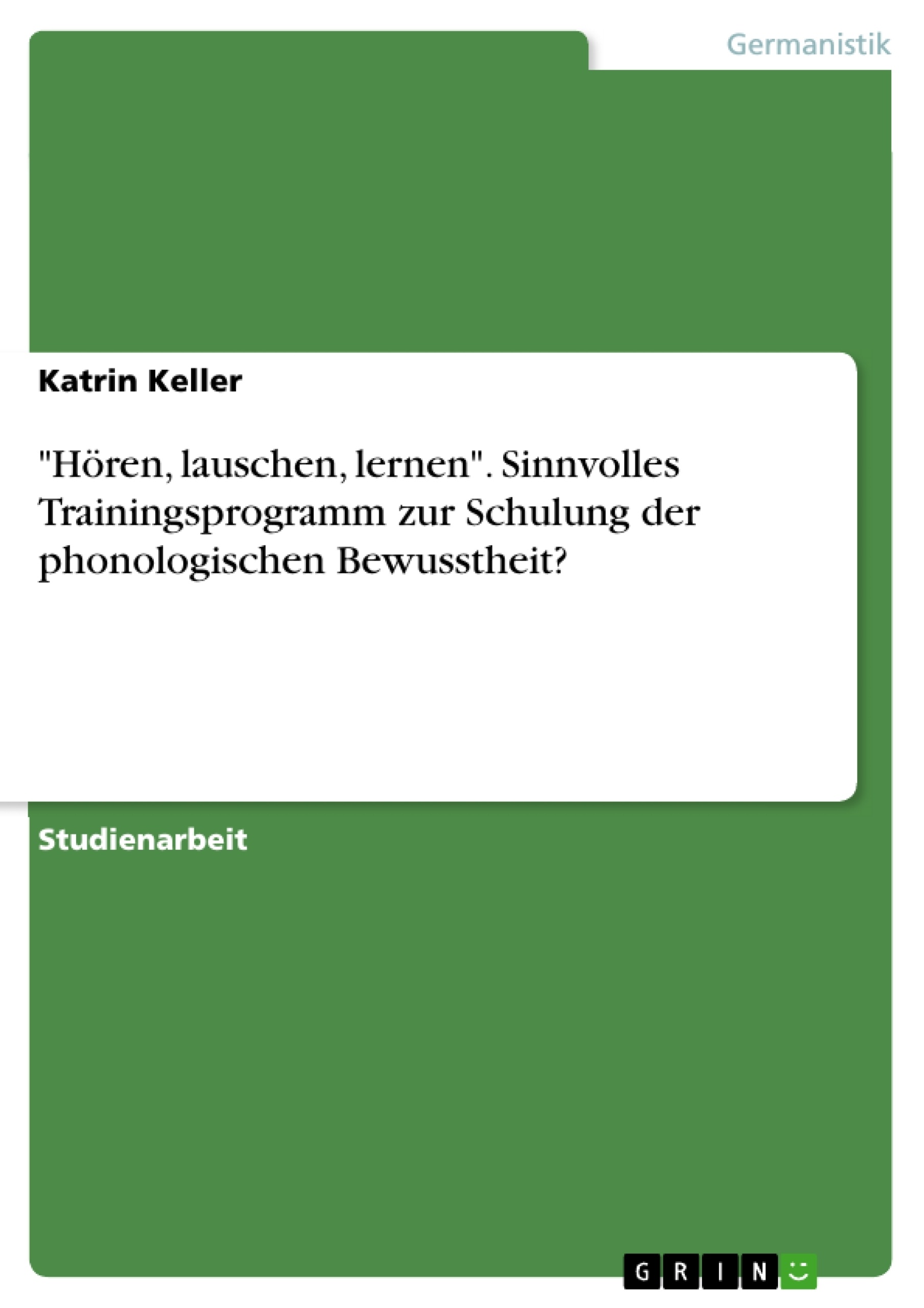Bis in die achtziger Jahre hinein war die Rechtschreibdidaktik der Auffassung, dass Kinder sich beim Schreiben- und Lesenlernen „Wortbilder“ bzw. zwei
Symbolsysteme (Laute und Buchstaben) einprägen und deren Zusammenhänge (Phonem-Graphem-Korrespondenzen) im Gedächtnis speichern würden. Aus diesem Grund achteten die Lehrer strikt darauf, dass die Kinder nichts schrieben, was der Norm nach falsch war. Hatten die Kinder Probleme beim Schriftspracherwerb, so wurde dies auf auditive und visuelle „Teilleistungsstörungen“
zurückgeführt. Heute weiß man, dass das Hauptproblem beim Schriftspracherwerb ein kognitives ist. Die Kinder müssen den Aufbau und die Funktion unserer alphabetischen
Schrift verstehen. Das Grundprinzip lässt sich darin sehen, dass die Schrift Informationen über die phonologische Gestalt der Wörter enthält. Den Phonemen
unserer Sprache sind Grapheme (dies können Buchstaben sein, aber auch Kombinationen von Buchstaben wie beim <sch> oder beim <ie>) zugeordnet. Um ein Wort schreiben zu können, müssen die Kinder lernen, von der Bedeutung des Worts zu abstrahieren und sich auf dessen Klang zu konzentrieren. Dies ist für die Kinder nicht einfach, da sie Wörter auf die Bedeutung und den Handlungszusammenhang beziehen: „Geburtstag heißt Geburtstag, weil man dann Geschenke bekommt“. Es bedarf einer hohen Abstraktionsleistung, vom Handlungs- und Bedeutungskontext abzusehen und sich auf die lautliche Gestalt eines Wortes zu konzentrieren. Schwierigkeiten bei der Einsicht in den Phonemaufbau von Wörtern und den analytischen Umgang mit Phonemen gelten heute unter dem Begriff „phonologische Bewusstheit“ als Kernproblem der Lese- Rechtschreibschwäche. Vor allem die kognitionspsychologisch orientierte Forschung
beschäftigt sich mit der Bedeutung von Teilleistungen, zu der die phonologische Bewusstheit zählt, für den Schriftspracherwerb. Es wird betont, dass ein frühes Training der phonologischen Bewusstheit, die als Vorläuferfähigkeit für den Schriftspracherwerb verstanden wird, positive Wirkungen auf die Lese- und Rechtschreibkompetenzen in der Grundschule hat. Auf dem Markt gibt es mittlerweile zahlreiche Trainingsprogramme, die das Ziel verfolgen, das phonologische Bewusstsein von Kindern zu verbessern. In dieser Arbeit wird das
Würzburger Trainingsprogramm „Hören, lauschen, lernen“ zur Förderung der phonologischen Bewusstheit für Kinder im Vorschulalter vorgestellt und kritisch
betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Phonologische Bewusstheit
- Würzburger Trainingsprogramm
- Teilbereiche des Würzburger Trainingsprogramms
- Ideen-Kiste „Schrift-Sprache“
- Die acht Lernfelder der „didaktischen Landkarte“
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit stellt das Würzburger Trainingsprogramm „Hören, lauschen, lernen“ zur Förderung der phonologischen Bewusstheit bei Vorschulkindern vor und analysiert es kritisch. Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und Schriftspracherwerb.
- Der Stellenwert phonologischer Bewusstheit im Schriftspracherwerb
- Das Würzburger Trainingsprogramm: Inhalte und Methodik
- Kritische Betrachtung des Trainingsprogramms
- Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und Lese-Rechtschreibschwäche
- Die Bedeutung frühzeitiger Förderung phonologischer Bewusstheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung der Rechtschreibdidaktik, vom Fokus auf Wortbilder und visuelle/auditive Defizite hin zum heutigen Verständnis des Schriftspracherwerbs als kognitiven Prozess. Sie hebt die Bedeutung des Verständnisses der alphabetischen Schrift und der phonologischen Bewusstheit als Kernproblem von Lese-Rechtschreibschwäche hervor. Der Text führt in die Thematik ein und begründet die Notwendigkeit von Trainingsprogrammen zur Förderung der phonologischen Bewusstheit, wobei das Würzburger Programm „Hören, lauschen, lernen“ als Untersuchungsobjekt vorgestellt wird. Die Herausforderungen der Abstraktion vom Bedeutungskontext zur Konzentration auf die lautliche Wortgestaltung werden deutlich gemacht und mit einem Zitat von Valtin (2000) untermauert.
Phonologische Bewusstheit: Dieses Kapitel definiert phonologische Bewusstheit als die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit von der Bedeutung eines Wortes auf dessen formale Eigenschaften zu lenken. Es differenziert zwischen phonologischer Bewusstheit im weiteren (Sprechrhythmus, Silbentrennung, Reimen) und engeren Sinne (Phonemanalyse, -synthese, Lautmanipulation). Die Diskussion der unterschiedlichen Forschungsergebnisse – die phonologische Bewusstheit als Vorläuferfähigkeit vs. als Ergebnis des Schriftspracherwerbs – wird durch die Unterscheidung dieser beiden Ebenen aufgelöst. Das Kapitel betont die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für den Lese- und Schreibprozess und erläutert die Rolle der Phonemanalyse und -synthese beim Erlernen des Lesens und Schreibens, indem es die Entwicklungsstufen des Schriftspracherwerbs und die Herausforderungen des "Erlesens" beschreibt, wobei das Beispiel "Kompass" die komplexe Zerlegung des Wortes in Phoneme veranschaulicht. Die Verschmelzung von Lauten beim Sprechen im Gegensatz zur Vorstellung einzelner Laute beim Lesen wird anhand eines Zitats von Andresen erläutert.
Schlüsselwörter
Phonologische Bewusstheit, Schriftspracherwerb, Lese-Rechtschreibschwäche, Würzburger Trainingsprogramm, „Hören, lauschen, lernen“, Phonemanalyse, Phonemsynthese, Lautmanipulation, Vorschulalter, Kognitionspsychologie.
Häufig gestellte Fragen zum Würzburger Trainingsprogramm „Hören, lauschen, lernen“
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Würzburger Trainingsprogramm „Hören, lauschen, lernen“, zur Förderung der phonologischen Bewusstheit bei Vorschulkindern. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse des Programms und seiner Bedeutung im Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb und Lese-Rechtschreibschwäche.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die phonologische Bewusstheit, ihren Stellenwert im Schriftspracherwerb und den Zusammenhang mit Lese-Rechtschreibschwäche. Es analysiert das Würzburger Trainingsprogramm hinsichtlich seiner Inhalte und Methodik, untersucht kritisch seine Wirksamkeit und beleuchtet die Bedeutung frühzeitiger Förderung phonologischer Fähigkeiten. Die verschiedenen Ebenen der phonologischen Bewusstheit (weiterer und engerer Sinn) werden erklärt und die Herausforderungen beim Erlernen des Lesens und Schreibens detailliert beschrieben.
Was ist phonologische Bewusstheit und warum ist sie wichtig?
Phonologische Bewusstheit ist die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit von der Bedeutung eines Wortes auf seine lautlichen Eigenschaften zu lenken. Sie umfasst Aspekte wie Sprechrhythmus, Silbentrennung, Reimen, aber vor allem die Phonemanalyse (Zerlegung von Wörtern in einzelne Laute) und -synthese (Zusammenfügen von Lauten zu Wörtern). Phonologische Bewusstheit ist eine wichtige Vorläuferfähigkeit für den Schriftspracherwerb und spielt eine entscheidende Rolle beim Erlernen des Lesens und Schreibens. Schwächen in diesem Bereich können zu Lese-Rechtschreibschwäche führen.
Was ist das Würzburger Trainingsprogramm „Hören, lauschen, lernen“?
Das Würzburger Trainingsprogramm „Hören, lauschen, lernen“ ist ein Programm zur Förderung der phonologischen Bewusstheit bei Vorschulkindern. Das Dokument analysiert dieses Programm kritisch hinsichtlich seiner Inhalte und Methodik und untersucht seinen Beitrag zur Verbesserung der phonologischen Fähigkeiten und somit zur Vermeidung von Lese-Rechtschreibschwäche.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument umfasst Kapitel zu folgenden Themen: Einleitung (mit historischem Überblick der Rechtschreibdidaktik), Phonologische Bewusstheit (Definition und Bedeutung), detaillierte Beschreibung des Würzburger Trainingsprogramms (inkl. Teilbereiche), eine Beschreibung der „Ideen-Kiste Schrift-Sprache“ (inkl. der acht Lernfelder der didaktischen Landkarte) und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird im Dokument zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Phonologische Bewusstheit, Schriftspracherwerb, Lese-Rechtschreibschwäche, Würzburger Trainingsprogramm, „Hören, lauschen, lernen“, Phonemanalyse, Phonemsynthese, Lautmanipulation, Vorschulalter, Kognitionspsychologie.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Pädagogen, Lehramtsstudierende, Logopäden, Eltern und alle, die sich für die Förderung des Schriftspracherwerbs und die Prävention von Lese-Rechtschreibschwäche interessieren. Es bietet einen wissenschaftlichen Überblick über ein wichtiges Trainingsprogramm und die zugrundeliegenden Theorien.
- Quote paper
- Katrin Keller (Author), 2005, "Hören, lauschen, lernen". Sinnvolles Trainingsprogramm zur Schulung der phonologischen Bewusstheit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/84072