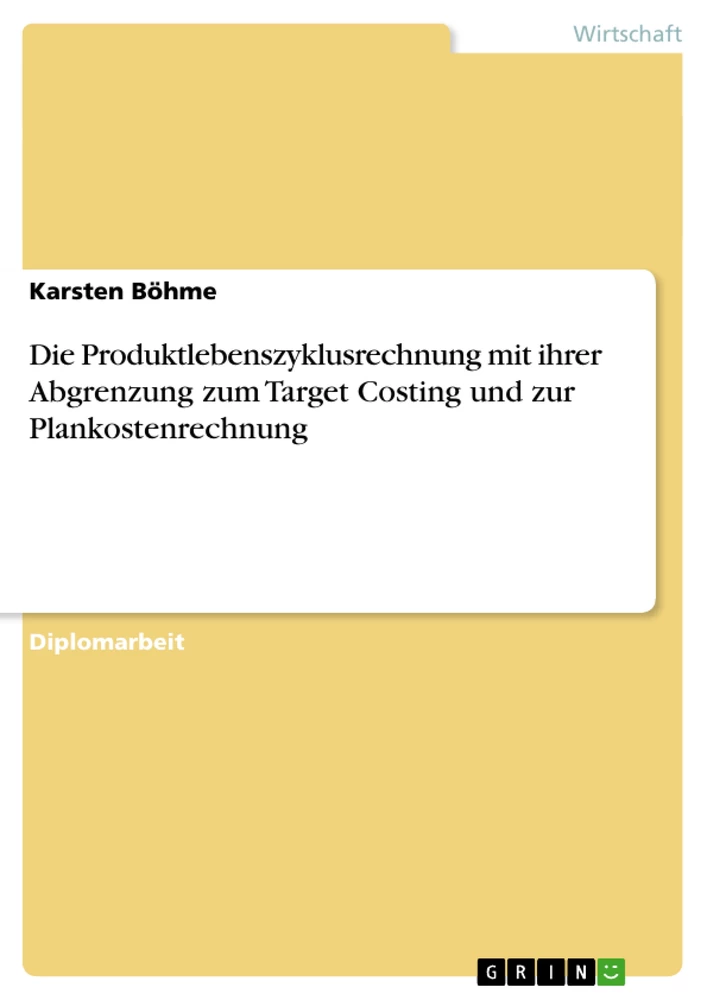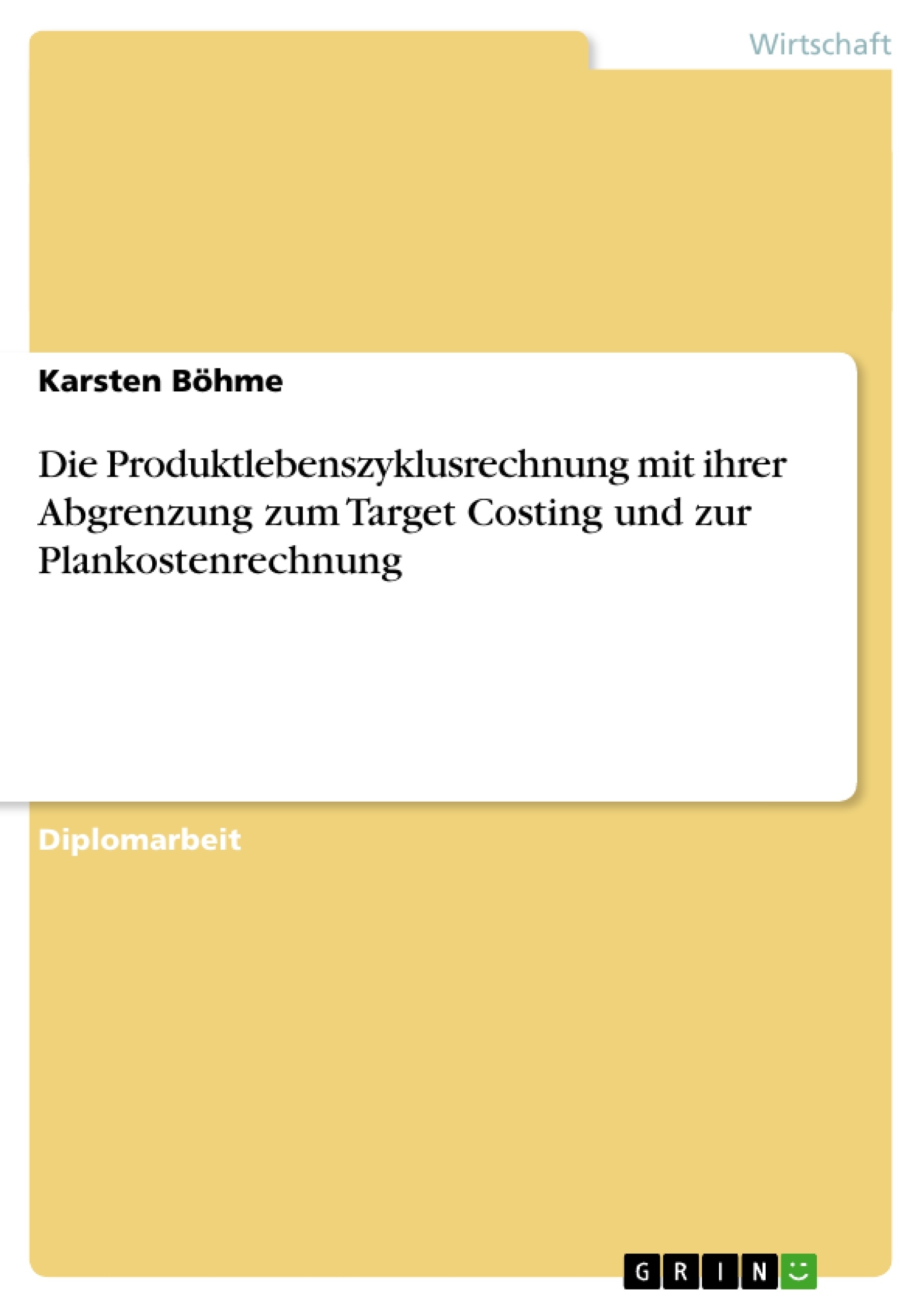Die stetig zunehmende Globalisierung der Beschaffungs- und Absatzmärkte, die Entwicklung neuer Produktionstechnologien und das erhöhte Kundenbewusstsein führen in den Unternehmen zu Kostenwachstum und gerade in Ländern mit hohen Löhnen, wie unter anderem Deutschland, zu steigendem Kostendruck. Um global wettbewerbsfähig zu bleiben müssen, technisch ausgereifte, auf neuen Technologien aufbauende, komplexe Produkte mit hoher Qualität hergestellt werden. Die Folge davon ist, dass vor allem die Entwicklungskosten in den letzten Jahren angestiegen sind. Des Weiteren sind steigende Kosten, die nach dem Verkauf durch umweltpolitische Vorschriften, wie z.B. die Entsorgung oder die Ausweitung der Haftungs- und Gewährleistungsbestimmungen, entstehen, eine Tendenz der Neuzeit. Erschwerend zu dieser Entwicklung kommt noch hinzu, dass sich die Lebenszyklen von Produkten, aber auch Dienstleistungen, immer mehr verkürzen und die Unternehmen gefordert werden in kurzer Zeit neue, gewinnbringende Produkte in den Markt einzuführen um eine Verdrängung vom Markt durch Wettbewerber zu verhindern. Diese Entwicklung der Rahmenbedingungen hat dazu geführt, dass sich die Kostenstruktur, insbesondere die anteilige Höhe der Gemeinkosten, veränderte. Es hat sich gezeigt, dass die traditionellen Methoden der Kostenrechnung ihre Aufgaben, wie die Bereitstellung relevanter Kosteninformationen oder die Aufrechterhaltung der Kostentransparenz, bei diesen Entwicklungstendenzen nur unzureichend erfüllen. Die Unternehmen reagieren mit einer zunehmenden Strategieorientierung durch diese Entwicklungen, die dazu führt, dass auch in der Kostenrechnung ein längerer Planungshorizont erforderlich ist. Ein weiterer Ansatzpunkt vor dem Hintergrund des gestiegenen Kostendruckes ist das Feststellen und Nutzen von Kostensubstitutionen zwischen den Vorlauf- bzw. Folgekosten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Produktlebenszyklus
- 2.1 Grundlagen
- 2.2 Phasen des Produktlebenszyklus
- 2.3 Der Aussagewert des Produktlebenszykluskonzeptes
- 3. Die Lebenszykluskostenrechnung
- 3.1 Entstehungsgeschichte
- 3.2 Gegenstand und Rechnungsziel von Lebenszykluskostenrechnungen
- 3.3 Bezugsobjekte
- 3.3.1 Grundlagen
- 3.3.2 Lebenszykluskostenrechnung aus Konsumentensicht
- 3.3.3 Produktlebenszykluskostenrechnung aus Produzentensicht
- 3.4 Abgrenzung der Phasen und Kostenkategorien
- 3.5 Kosten und Erlöse in der Vor- und Nachlaufphase
- 3.6 Die Verrechnung der Vorlauf- und Folgekosten
- 3.6.1 Grundlagen
- 3.6.2 Die Prognose der Kosten und Erlöse
- 3.7 Die Ratierliche Kalkulation
- 3.8 Der deckungsbeitragorientierte Ansatz
- 3.8.1 Grundlagen
- 3.8.2 Der periodenübergreifende Ausweis von Vorlauf- und Folgekosten
- 3.8.3 Die periodengerechte Verrechnung von Vorlauf- und Folgekosten
- 3.9 Der investitionsorientierte Ansatz
- 3.9.1 Grundlagen
- 3.9.2 Der investitionsorientierte Ansatz für ein Produkt
- 3.9.3 Der Kalkulationszinssatz
- 3.9.4 Konzeption einer mehrstufigen Produktlebenszykluskostenrechnung
- 3.10 Die Bewertung der Ansätze der Produktlebenszykluskostenrechnung
- 3.11 Das Lücke-Theorem
- 3.11.1 Grundlagen
- 3.11.2 Abgrenzung der Begriffe Auszahlungen, Ausgaben bzw. Kosten und ihre Verbindung
- 3.11.3 Das Lücke-Theorem als Bindeglied zwischen zahlungsorientierter und kostenorientierter Produktlebenszykluskostenrechnung
- 3.11.4 Beurteilung des Lücke-Theorems
- 4. Die Abgrenzung zu anderen Kostenrechnungssystemen
- 4.1 Abgrenzung zum Target Costing
- 4.1.1 Grundlagen des Target Costing
- 4.1.2 Verbindungen zum Target Costing
- 4.2 Abgrenzung zur Plankostenrechnung
- 4.2.1 Grundlagen der Plankostenrechnung
- 4.2.2 Systeme der Plankostenrechnung
- 4.2.3 Verbindungen zur Plankostenrechnung
- 4.1 Abgrenzung zum Target Costing
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Lebenszykluskostenrechnung und grenzt sie gegenüber dem Target Costing und der Plankostenrechnung ab. Ziel ist es, die Methodik der Lebenszykluskostenrechnung zu erläutern und ihre Anwendung im Kontext steigender Kosten und verkürzter Produktlebenszyklen zu beleuchten.
- Analyse der Lebenszykluskostenrechnung
- Vergleich mit Target Costing
- Abgrenzung zur Plankostenrechnung
- Betrachtung der Kostenstruktur in globalisierten Märkten
- Relevanz für Unternehmen im Kontext von Kostendruck und verkürzten Produktlebenszyklen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Hintergrund der Arbeit, indem sie den zunehmenden Kostendruck in globalisierten Märkten und die Herausforderungen für Unternehmen durch verkürzte Produktlebenszyklen und steigende Entwicklungskosten beleuchtet. Sie hebt die Unzulänglichkeit traditioneller Kostenrechnungssysteme in diesem Kontext hervor und führt die Lebenszykluskostenrechnung als Lösungsansatz ein. Die Notwendigkeit einer strategieorientierten Kostenrechnung mit längerem Planungshorizont und die Bedeutung der Kostensubstitution zwischen Vorlauf- und Folgekosten werden ebenfalls betont.
2. Der Produktlebenszyklus: Dieses Kapitel liefert die Grundlagen zum Verständnis des Produktlebenszyklus. Es definiert den Produktlebenszyklus, beschreibt seine verschiedenen Phasen (Entwicklung, Einführung, Wachstum, Reife, Sättigung, Rückgang), und diskutiert den Aussagewert des Konzepts für die Kostenrechnung. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Verständnisses der unterschiedlichen Kostenmuster in jeder Phase des Zyklus, um effektive strategische Entscheidungen treffen zu können.
3. Die Lebenszykluskostenrechnung: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es beschreibt detailliert die Entstehung, den Gegenstand, und die Rechnungsziele der Lebenszykluskostenrechnung. Verschiedene Bezugsobjekte, die Abgrenzung von Phasen und Kostenkategorien, sowie die Behandlung von Vorlauf- und Folgekosten werden eingehend analysiert. Die Arbeit vergleicht verschiedene Ansätze zur Verrechnung dieser Kosten (Ratierliche Kalkulation, Deckungsbeitragsorientierter Ansatz, Investitionsorientierter Ansatz) und evaluiert deren Vor- und Nachteile. Das Lücke-Theorem wird als Bindeglied zwischen zahlungsorientierter und kostenorientierter Produktlebenszykluskostenrechnung erklärt und bewertet.
4. Die Abgrenzung zu anderen Kostenrechnungssystemen: In diesem Kapitel wird die Lebenszykluskostenrechnung im Vergleich zu zwei wichtigen Alternativen, dem Target Costing und der Plankostenrechnung, analysiert. Die Grundlagen beider Systeme werden erläutert, gefolgt von einem detaillierten Vergleich ihrer Ansätze und Methoden mit der Lebenszykluskostenrechnung. Die Verbindungen und Unterschiede werden hervorgehoben, um die jeweiligen Stärken und Schwächen im Kontext der beschriebenen Herausforderungen zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Lebenszykluskostenrechnung, Target Costing, Plankostenrechnung, Produktlebenszyklus, Kostenmanagement, Kostendruck, Globalisierung, Vorlaufkosten, Folgekosten, Investitionsrechnung, Deckungsbeitragsrechnung, Lücke-Theorem.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Lebenszykluskostenrechnung
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Lebenszykluskostenrechnung. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Erläuterung der Methodik der Lebenszykluskostenrechnung und ihrem Vergleich mit dem Target Costing und der Plankostenrechnung.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Lebenszykluskostenrechnung in ihren verschiedenen Facetten. Es umfasst den Produktlebenszyklus, die verschiedenen Ansätze der Lebenszykluskostenrechnung (rationelle Kalkulation, deckungsbeitragsorientierter Ansatz, investitionsorientierter Ansatz), die Abgrenzung zu anderen Kostenrechnungssystemen wie Target Costing und Plankostenrechnung, sowie eine detaillierte Erklärung des Lücke-Theorems. Die Relevanz für Unternehmen in globalisierten Märkten mit Kostendruck und verkürzten Produktlebenszyklen wird ebenfalls beleuchtet.
Was ist der Produktlebenszyklus und seine Bedeutung für die Lebenszykluskostenrechnung?
Der Produktlebenszyklus beschreibt die verschiedenen Phasen eines Produkts von der Entwicklung bis zum Rückgang (Entwicklung, Einführung, Wachstum, Reife, Sättigung, Rückgang). Das Verständnis des Produktlebenszyklus ist essentiell für die Lebenszykluskostenrechnung, da die Kosten in jeder Phase stark variieren und die Berücksichtigung dieser Unterschiede für eine effektive strategische Planung unerlässlich ist.
Welche verschiedenen Ansätze der Lebenszykluskostenrechnung werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt drei verschiedene Ansätze: die ratierliche Kalkulation, den deckungsbeitragsorientierten Ansatz und den investitionsorientierten Ansatz. Jeder Ansatz bietet unterschiedliche Methoden zur Verrechnung von Vorlauf- und Folgekosten und wird hinsichtlich seiner Vor- und Nachteile bewertet.
Wie wird die Lebenszykluskostenrechnung im Vergleich zu Target Costing und Plankostenrechnung dargestellt?
Das Dokument vergleicht die Lebenszykluskostenrechnung mit Target Costing und Plankostenrechnung. Es erläutert die Grundlagen der jeweiligen Systeme, analysiert ihre Ansätze und Methoden und hebt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervor, um die Stärken und Schwächen im Kontext von Kostendruck und verkürzten Produktlebenszyklen zu beleuchten.
Was ist das Lücke-Theorem und seine Bedeutung?
Das Lücke-Theorem dient als Bindeglied zwischen zahlungsorientierter und kostenorientierter Produktlebenszykluskostenrechnung. Es klärt die Abgrenzung der Begriffe Auszahlungen, Ausgaben und Kosten und deren Zusammenhänge. Die Bedeutung des Theorems für die Lebenszykluskostenrechnung wird erläutert und bewertet.
Welche Zielsetzung verfolgt dieses Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, die Methodik der Lebenszykluskostenrechnung zu erläutern und ihre Anwendung im Kontext steigender Kosten und verkürzter Produktlebenszyklen zu beleuchten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich mit Target Costing und Plankostenrechnung, um die jeweiligen Stärken und Schwächen im Kontext der beschriebenen Herausforderungen zu verdeutlichen.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit Kostenrechnung, insbesondere der Lebenszykluskostenrechnung, auseinandersetzen. Es bietet eine umfassende Einführung und einen detaillierten Vergleich mit anderen relevanten Kostenrechnungssystemen.
- Quote paper
- Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Karsten Böhme (Author), 2007, Die Produktlebenszyklusrechnung mit ihrer Abgrenzung zum Target Costing und zur Plankostenrechnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/83420