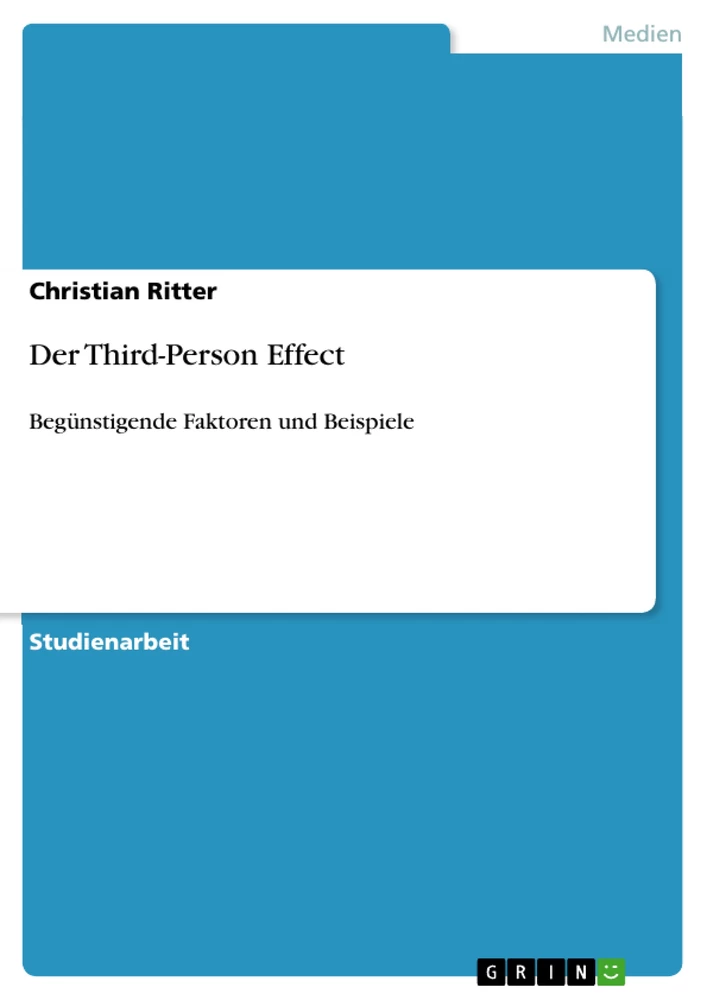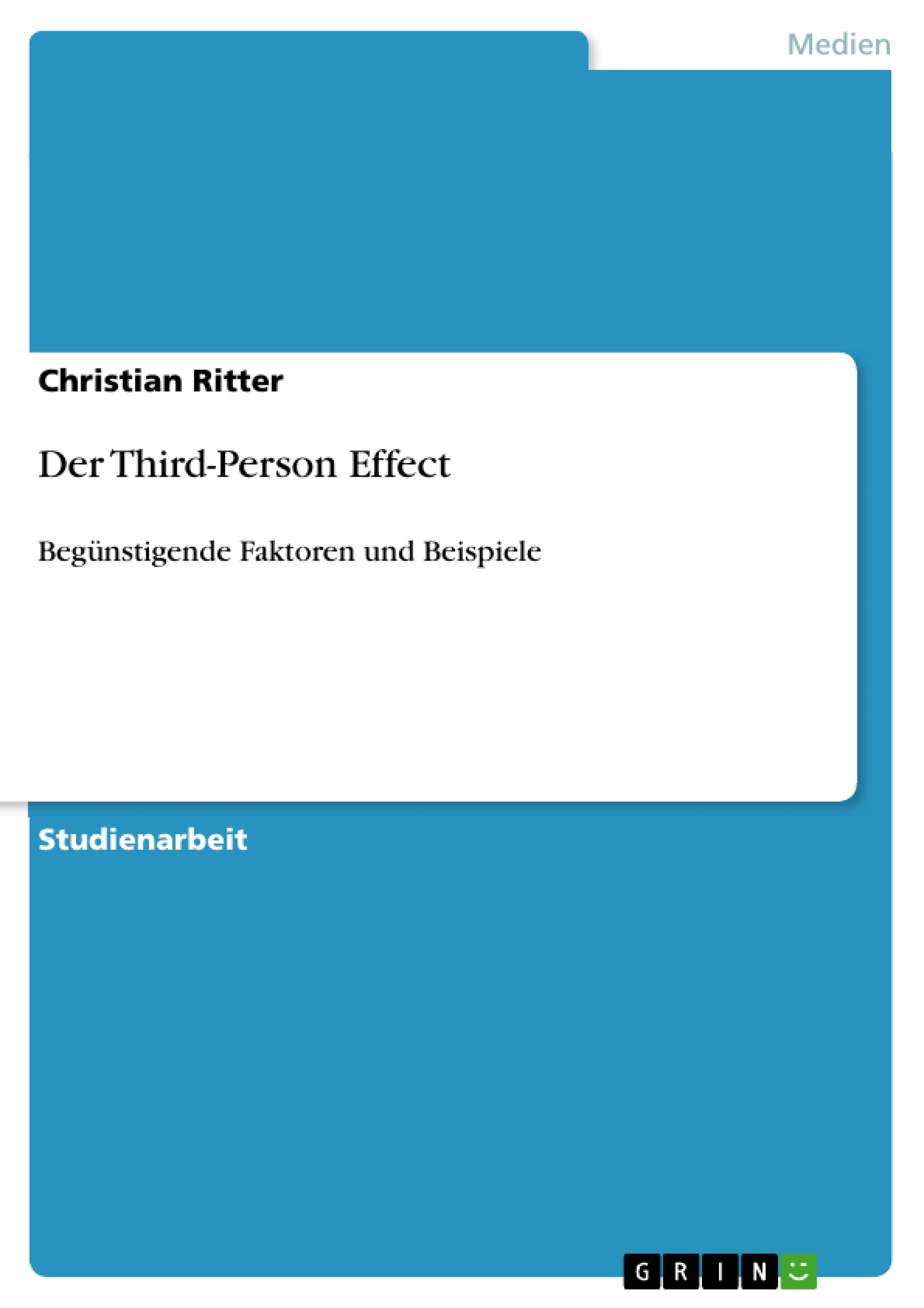Bereits 1949/1950 machte Davison eine Beobachtung, die Grundlage des Third-Person Effects ist (nähere Ausführungen in Punkt 2). Er hielt seine Hypothese anfangs zwar für interessant, aber unwichtig im Kontext großer Kommunikationstheorien. Der erste von ihm verfasste Artikel über den Third-Person Effect wurde erst 1983 publiziert.
Dass es sich mit der Bedeutung(slosigkeit) anders verhält, als von Davison zunächst angenommen, beweisen unzählige Studien, die seit 1983 basierend auf seiner Hypothese durchgeführt wurden und zu einem Großteil den Third-Person Effect oder, wie von Perloff genannt und von Davison später übernommen, die Third-Person Perception, verifizieren. Dabei wurden mit der Zeit Voraussetzungen, unter denen ein Auftreten wahrscheinlicher ist als sonst, Rahmenbedingungen wie Quelle, Situation, Inhalt, Fragenanordnung, demografische Details der Befragten et cetera erarbeitet, die heute einen umfassenden und präzisen Blick auf die Erscheinungsformen des Third-Person Effects zulassen.
Eben dies, die einzelnen Studien, die „abgesteckten Grenzen“ innerhalb derer der Effekt auftritt und Erklärungsansätze, wie es zu diesen Grenzen kommt, ist das Hauptthema dieser Arbeit. In Punkt 6 werden alle Rahmenbedingungen, die den Third-Person Effect fördern, ausführlich erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aufstellen der Theorie
- 3. Verwandtheit mit anderen Kommunikationsmodellen
- 4. First-Person Effect, Reverse Third-Person Effect
- 5. Second-Person Effect
- 6. Bedingungen
- 6.1. Inhalt der Botschaft
- 6.2. Parteilichkeit der Botschaft
- 6.3. Vertrauenswürdigkeit der Quelle
- 6.4. Soziale Erwünschtheit der Botschaft
- 6.5. Demografische Faktoren
- 6.6. Selbstüberhöhung
- 6.7. Involviertheit
- 6.8. Soziale Distanz
- 7. Belegung der aufgestellten Thesen anhand von Umfragewerten
- 8. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Third-Person Effect, eine Hypothese zur Wahrnehmung der Beeinflussung durch Massenkommunikation. Das Hauptziel ist die Erörterung der begünstigenden Faktoren und die Veranschaulichung anhand von Beispielen. Die Arbeit analysiert die Entstehung der Hypothese, ihre Beziehung zu anderen Kommunikationsmodellen und die empirischen Befunde, die ihre Gültigkeit belegen.
- Entstehung und Entwicklung der Third-Person-Effect-Hypothese
- Rahmenbedingungen und Faktoren, die den Third-Person Effect begünstigen
- Vergleich mit anderen Kommunikationsmodellen (z.B. Schweigespirale)
- Analyse empirischer Befunde zur Bestätigung der Hypothese
- Beispiele zur Veranschaulichung des Effekts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die essentielle Rolle der menschlichen Kommunikation und führt in die Thematik des Third-Person Effects ein. Sie erläutert den Begriff der öffentlichen Meinung und deren Komplexität, und verweist auf die Relevanz der Massenkommunikation in diesem Kontext. Die Arbeit wird als Untersuchung der Faktoren vorgestellt, die den Third-Person Effect begünstigen, basierend auf bestehenden Studien und Erklärungsansätzen.
2. Aufstellen der Theorie: Dieses Kapitel beschreibt die Ursprünge des Third-Person Effects anhand einer Anekdote aus dem Zweiten Weltkrieg: Schwarze Soldaten, die von japanischer Propaganda nicht beeinflusst wurden, während ihre weißen Offiziere dies fälschlicherweise annähmen. Davison interpretierte dies als den Kern des Third-Person Effects: die Annahme, dass andere stärker von Botschaften beeinflusst werden als man selbst. Das Kapitel legt den Grundstein für die weitere Untersuchung der Hypothese.
6. Bedingungen: Dieses Kapitel behandelt ausführlich die Faktoren, welche das Auftreten des Third-Person Effects begünstigen. Es werden diverse Einflussgrößen analysiert, unter anderem der Inhalt der Botschaft, deren Parteilichkeit, die Vertrauenswürdigkeit der Quelle, die soziale Erwünschtheit, demografische Merkmale der Rezipienten, Selbstüberhöhung, Involviertheit und soziale Distanz. Jeder Aspekt wird im Detail untersucht, um ein umfassendes Verständnis der Bedingungen zu schaffen, die die Wahrnehmung des Third-Person Effects beeinflussen. Die verschiedenen Unterkapitel (6.1-6.8) liefern eine detaillierte Betrachtung der jeweiligen Einflussfaktoren und ihre Interaktion.
7. Belegung der aufgestellten Thesen anhand von Umfragewerten: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert die Ergebnisse von Umfragen, die dazu dienen, die im vorherigen Kapitel erörterten Thesen zu belegen. Es werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen diskutiert und deren Relevanz für das Verständnis des Third-Person Effects herausgestellt. Der Fokus liegt auf der quantitativen Validierung der Hypothese und auf der Interpretation der Daten.
Schlüsselwörter
Third-Person Effect, Massenkommunikation, öffentliche Meinung, Medienwirkung, Wahrnehmung, Beeinflussung, Kommunikationsmodelle, empirische Forschung, demografische Faktoren, Informationsverarbeitung.
Häufig gestellte Fragen zum Third-Person Effect
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Übersicht über den Third-Person Effect. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Text analysiert die Entstehung der Hypothese, ihre Beziehung zu anderen Kommunikationsmodellen und beleuchtet die empirischen Befunde, die ihre Gültigkeit belegen. Ein besonderer Fokus liegt auf den Faktoren, die den Third-Person Effect begünstigen.
Was ist der Third-Person Effect?
Der Third-Person Effect ist die Hypothese, dass Menschen annehmen, dass andere stärker von Botschaften der Massenkommunikation beeinflusst werden als sie selbst. Der Text beleuchtet diesen Effekt anhand von Beispielen und empirischen Daten.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Aufstellen der Theorie, Verwandtheit mit anderen Kommunikationsmodellen, First-Person Effect, Reverse Third-Person Effect, Second-Person Effect, Bedingungen (mit Unterkapiteln zu verschiedenen Einflussfaktoren wie z.B. Inhalt der Botschaft, Quelle der Botschaft, demografische Faktoren etc.), Belegung der aufgestellten Thesen anhand von Umfragewerten und Schluss.
Welche Faktoren begünstigen den Third-Person Effect?
Kapitel 6 behandelt ausführlich die Bedingungen, die das Auftreten des Third-Person Effects begünstigen. Hierzu gehören der Inhalt der Botschaft, ihre Parteilichkeit, die Vertrauenswürdigkeit der Quelle, die soziale Erwünschtheit, demografische Merkmale der Rezipienten, Selbstüberhöhung, Involviertheit und soziale Distanz. Jedes dieser Elemente wird detailliert untersucht.
Wie wird die Hypothese des Third-Person Effects belegt?
Kapitel 7 präsentiert und analysiert die Ergebnisse von Umfragen, die der quantitativen Validierung der Hypothese dienen. Die Ergebnisse empirischer Untersuchungen werden diskutiert und ihre Relevanz für das Verständnis des Third-Person Effects herausgestellt.
Wie verhält sich der Third-Person Effect zu anderen Kommunikationsmodellen?
Der Text untersucht die Beziehung des Third-Person Effects zu anderen Kommunikationsmodellen (z.B. der Schweigespirale), um seine Einordnung und seine Besonderheiten zu verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Third-Person Effect, Massenkommunikation, öffentliche Meinung, Medienwirkung, Wahrnehmung, Beeinflussung, Kommunikationsmodelle, empirische Forschung, demografische Faktoren, Informationsverarbeitung.
Wo finde ich Beispiele für den Third-Person Effect?
Der Text enthält zwar keine expliziten, ausgeführten Beispiele, verweist aber auf die Veranschaulichung des Effekts im Laufe der Arbeit und nutzt die Anekdote der japanischen Propaganda im Zweiten Weltkrieg zur Einführung des Themas. Die empirischen Befunde in Kapitel 7 dienen implizit als Beispiele.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text ist für akademische Zwecke bestimmt und richtet sich an Leser, die sich mit dem Thema Massenkommunikation, Medienwirkung und der Wahrnehmung von Beeinflussung auseinandersetzen möchten.
- Quote paper
- Christian Ritter (Author), 2007, Der Third-Person Effect, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/82519