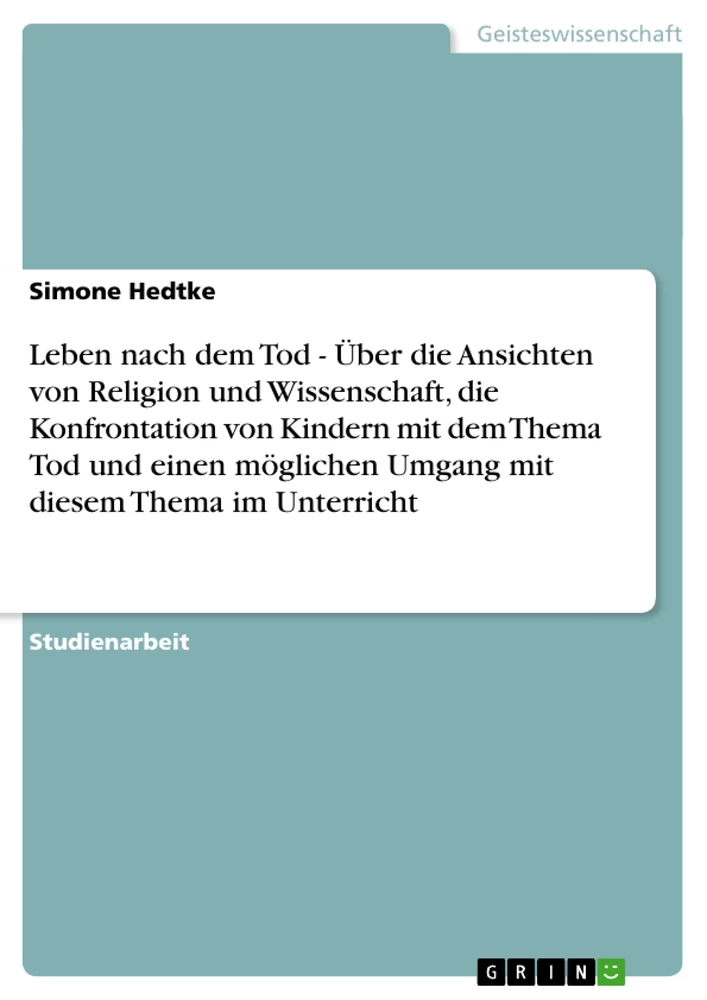Sterben und Tod – das ist häufig noch ein tabuisiertes Thema in unserer Gesellschaft. Die Assoziation zum Thema Tod sind eher von Alter und Krankheit geprägt und nicht von dem Bild junger Leute. Doch auch Kinder kommen in Berührung mit dem Tod. Sie erleben das Verblühen von Blumen und Pflanzen, sehen einen toten Igel auf der Straße, leiden unter dem Tod eines Haustieres und sie werden immer wieder mit diesem Thema in den Medien konfrontiert. Manche Kinder erleben auch schon die schmerzliche Erfahrung einen geliebten Menschen zu verlieren.
So vielfältig die Anlässe sind, so vielfältig sind auch die Auseinandersetzungen mit diesem Begriff. Wie aber soll man am besten mit Kindern und Jugendlichen darüber reden? Was für Vorstellungen soll man ihnen vermitteln? Und wie baut man diesen Themenkomplex am besten in den Unterricht ein? Wichtig für diese Entscheidungen sind natürlich auch die Kinder selbst, die aus verschiedenen Kulturen und Religionen zusammengefunden haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ansichten in den verschiedenen Weltreligionen
- 2.1 Der Islam
- 2.2 Das Judentum
- 2.3 Der Hinduismus
- 2.4 Der Buddhismus
- 2.5 Das Christentum
- 2.5.1 Die Auferstehung
- 2.5.2 Ansätze zur Systematisierung
- 2.5.3 Die doppelte Auferstehung
- 2.5.4 Das kirchliche Bild vom Tod
- 2.5.5 Himmel und Hölle
- 2.5.6 Der Läuterungsort
- 3. Der Tod in der Wissenschaft und der Gesellschaft
- 3.1 Tod in der Wissenschaft
- 3.2 Tod in der Gesellschaft
- 4. Vorstellung vom Tod bei Kindern
- 4.1 Kinder bis drei Jahren (sensomotorische Phase)
- 4.2 Kinder zwischen drei und fünf Jahren (prä-operationelle Phase)
- 4.3 Kinder zwischen fünf und neun Jahren (konkret-operationelle Phase)
- 4.4 Kinder von zehn bis vierzehn Jahren (formal-operationale Phase)
- 5. Thema Tod im Unterricht
- 5.1 Umgang mit dem Thema in den verschiedenen Altersstufen
- 5.2 Didaktische Materialien für den Unterricht
- 5.2.1 Zeichnungen
- 5.2.2 Das Kohelet-Gedicht (Koh 3, 1-8)
- 5.2.3 „Frag doch mal…“
- 5.2.4 „Abschied von Rune“
- 5.2.5 Bücher/ Geschichten
- 5.2.6 Gedichte
- 5.2.7 Karikatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht verschiedene Perspektiven auf den Tod, von religiösen Ansichten bis hin zur Wahrnehmung bei Kindern und der Integration des Themas in den Unterricht. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Auseinandersetzung mit dem Tod in unterschiedlichen Kontexten zu liefern.
- Religiöse Vorstellungen vom Leben nach dem Tod
- Die gesellschaftliche und wissenschaftliche Betrachtung des Todes
- Die Entwicklung der Todesvorstellung bei Kindern
- Didaktische Ansätze zum Thema Tod im Unterricht
- Der Umgang mit dem Tabuthema Tod
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema Tod als ein Tabu in unserer Gesellschaft dar und betont die Notwendigkeit, offen mit Kindern und Jugendlichen darüber zu sprechen. Sie hebt die verschiedenen Berührungspunkte von Kindern mit dem Tod hervor (z.B. Tod von Haustieren, Medienberichterstattung) und unterstreicht die Wichtigkeit kultureller und religiöser Hintergründe bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Die Einleitung formuliert die zentralen Fragestellungen der Arbeit: Wie spricht man am besten mit Kindern und Jugendlichen über den Tod? Welche Vorstellungen sollen vermittelt werden? Wie integriert man das Thema in den Unterricht?
2. Ansichten in den verschiedenen Weltreligionen: Dieses Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Auffassungen des Lebens nach dem Tod in fünf großen Weltreligionen (Islam, Judentum, Hinduismus, Buddhismus, Christentum). Es wird jeweils kurz auf die jeweilige Sichtweise eingegangen, ohne dabei tief in Details einzelner Glaubensrichtungen einzutauchen. Der Fokus liegt auf den grundlegenden Unterschieden in den jeweiligen Vorstellungen von Jenseits und Gericht.
4. Vorstellung vom Tod bei Kindern: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Verständnisses vom Tod bei Kindern in verschiedenen Altersstufen, basierend auf den Phasen der kognitiven Entwicklung nach Piaget. Es wird aufgezeigt, wie sich die kindliche Vorstellung vom Tod von einer naiven, wenig differenzierten Wahrnehmung hin zu einem komplexeren Verständnis entwickelt. Die jeweiligen altersabhängigen Denkweisen werden in Bezug auf den Umgang mit dem Thema Tod erläutert.
5. Thema Tod im Unterricht: Dieses Kapitel befasst sich mit der didaktischen Herausforderung, das Thema Tod altersgerecht im Unterricht zu behandeln. Es werden verschiedene methodische Ansätze und Materialien vorgestellt, die den Kindern helfen sollen, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Die Auswahl geeigneter Materialien, wie Zeichnungen, Gedichte, Geschichten und Diskussionen, wird in Abhängigkeit vom Alter und der kognitiven Entwicklung der Schüler betrachtet.
Schlüsselwörter
Tod, Sterben, Religion, Kinder, Jugendliche, Unterricht, Didaktik, Weltreligionen, Islam, Judentum, Christentum, Hinduismus, Buddhismus, Trauer, Todesvorstellung, kognitive Entwicklung, Altersstufen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel der Seminararbeit einfügen]
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht verschiedene Perspektiven auf den Tod. Sie betrachtet religiöse Ansichten, die Wahrnehmung des Todes bei Kindern, die gesellschaftliche und wissenschaftliche Betrachtung sowie die Integration des Themas in den Unterricht. Ziel ist ein umfassendes Bild der Auseinandersetzung mit dem Tod in unterschiedlichen Kontexten.
Welche religiösen Ansichten zum Tod werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Auffassungen des Lebens nach dem Tod in fünf großen Weltreligionen: Islam, Judentum, Hinduismus, Buddhismus und Christentum. Es werden die grundlegenden Unterschiede in den Vorstellungen von Jenseits und Gericht dargestellt.
Wie wird die Entwicklung der Todesvorstellung bei Kindern beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung des Verständnisses vom Tod bei Kindern in verschiedenen Altersstufen (basierend auf Piagets kognitiven Entwicklungsphasen). Es wird gezeigt, wie sich die kindliche Vorstellung vom Tod von einer naiven Wahrnehmung zu einem komplexeren Verständnis entwickelt.
Wie wird das Thema Tod im Unterricht behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der didaktischen Herausforderung, das Thema Tod altersgerecht im Unterricht zu behandeln. Es werden verschiedene methodische Ansätze und Materialien (Zeichnungen, Gedichte, Geschichten, Diskussionen) vorgestellt, die Kindern helfen sollen, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Die Auswahl der Materialien wird auf das Alter und die kognitive Entwicklung der Schüler abgestimmt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Ansichten in den verschiedenen Weltreligionen (mit Unterkapiteln zu einzelnen Religionen), Der Tod in der Wissenschaft und Gesellschaft, Vorstellung vom Tod bei Kindern (unterteilt nach Altersgruppen), Thema Tod im Unterricht (mit didaktischen Materialien).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Tod, Sterben, Religion, Kinder, Jugendliche, Unterricht, Didaktik, Weltreligionen, Islam, Judentum, Christentum, Hinduismus, Buddhismus, Trauer, Todesvorstellung, kognitive Entwicklung, Altersstufen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, ein umfassendes Bild der Auseinandersetzung mit dem Tod in verschiedenen Kontexten zu liefern, von religiösen Perspektiven bis hin zur didaktischen Umsetzung im Unterricht. Die Arbeit möchte dazu beitragen, offen und altersgerecht über den Tod zu sprechen.
Wie wird das Thema Tod in der Einleitung dargestellt?
Die Einleitung stellt den Tod als Tabuthema dar und betont die Notwendigkeit, offen mit Kindern und Jugendlichen darüber zu sprechen. Sie hebt verschiedene Berührungspunkte von Kindern mit dem Tod hervor (z.B. Tod von Haustieren, Medienberichterstattung) und unterstreicht die Wichtigkeit kultureller und religiöser Hintergründe.
- Arbeit zitieren
- Simone Hedtke (Autor:in), 2007, Leben nach dem Tod - Über die Ansichten von Religion und Wissenschaft, die Konfrontation von Kindern mit dem Thema Tod und einen möglichen Umgang mit diesem Thema im Unterricht, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/81728