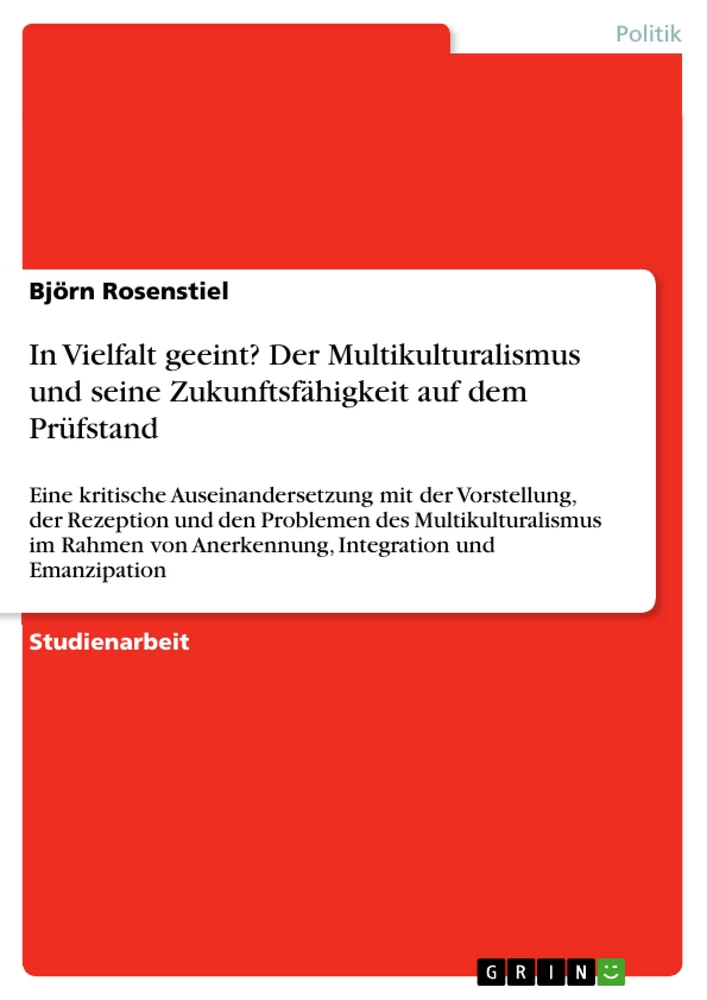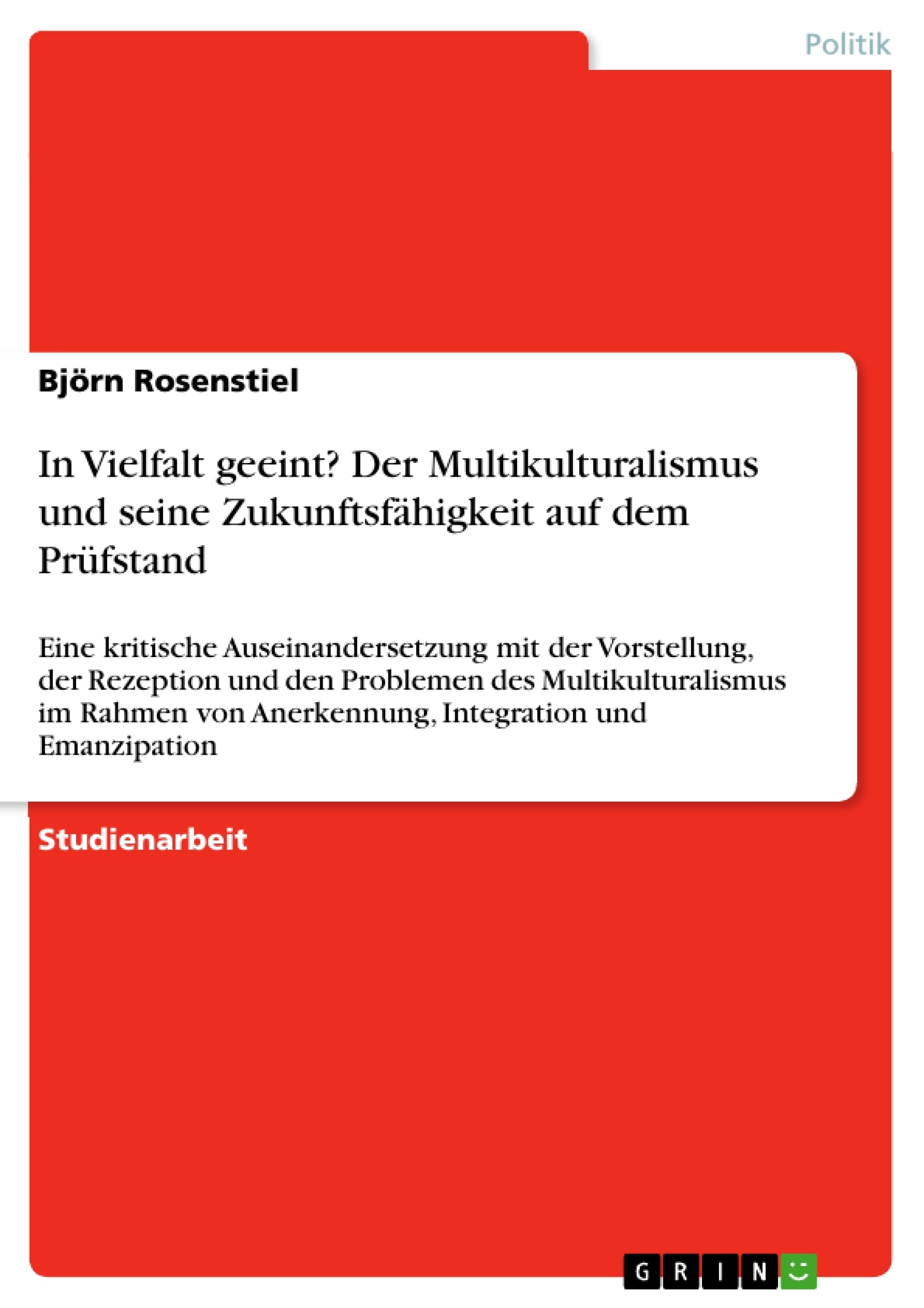In den vergangenen drei Jahrzehnten hat die breite Zuwanderung in die Bundesrepublik Deutschland, ähnlich wie in anderen europäischen Ländern, zu Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur geführt.
In einer Verlautbarung eines Kirchensymposiums im Herbst 1980 in dem die Bundesrepublik als eine multikulturelle Gesellschaft bezeichnet wurde, ist schließlich der Begriff des Multikulturalismus bis heute Gegenstand gesellschaftspolitischer mehr oder weniger produktiver Debatten geworden. Jedoch vermochte es das Symposium über die allgemeine Feststellung hinaus nicht, den Begriff selbst näher zu bestimmen, sowie seine Grenzen und Konturen aufzuzeigen.
Dieser Aufgabe haben sich im Laufe der Zeit wissenschaftliche Vordenker, wie unter anderem Axel Schulte, Jürgen Miksch oder Claus Leggewie gewidmet.
Die Grundlage, der hier angestrebten kritische Auseinandersetzung mit dem Multikulturalismus, seiner Deutungen und Probleme im Rahmen von Anerkennung, Integration und Emanzipation bilden vor allem die Gedanken Axel Schultes, aber auch die Ideen Bassam Tibis sowie die Ergebnisse zweier Untersuchungen zur Situation der Gastarbeiter in den Jahren 1970 und 2004. Die Frage nach dem Verständnis des Multikulturalismus und seiner Zukunftsfähigkeit soll im Vordergrund der Betrachtung stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Utopie und Wirklichkeit
- Der Multikulturalismus und seine Rezeption
- Multikulturalismus als Chance
- Multikulturalismus als Bedrohung
- Multikulturalismus als Ideologie
- Vom multikulturellen Selbstverständnis
- Die Sache mit dem Einwanderungsland
- Ausländergesetzgebung und doppelte Staatsbürgerschaft
- Integration, Isolation und Nichtwissen
- Türken als Partner?
- Anerkennung, Integration und Emanzipation
- Anforderungen an eine pluralistische Gesellschaft
- Leitkultur?
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Vorstellung, Rezeption und Problemen des Multikulturalismus im Kontext von Anerkennung, Integration und Emanzipation. Sie untersucht das Konzept des Multikulturalismus aus einer kritischen Perspektive und analysiert seine Zukunftsfähigkeit in einer globalisierten Welt.
- Das utopische und realistische Verständnis des Multikulturalismus
- Die gesellschaftliche Rezeption des Multikulturalismus als Chance, Bedrohung und Ideologie
- Die Herausforderungen der Integration von Einwanderern, insbesondere der türkischen Minderheit, im Kontext des Multikulturalismus
- Die Bedeutung von Anerkennung, Integration und Emanzipation für eine pluralistische Gesellschaft
- Der Begriff der „Leitkultur“ im Rahmen des multikulturellen Zusammenlebens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar, indem sie die Entwicklung des Multikulturalismus in Deutschland und die Bedeutung seiner kritischen Analyse beleuchtet.
Das zweite Kapitel betrachtet das utopische und realistische Verständnis des Multikulturalismus am Beispiel der „Convivencia“ im mittelalterlichen Spanien.
Kapitel 3 untersucht die Rezeption des Multikulturalismus als Chance, Bedrohung und Ideologie.
Kapitel 4 beleuchtet das multikulturelle Selbstverständnis in der Theorie.
Kapitel 5 analysiert die gesellschaftspolitische Wirklichkeit der Einwanderer, insbesondere der türkischen Minderheit, und zeigt die „ideologischen“ Defizite auf.
Kapitel 6 widmet sich den Anforderungen an eine pluralistische Gesellschaft im Hinblick auf Anerkennung, Integration und Emanzipation und diskutiert den Begriff der „Leitkultur“ von Bassam Tibi.
Schlüsselwörter
Multikulturalismus, Integration, Emanzipation, Anerkennung, Leitkultur, Einwanderung, türkische Minderheit, gesellschaftliche Rezeption, Utopie, Wirklichkeit, „Convivencia“, „Alhambra“-Modell, sozialwissenschaftliche Theorie, Gastarbeiter.
- Quote paper
- Magister Artium Björn Rosenstiel (Author), 2005, In Vielfalt geeint? Der Multikulturalismus und seine Zukunftsfähigkeit auf dem Prüfstand, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/81691