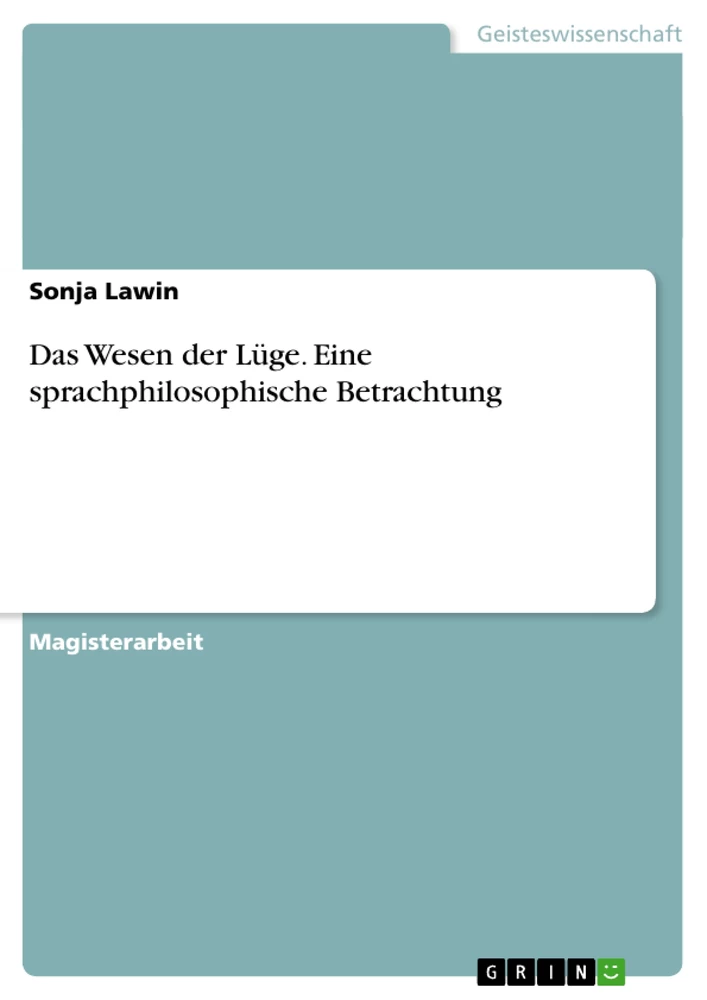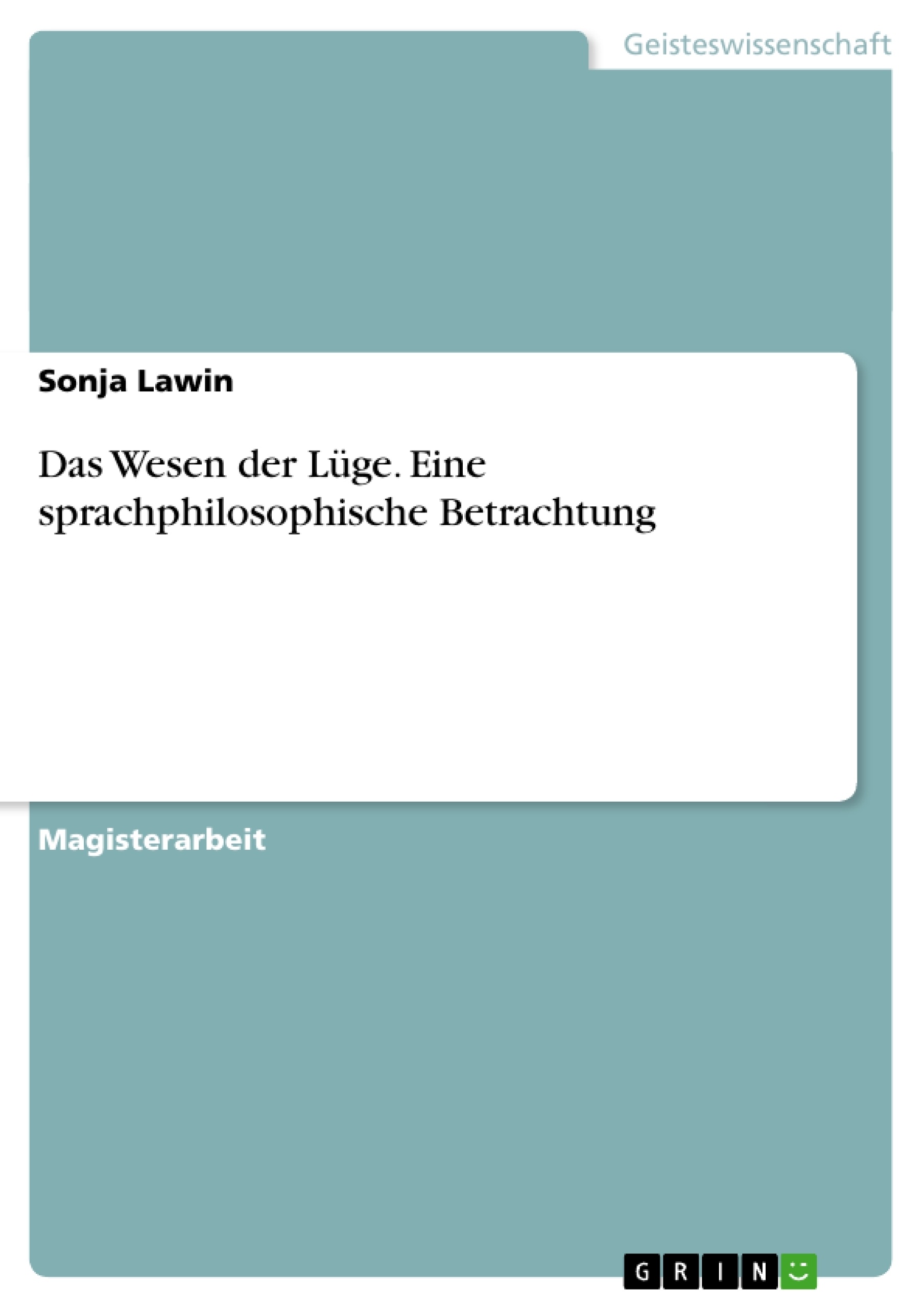„Obwohl spezielle Übung und Studium dabei helfen würden, finden wir, daß Lügen für uns auch ohne Studium natürlich ist“, schrieb Warren Shibles sehr erstaunt. Doch gerade das für uns Natürliche sollte einem genauen Studium unterzogen werden, um bestimmte Gesetzmäßigkeiten ableiten zu können.
Faszinierend an der Lüge ist ihre Vielfältigkeit. Im Allgemeinen gelten Lügen als niederträchtig, "oft sogar als schwerer Verrat.“ Grundsätzlich sind Lügen, genau wie jede sprachliche Handlung, nichts als die Aneinanderreihung sprachlicher Zeichen nach bestimmten Regeln. Jedes Wort kann eine Lüge sein. Diese Aussage scheint kontraintuitiv, denn Wörter allein sind nur Bezeichnungen und noch keine Aussagen. Werden sie jedoch in einem Kontext gebraucht, der nicht verbalisiert wird, sondern nur mitgedacht, können auch einzelne Wörter "wahr" oder "falsch" sein. Spezieller sind Lügen Behauptun-gen, die, so sie als Lügen aufgedeckt werden, in den meisten Fällen Ablehnung erfahren. Diese Missbilligung bezieht sich nicht nur auf den vermeintlichen Schaden, den der Belogene erleidet, sondern auf die gering eingeschätzte kognitive Leistung, die dem Belogenen zugestanden wird. Wie der Sprecher einer Lüge diese gestaltet, hängt maßgeblich von seiner Einschätzung der Erkenntnisfähigkeit des Hörers ab. Ein zentrales Thema der vorliegenden Arbeit wird demnach sein, welche komplexen Fähigkeiten der Hörer- und Sprecherrolle beim Lügen abverlangt werden.
Der Terminus des „guten Lügners“ ist trotz des semantisch positiv bewertenden Adjektivs nicht frei von Pejoration. Doch unter welchen Voraussetzungen wird die gemeine Lüge positiv bewertet? Welche Kriterien müssen erfüllt sein, um sie von der „schlechten Lüge“ zu unterscheiden und mit welchen Mitteln gelingt das? Welchen Anteil hat der Hörer an der Genese der Lüge? Ist es zeitweise sogar abhängig von Personen und Begleitumständen, ob eine Behauptung eine Lüge ist?
Das Ziel dieser Magisterarbeit ist es darzulegen, dass die gute Lüge für den Menschen eine positive Leistung darstellt, die als Sprachhandlung Fähigkeiten fördert, ohne die die Kommunikation nur auf niedriger Stufe möglich wäre. Durch die Kenntnisse des Aufbaus und der Verwendungsmöglichkeiten der Lüge gelangt der Sprecher zu einer optimalen Sprachkompetenz. Die Abstufungen der kognitiven Leistungen des Sprechers, der erfolgreich täuscht, stelle ich in einer Lügenskala dar. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Ziel der Arbeit
- 1.2 Forschungslage zur sprachlichen Untersuchung des Lügens
- 1.3 Vorgehen
- 2. Die Lügen - Definitionsversuche
- 2.1 Die Lüge aus historischer Sicht
- 2.2 Die Wahrhaftigkeit als Gegenbegriff zur Lüge
- 2.3 Die Lüge als sprachliche Handlung
- 2.4 Lüge vs. Täuschung
- 2.5 Worte der Lüge
- 2.6 Die Definition der Lüge
- 3. Die Akteure der guten Lüge
- 3.1 Die Ontogenese des Lügners
- 3.2 Von der Unmöglichkeit, sich selbst zu täuschen
- 3.3 Die Rolle des Sprechers
- 3.4 Die Rolle des Hörers
- 3.5 Die Beziehung zwischen Hörer und Sprecher
- 3.6 Die Skale des guten Lügens
- 4. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit von Sonja Lawin zielt darauf ab, die "gute Lüge" als eine positive Leistung des Menschen darzustellen, die die Fähigkeiten der Kommunikation fördert. Sie argumentiert, dass die Kenntnis des Aufbaus und der Verwendungsmöglichkeiten der Lüge dem Sprecher zu einer optimalen Sprachkompetenz verhilft. Die Arbeit untersucht die komplexen Fähigkeiten, die die Hörer- und Sprecherrolle beim Lügen erfordern.
- Definition der Lüge aus sprachwissenschaftlicher Perspektive
- Die Rolle des Hörers bei der Konstruktion der Lüge
- Analyse der Rollen des Sprechers (Lügners) und des Hörers (Belogenen)
- Entwicklung einer Lügenskala, die die Abstufungen der kognitiven Leistungen des Sprechers beim erfolgreichen Täuschen darstellt
- Bewertung der "guten Lüge" im Vergleich zur "schlechten Lüge" und deren Einfluss auf die Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel präsentiert das Ziel der Arbeit, das darin besteht, die "gute Lüge" als eine positive Leistung im Rahmen der Kommunikation zu betrachten. Außerdem werden die Forschungslage zur sprachlichen Untersuchung des Lügens und das Vorgehen in der Arbeit erläutert.
- Kapitel 2: Die Lügen - Definitionsversuche
In diesem Kapitel werden verschiedene Definitionsversuche der Lüge aus historischer und sprachwissenschaftlicher Perspektive betrachtet. Die Wahrhaftigkeit wird als Gegenbegriff zur Lüge diskutiert, und die Lüge als sprachliche Handlung analysiert. Es werden zudem Unterschiede zwischen Lüge und Täuschung aufgezeigt, und die Verwendung von "Worten der Lüge" beleuchtet. Das Kapitel endet mit einer Definition der Lüge.
- Kapitel 3: Die Akteure der guten Lüge
Dieses Kapitel befasst sich mit den Akteuren der "guten Lüge" - dem Lügner und dem Belogenen. Es untersucht die Ontogenese des Lügners, die Frage der Selbsttäuschung und die Rollen des Sprechers und des Hörers im Prozess der Lüge. Darüber hinaus wird die Beziehung zwischen Hörer und Sprecher sowie die Skala des "guten Lügens" analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen der Lüge, Wahrhaftigkeit, Sprachhandlung, Kommunikation, Sprecherrolle, Hörerrolle, Täuschung, kognitiven Leistungen und der Unterscheidung zwischen "guter" und "schlechter" Lüge. Der Fokus liegt auf der pragmalinguistischen Analyse des Lügens und der Entwicklung einer Theorie der "guten Lüge" als ein Mittel zur optimalen Sprachkompetenz.
- Quote paper
- Sonja Lawin (Author), 2007, Das Wesen der Lüge. Eine sprachphilosophische Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/80624