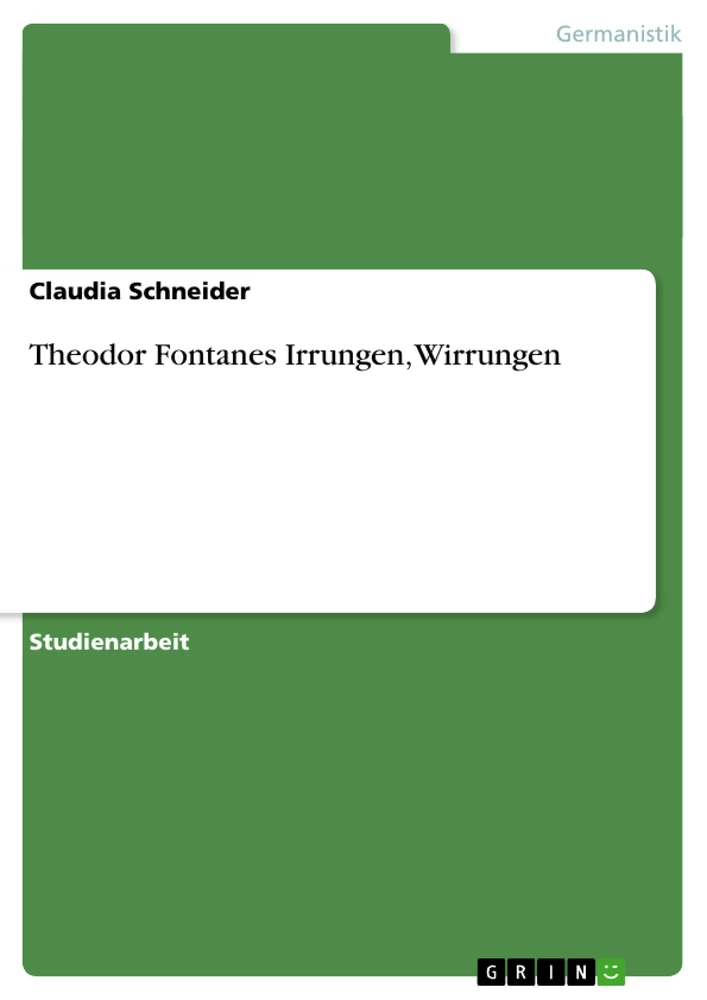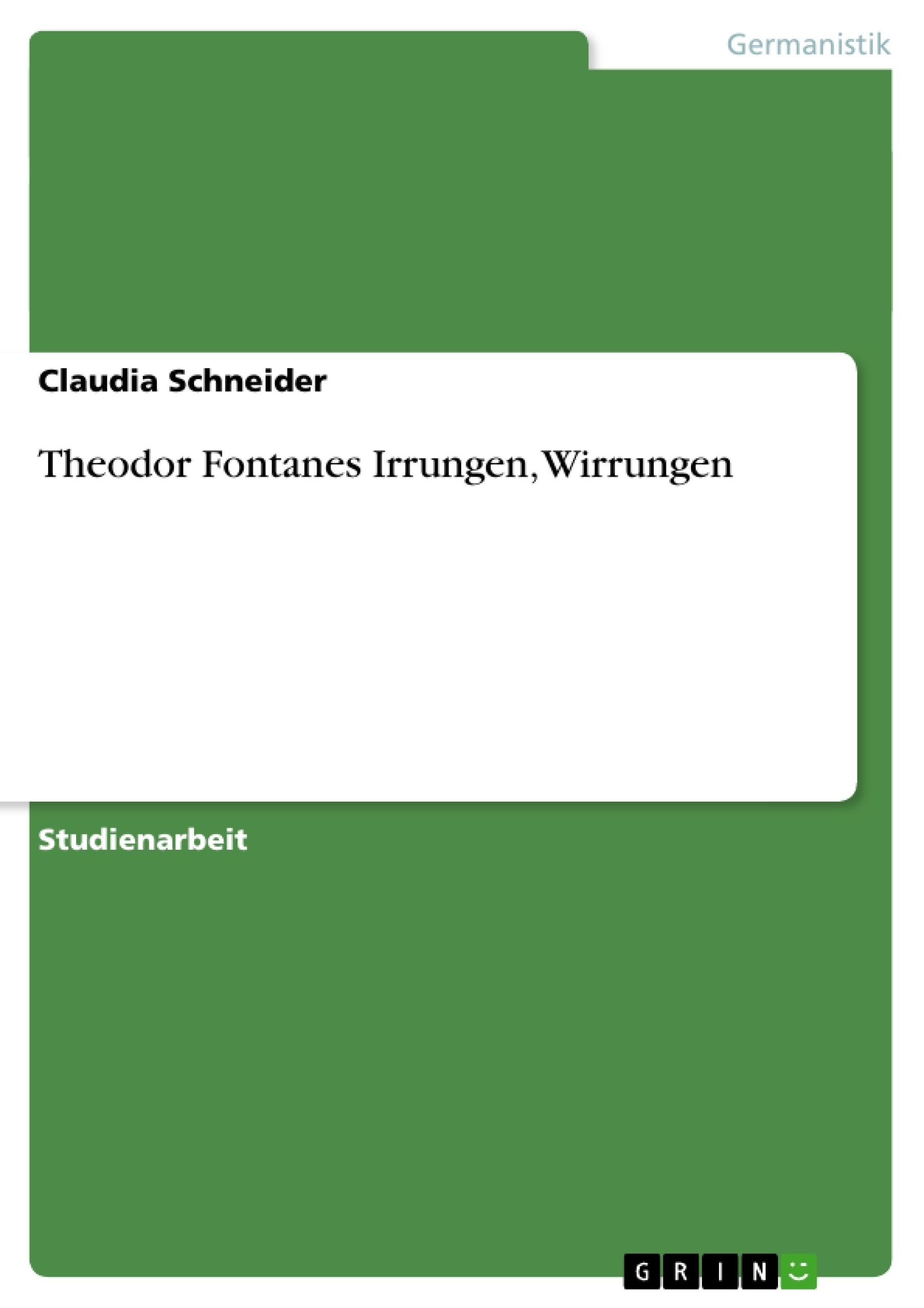Fontanes "Irrungen, Wirrungen" erschien 1888 in der Buchausgabe und wurde sowohl von den Lesern als auch von den Kritikern zwiespältig aufgenommen. Im Mittelpunkt des Romans steht vordergründig das freie und unstandesgemäße Liebesverhältnis des Barons Botho von Rienäcker mit der Näherin Lene Nimptsch. Die Beziehung wird jedoch bereits in der Mitte der Erzählung wieder gelöst, da Botho sich verpflichtet fühlt, eine Heirat mit der begüterten Käthe von Sellenthin einzugehen und damit die Finanzen seiner Familie aufzubessern. Der Roman schildert weiter, wie deutlich sich dieses Verhältnis von den im 19. Jahrhundert durchaus "üblichen" Affären zwischen Offizieren und Mädchen von niederem Stand abhebt, da sowohl Botho als auch Lene ihre Liebe in ihrer Erinnerung lebendig halten und sich dies insbesondere auf das weitere Leben Lenes auswirkt. Aus Angst, noch einmal ihrem geliebten Botho an der Seite seiner Frau zu begegnen, zieht sie gemeinsam mit ihrer Ziehmutter in ein weit entferntes Stadtviertel, wo sie die Bekanntschaft mit dem Fabrikmeister Gideon Franke macht, der sie schließlich trotz ihrer Vergangenheit heiratet.
"Irrungen, Wirrungen" ist kein Trauerspiel oder eine Tragödie im klassischen Sinne, da es am Ende weder zu einem dramatischen Mord noch zu einem Selbstmord kommt. Fontane wählt einen subtileren und unspektakuläreren Weg, um die Tragik dieser unstandesgemäßen Liebe darzustellen. Sowohl Botho als auch Lene sind am Ende des Romans mit durchaus respektablen Partnern verheiratet, müssen aber auf die Erfüllung ihres gemeinsamen Glücks verzichten und vor der gesellschaftlichen Ordnung resignieren.
Wie bereits eingangs erwähnt, wurde Fontanes Roman "Irrungen, Wirrungen" nicht von allen Lesern und Kritikern als Glanzstück betrachtet. Die noch zahlreich erhaltenen Berichte aus zeitgenössischen Zeitungen und Aufsätzen zeichnen mit ihrer Kritik ein klares Bild der Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Um Fontanes Kritik an der Doppelmoral seiner Umwelt zu verstehen, muß zunächst die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Romans "Irrungen, Wirrungen" näher betrachtet werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehungs- und Wirkungsgeschichte
- Die Epoche des Realismus
- Die zentralen Personen
- Fontane als Gesellschaftskritiker?
- Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Theodor Fontanes Roman „Irrungen, Wirrungen“ mit dem Ziel, die Entstehungsgeschichte, die zentralen Figuren und die gesellschaftskritischen Aspekte des Werkes zu beleuchten. Sie befasst sich mit Fontanes Kritik an der Doppelmoral seiner Zeit und analysiert den Roman im Kontext der Epoche des Realismus.
- Die Liebesgeschichte zwischen Botho und Lene im Kontext der gesellschaftlichen Normen des 19. Jahrhunderts
- Fontanes Darstellung von gesellschaftlichen Konventionen und deren Einfluss auf die Entscheidungen der Figuren
- Die Rolle von Stand und gesellschaftlicher Stellung in der Gestaltung der Beziehungen zwischen den Figuren
- Fontanes Kritik an der Doppelmoral und den Ungleichgewichten der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
- Die Rolle der Erinnerung und der Vergangenheit im Leben der Figuren
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Roman „Irrungen, Wirrungen“ vor, beschreibt die Handlung und die Beziehung zwischen Botho und Lene. Sie beleuchtet die zentrale Thematik der unstandesgemäßen Liebe und die Tragik des Romans.
- Entstehungs- und Wirkungsgeschichte: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung des Romans im Kontext von Fontanes Leben und der literarischen Epoche des Realismus. Es analysiert die Reaktionen des Publikums und der Kritik auf „Irrungen, Wirrungen“ sowie die Quellen, auf die Fontane bei der Entstehung des Romans zurückgriff.
- Die Epoche des Realismus: Dieses Kapitel beleuchtet den Realismus als literarische Epoche und seine Charakteristiken. Es analysiert, wie Fontanes Roman „Irrungen, Wirrungen“ in diese Epoche einzuordnen ist und welche Elemente des Realismus im Werk erkennbar sind.
- Die zentralen Personen: Das Kapitel fokussiert auf die wichtigsten Figuren des Romans, insbesondere auf Botho, Lene, Käthe und Gideon. Es analysiert die Beziehungen zwischen den Figuren, ihre Beweggründe und ihre Entwicklung im Laufe der Handlung.
- Fontane als Gesellschaftskritiker?: Dieses Kapitel untersucht Fontanes Kritik an der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Es beleuchtet die Kritik an der Doppelmoral, den sozialen Ungleichgewichten und der Macht der Konventionen in Fontanes Roman.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Themen der unstandesgemäßen Liebe, gesellschaftliche Konventionen, Doppelmoral, soziale Ungleichgewichte, Realismus, Gesellschaftskritik und die Rolle der Erinnerung im 19. Jahrhundert. Sie analysiert Fontanes Roman "Irrungen, Wirrungen" in Bezug auf diese Themen und setzt den Roman in den Kontext der literarischen Epoche des Realismus.
- Quote paper
- Claudia Schneider (Author), 2002, Theodor Fontanes Irrungen, Wirrungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/8058