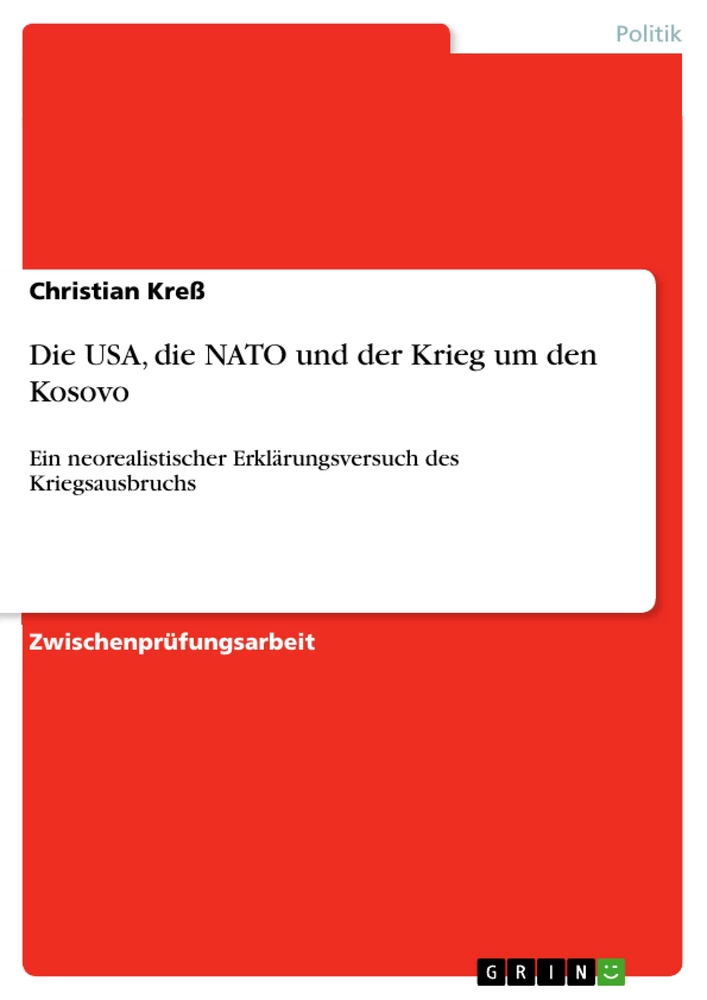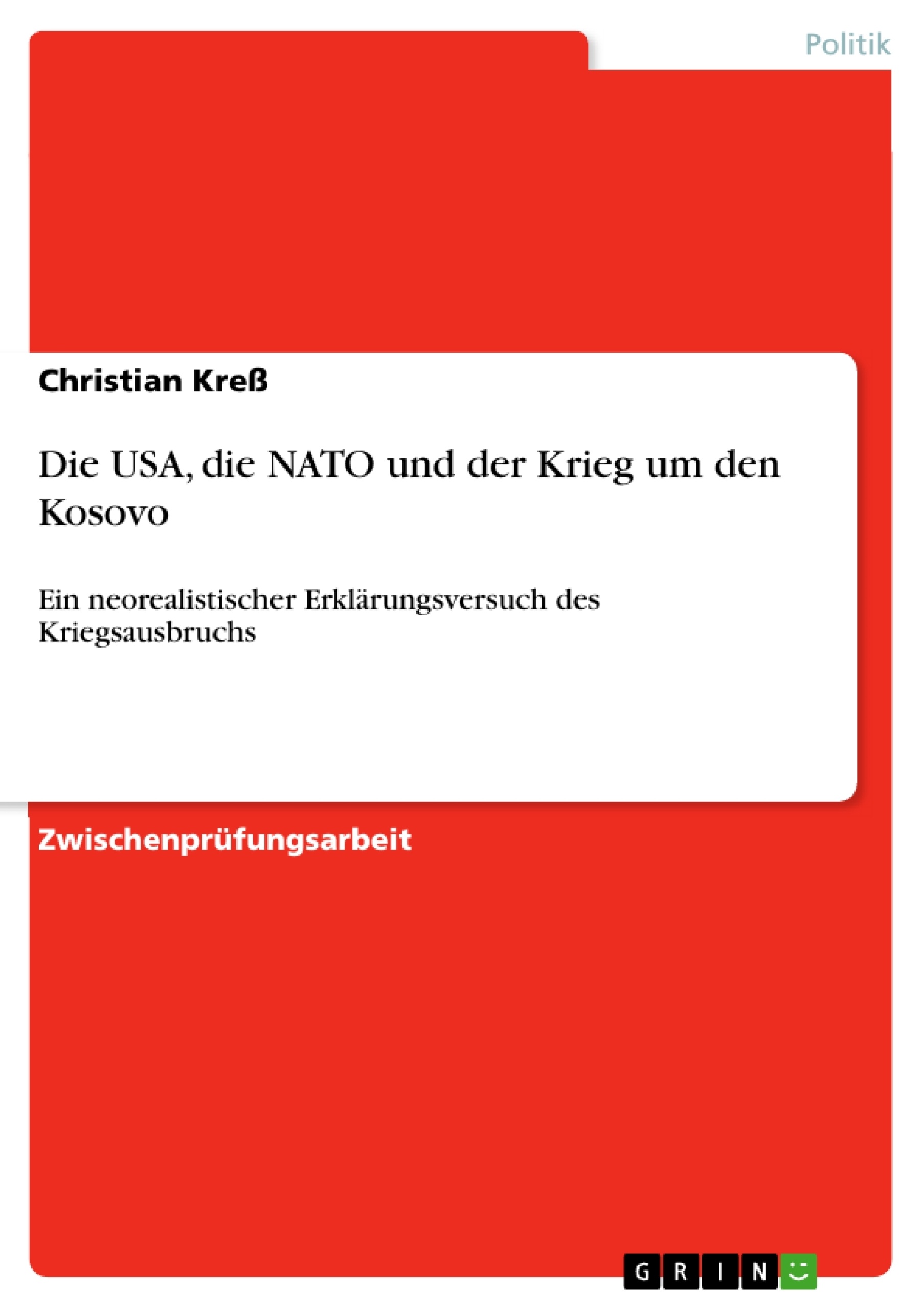Václav Havel, ehemals tschechischer Staatspräsident, sagte einmal: „If one can say of any war that it is ethical, or that it is being waged for ethical reasons, then it is true of this war”. Havel meinte den Krieg um den Kosovo, den die NATO am 24. März 1999 gegen die Bundesrepublik Jugoslawien initiierte. Die internationale Gemeinschaft brachte bei der öffentlichen Begründung für ihre Intervention hauptsächlich ethische und moralische Argumente hervor. Die USA, die sowohl bei der Planung als auch bei der Durchführung der Intervention führend waren, erklärten stets, dass durch das militärische Eingreifen den gewaltsamen Repressionen der Serben gegenüber den Kosovo-Albanern ein Ende bereitet werden sollte. Jedoch stellt sich die Frage, welche nationalen beziehungsweise strategischen Sicherheits- und Machtinteressen hinter der Intervention gestanden haben könnten. Diese Arbeit will eine Antwort auf diese Frage liefern. Mithilfe der populären Theorie des Neorealismus soll untersucht werden, inwieweit die strukturelle Beschaffenheit des internationalen Systems und die daraus resultierenden Implikationen für das Verhalten der Staaten den Ausbruch des Krieges zwischen NATO und Jugoslawien erklären können.
Diese Arbeit ist klar strukturiert: Zunächst wird der Konflikt zwischen der internationalen Gemeinschaft und der Bundesrepublik Jugoslawien bis zum Kriegsausbruch ausführlich beschrieben, indem der Konfliktgegenstand, die Konfliktparteien und ihre Positionsdifferenzen, der Konfliktverlauf (angefangen bei den Studentendemonstrationen im Kosovo 1981 bis hin zum Start der NATO-Luftschläge gegen Serbien am 24. März 1999) sowie der Konfliktaustrag näher analysiert werden. Anschließend wird die Theorie des Neorealismus vorgestellt, wie sie von Kenneth N. Waltz entwickelt worden ist: Aus dessen Grundannahmen über das internationale System und seine Akteure werden drei Hypothesen abgeleitet, mit denen die Wahrscheinlichkeit eines Kriegsausbruchs erklärt werden kann. Diese Hypothesen werden schließlich fallspezifisch auf den Kosovo-Krieg angewendet. Hierbei soll nicht nur untersucht werden, welche strategischen Macht- und Sicherheitsinteressen die USA in ihrer Kriegsentscheidung geleitet haben, sondern auch der Widerstand Jugoslawiens gegen die ultimativen Forderungen der internationalen Gemeinschaft sowie der Verstoß der USA gegen die Charta der Vereinten Nationen werden Gegenstand der Analyse sein.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Konfliktbeschreibung
- 2.1. Konfliktgegenstand
- 2.1.1. Bestimmung des Sachbereichs
- 2.1.2. Konkretisierung
- 2.2. Konfliktparteien und ihre Positionen
- 2.2.1. Akteure und ihr Verhältnis zueinander
- 2.2.2. Positionsdifferenzen
- 2.3. Konfliktverlauf
- 2.3.1. Vorgeschichte des Konflikts zwischen Kosovo-Albanern und Serben
- 2.3.2. Verlauf des Konflikts zwischen internationaler Gemeinschaft und den beiden Konfliktparteien im Streit um den Kosovo
- 2.3.2.2. Manifestierung des Konflikts: März 1998 bis September 1998
- 2.4. Konfliktaustragung
- 2.4.1. Versuch und Scheitern eines bilateralen Dialogs: bis zum Herbst 1998
- 2.4.2. Forcierte Kooperation und Verhandlungen: Herbst 1998 bis Ende 1999
- 2.4.3. Vorbereitung und Durchführung der Rambouillet-Konferenz: Januar bis März 1999
- 2.4.4. Fazit
- III. Theorie des Neorealismus nach Waltz
- 3.1. Entstehung
- 3.2. Grundannahmen über das internationale System
- 3.2.1. Akteure
- 3.2.2. Struktur des internationalen Systems
- 3.3. Kausalmechanismen
- 3.3.1. Explanans (unabhängige Variable)
- 3.3.2. Explanandum (abhängige Variable)
- 3.4. Hypothesen zum Kriegsrisiko
- 3.5. Kritik
- 3.5.1. theorieintern
- 3.5.2. theorieextern
- IV. Hypothesengeleitete neorealistische Erklärung des Ausbruchs des Kosovo-Krieges unter besonderer Berücksichtigung der USA
- 4.1. Einleitung
- 4.2. Hypothesen
- V. Zusammenfassende Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Ausbruch des Kosovo-Krieges 1999 aus neorealistischer Perspektive. Ziel ist es, die Rolle der strukturellen Bedingungen des internationalen Systems und der daraus resultierenden Handlungen der Akteure, insbesondere der USA, im Hinblick auf den Kriegsausbruch zu erklären. Die Arbeit analysiert die nationalen und strategischen Sicherheits- und Machtinteressen, die hinter der Intervention der NATO gestanden haben könnten.
- Der Kosovo-Konflikt als innerstaatlicher Konflikt mit internationaler Intervention
- Analyse der Konfliktparteien (Serbien, Kosovo-Albaner, internationale Gemeinschaft)
- Anwendung der neorealistischen Theorie von Kenneth Waltz auf den Kosovo-Konflikt
- Die Rolle der USA in der Entscheidung zum Kriegseintritt
- Bewertung der Sicherheits- und Machtinteressen der beteiligten Akteure
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den nationalen und strategischen Interessen der USA im Kosovo-Krieg, die hinter der vermeintlich humanitären Intervention steckten. Sie skizziert den methodischen Ansatz: Eine neorealistische Analyse der strukturellen Bedingungen des internationalen Systems und des daraus resultierenden Akteursverhaltens. Die Arbeit verspricht eine detaillierte Konfliktbeschreibung und die Anwendung neorealistischer Hypothesen auf den konkreten Fall.
II. Konfliktbeschreibung: Dieses Kapitel beschreibt den Kosovo-Konflikt detailliert. Es analysiert den Konfliktgegenstand (Herrschaft und Sicherheit im Kosovo), die Konfliktparteien (Serbien, Kosovo-Albaner, internationale Gemeinschaft) und ihre jeweiligen Positionen, den Konfliktverlauf und die verschiedenen Phasen der Konfliktaustragung. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Interessen und Perspektiven der beteiligten Akteure und dem Eskalationsprozess, der letztendlich zum Krieg führte. Die Analyse der Vorgeschichte, insbesondere die Entwicklung der Spannungen zwischen Serben und Kosovo-Albanern, bildet eine wichtige Grundlage für das Verständnis des Konflikts.
III. Theorie des Neorealismus nach Waltz: Dieses Kapitel präsentiert die neorealistische Theorie von Kenneth Waltz. Es erläutert die Grundannahmen des Neorealismus über das internationale System, die zentralen Akteure und die daraus abgeleiteten Kausalmechanismen. Drei Hypothesen zum Kriegsrisiko werden formuliert, die im weiteren Verlauf der Arbeit auf den Kosovo-Konflikt angewendet werden. Die Stärken und Schwächen des neorealistischen Ansatzes werden kritisch diskutiert, um die Grenzen und Möglichkeiten des gewählten Erklärungsmodells zu verdeutlichen. Die detaillierte Darstellung der Theorie bildet die analytische Grundlage für die anschließende Fallstudie.
IV. Hypothesengeleitete neorealistische Erklärung des Ausbruchs des Kosovo-Krieges unter besonderer Berücksichtigung der USA: Dieses Kapitel wendet die im vorherigen Kapitel entwickelten neorealistischen Hypothesen auf den Kosovo-Krieg an. Es analysiert, inwieweit die strukturellen Bedingungen des internationalen Systems und die daraus resultierenden Handlungen der Akteure, insbesondere der USA, den Ausbruch des Krieges erklären können. Der Fokus liegt auf der Analyse der Sicherheits- und Machtinteressen der USA und ihrer Rolle als zentraler Akteur in der NATO-Intervention. Das Kapitel untersucht auch das Verhalten Jugoslawiens und die Verletzung internationaler Normen durch die USA. Die Anwendung der Theorie auf den konkreten Fall erlaubt eine überprüfung der im dritten Kapitel dargelegten Hypothesen.
Schlüsselwörter
Kosovo-Krieg, Neorealismus, Internationale Beziehungen, NATO, USA, Jugoslawien, Sicherheitsinteressen, Machtpolitik, Konfliktanalyse, Intervention, humanitäre Intervention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Kosovo-Krieg: Eine neorealistische Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Ausbruch des Kosovo-Krieges 1999 aus neorealistischer Perspektive. Das zentrale Ziel ist es, die Rolle der strukturellen Bedingungen des internationalen Systems und der daraus resultierenden Handlungen der Akteure, insbesondere der USA, beim Kriegsausbruch zu erklären. Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse der nationalen und strategischen Sicherheits- und Machtinteressen, die hinter der NATO-Intervention gestanden haben könnten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst eine detaillierte Beschreibung des Kosovo-Konflikts, einschließlich der Konfliktparteien (Serbien, Kosovo-Albaner, internationale Gemeinschaft), des Konfliktverlaufs und der Konfliktaustragung. Sie wendet die neorealistische Theorie von Kenneth Waltz auf den Kosovo-Konflikt an und analysiert die Rolle der USA als zentraler Akteur in der NATO-Intervention. Die Arbeit untersucht die Sicherheits- und Machtinteressen der beteiligten Akteure und bewertet die vermeintlich humanitäre Intervention der NATO kritisch.
Welche Methode wird verwendet?
Die Arbeit verwendet einen neorealistischen Ansatz. Das bedeutet, dass die strukturellen Bedingungen des internationalen Systems und das daraus resultierende Akteursverhalten im Mittelpunkt der Analyse stehen. Die Arbeit formuliert Hypothesen zum Kriegsrisiko und prüft diese anhand des Fallbeispiels Kosovo-Krieg.
Welche Akteure werden betrachtet?
Die wichtigsten Akteure sind Serbien, die Kosovo-Albaner, die internationale Gemeinschaft (insbesondere die NATO und die USA). Die Arbeit konzentriert sich besonders auf die Rolle der USA und deren Sicherheits- und Machtinteressen im Kontext des Konflikts.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Konfliktbeschreibung, Theorie des Neorealismus nach Waltz, hypothesengeleitete neorealistische Erklärung des Ausbruchs des Kosovo-Krieges unter besonderer Berücksichtigung der USA und eine zusammenfassende Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas, beginnend mit einer Einführung in die Forschungsfrage und endend mit einer zusammenfassenden Bewertung der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kosovo-Krieg, Neorealismus, Internationale Beziehungen, NATO, USA, Jugoslawien, Sicherheitsinteressen, Machtpolitik, Konfliktanalyse, Intervention, humanitäre Intervention.
Welche konkreten Fragen werden im Rahmen der Konfliktbeschreibung beantwortet?
Die Konfliktbeschreibung analysiert den Konfliktgegenstand (Herrschaft und Sicherheit im Kosovo), die Konfliktparteien und ihre Positionen, den Konfliktverlauf (einschließlich Vorgeschichte und Eskalation) und die verschiedenen Phasen der Konfliktaustragung (z.B. bilaterale Verhandlungen, Rambouillet-Konferenz).
Wie wird der Neorealismus in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit präsentiert zunächst die Grundannahmen des Neorealismus nach Waltz (Akteure, Struktur des internationalen Systems, Kausalmechanismen). Anschließend werden neorealistische Hypothesen zum Kriegsrisiko formuliert und auf den Kosovo-Konflikt angewendet, um den Ausbruch des Krieges zu erklären. Die Stärken und Schwächen des neorealistischen Ansatzes werden kritisch diskutiert.
Welche Rolle spielen die USA in der Analyse?
Die Rolle der USA wird besonders hervorgehoben. Die Arbeit untersucht die Sicherheits- und Machtinteressen der USA, ihre Rolle als zentraler Akteur in der NATO-Intervention und wie ihr Verhalten im Kontext des neorealistischen Modells erklärt werden kann. Die Arbeit hinterfragt die vermeintlich humanitären Motive der US-amerikanischen Intervention.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der neorealistischen Analyse zusammen und bewertet, inwieweit die angewandte Theorie den Ausbruch des Kosovo-Krieges erklären kann. Es wird eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen und Möglichkeiten des neorealistischen Erklärungsmodells geführt.
- Quote paper
- Christian Kreß (Author), 2006, Die USA, die NATO und der Krieg um den Kosovo, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/80463