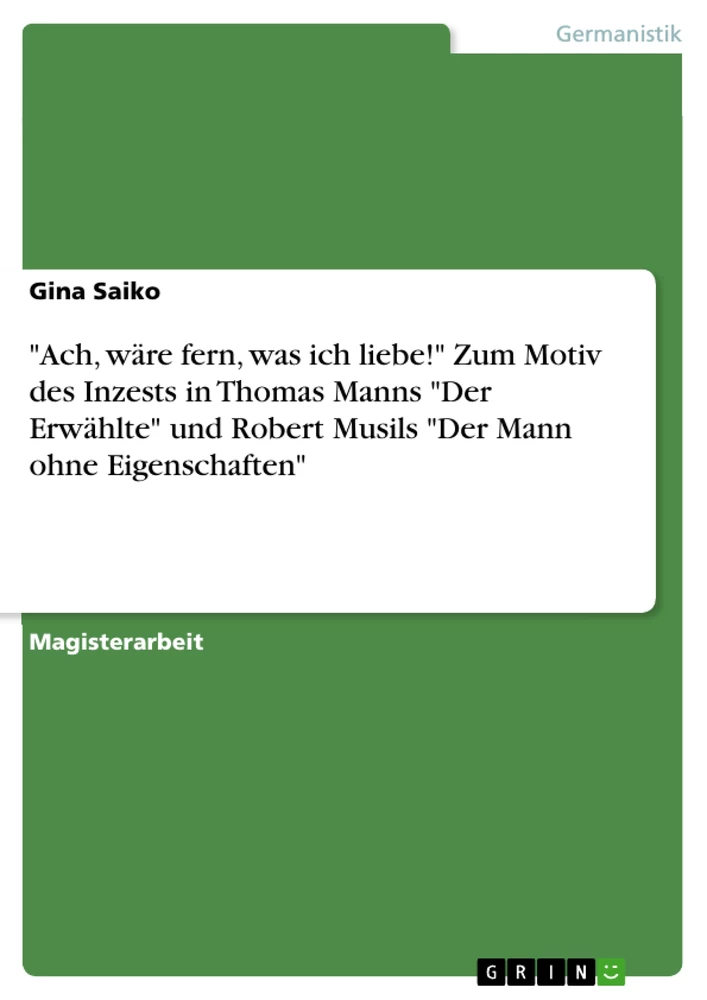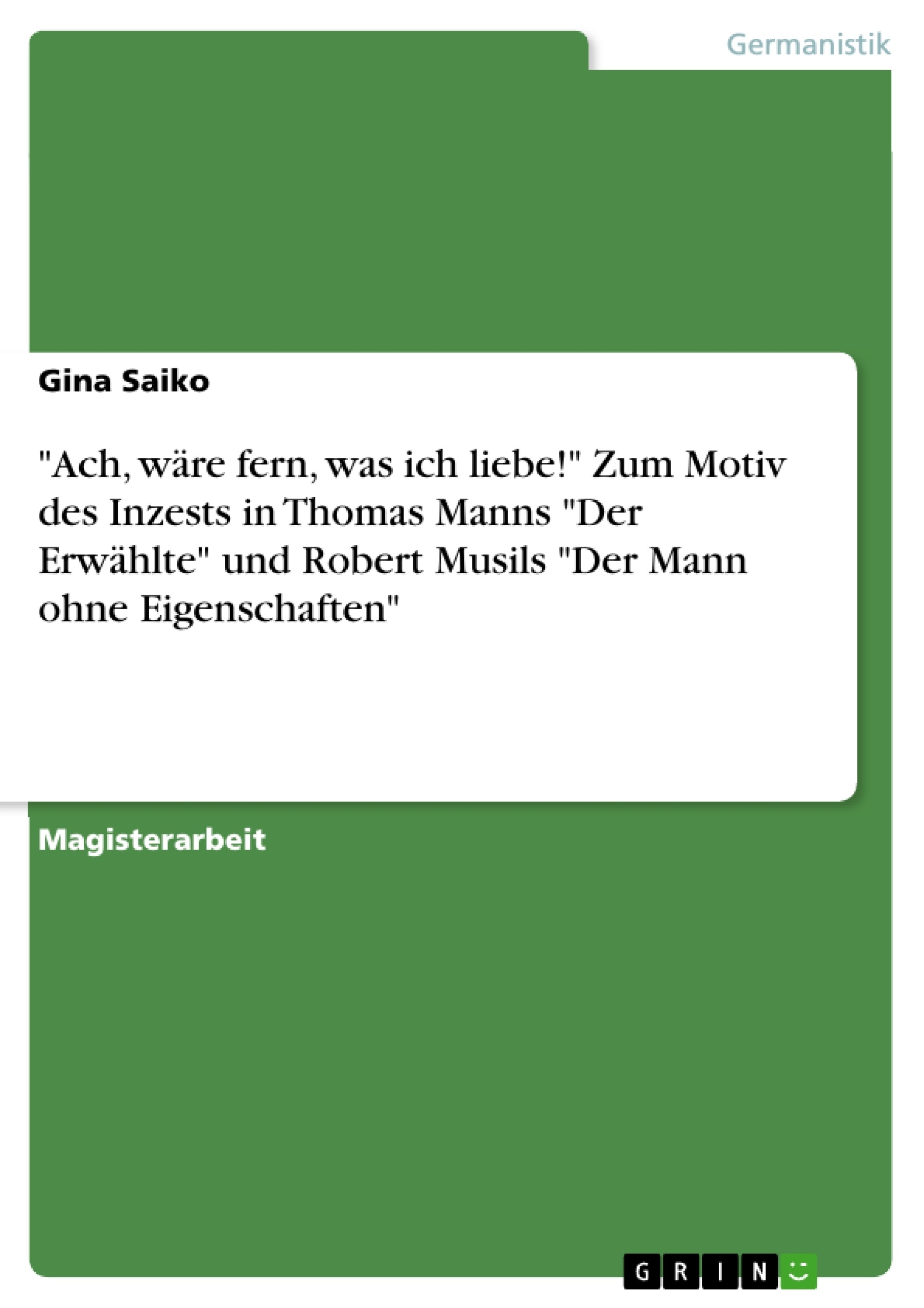Das natürliche Verhalten des Menschen legt ihm nahe, bevorzugt aus subjektiver Perspektive zu entscheiden, zu handeln und zu urteilen. Die Kunst der Intersubjektivität scheint im Alltagsleben noch realisierbar, stößt aber unmittelbar an ihre Grenzen, wenn es darum geht, außergewöhnliche Phänomene nachzuvollziehen. Es stellt sich schnell die Frage danach, wie und warum ein derart dem eigenen Ich fremdes Verhalten existieren kann. Aufgehellt wird dieses ein Übermaß an sozialer Kompetenz postulierende Verhalten durch die Frage nach Motiven. Denn diese liefern oftmals eine Antwort darauf, was uns so unvorstellbar erscheint. Das ist wohl auch der Grund dafür, warum in der Literatur eine tiefgründige Motivik zu finden ist. Mit Hilfe dieser Handlungsketten und Schemata ist es oftmals möglich, einem literarischen Werk Sinn zu verleihen und die Frage nach der „tieferen Botschaft“ zu klären. Dabei ist eines der wohl beliebtesten Motive in der Literatur das Motiv des Inzests, das aufgrund seines ambivalenten Charakters stets von neuem fasziniert.
Dabei bindet sich die Inzestthematik an die unterschiedlichsten Sinnzusammenhänge: Sie ist Zeichen für Dekadenz ebenso wie für Utopie, sie beschreibt sowohl eine grausame Handlung als auch einen Liebesrausch. Und sie ist Ausdruck für Schöpfung wie auch für Destruktion. Inzest stellt sich als eine Thematik dar, die sich gegen Eindeutigkeit sperrt. Diese Uneindeutigkeit der Inzestthematik eröffnet gerade deshalb ein weitläufiges Spektrum, das auch innerfamiliäre Gewalt sowie seelischen und physischen Missbrauch implizieren kann – doch gerade auf literarischer Ebene ist häufig ein durchaus positiv konnotiertes Phänomen gemeint. In welchem Bedeutungszusammenhang das Motiv des Inzests zu setzen ist, in welchen (strukturellen) Kontexten es zutage tritt und welche Intention ein Autor bei der Verwendung dieses Motivs verfolgt, soll in der folgenden Arbeit untersucht werden.
Dabei erfolgt die Beschäftigung mit dem Inzestmotiv anhand der Romane "Der Erwählte" (1951) von Thomas Mann und "Der Mann ohne Eigenschaften" (1930-1952) von Robert Musil. Im "Erwählten" wird dabei eine doppelte Inzestkonstellation aufgezeigt. Aus der Verbindung der Zwillinge Wiligis und Sibylla entspringt das Kind Grigorß, das später eine Beziehung zu seiner Mutter eingehen wird. Im "Mann ohne Eigenschaften" hingegen wird allein das Verhältnis der Geschwister Ulrich und Agathe thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte des Inzests
- Rechts- und Traditionsgeschichte des Inzests
- Ausnahmen des Inzestverbots
- Wissenschaftliche Inzesttheorien: Claude Lévi-Strauss
- Inzest als Tabu
- Das literarische Inzestmotiv
- Poetischer Reiz des Inzestverbots
- Mythische Vorbilder bei Robert Musil
- Platons Bericht vom Kugelmenschen
- Hermaphroditismus und Mondmetaphorik
- Narkissos und Spiegelmetaphorik
- Isis und Osiris
- Androgynität: Begründung der Geschwisterliebe im Mythos
- Vorbilder bei Thomas Mann
- Die Ödipus-Legende
- Mittelalterliche Inzestgeschichten
- Motivstruktur des Inzests
- Strukturbildendes Element und Handlungsschemata
- Zum Geschwisterinzest
- Manns Zwillinge: Wiligis und Sibylla
- Musils Geschwister: Ulrich und Agathe
- Manns Mutter-Sohn-Liebe: Sibylla und Grigorß
- Motivstruktur und Raumsemantik
- Der Erwählte
- Der Mann ohne Eigenschaften
- Die Inzestthematik im Wandel der Zeit
- Inzest als Topos der Aufklärung und der Romantik
- Inzest als Topos der Jahrhundertwende
- Inzest im 20. Jahrhundert: Blutschande und Rassendiskurs
- Inzest als Ganzheitserfahrung
- Inzest als Privileg der Auserwählten
- Psychoanalyse, Metaphysik und Inzest
- Verschiedene Deutungsansätze
- Johann Jakob Bachofen: Das Mutterrecht
- Sigmund Freud: Totem und Tabu
- Thomas Mann und die Psychoanalyse
- Grimald – „Männchen“ der Urhorde
- Vom Mutterrecht zur Paternität
- Die Welt in zwei - Dualismus im Werk Manns
- Robert Musil und die Psychoanalyse
- Ulrich und Agathe - Narzisst und Spiegelbild
- Zur Schuld des Vaters
- Zur Liebeskonzeption Musils: Eros, Sexus und Fernliebe
- Zur „Ernsthaftigkeit der Romane”
- Der Inzest bei Mann - Lebensphilosophie der Humanität
- Der Inzest bei Musil – Liebeskonzeption als utopische Weltanschauung
- Autobiographische Einflüsse und zeitgenössische Rezeption
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Inzestmotiv in Thomas Manns "Der Erwählte" und Robert Musils "Der Mann ohne Eigenschaften". Ziel ist es, die Verwendung dieses ambivalenten Motivs in beiden Romanen zu analysieren, seinen historischen Kontext zu beleuchten und verschiedene Deutungsmöglichkeiten im Lichte der Psychoanalyse und literaturwissenschaftlicher Ansätze zu diskutieren.
- Der historische und gesellschaftliche Kontext des Inzestverbots
- Der poetische Reiz des Inzestmotivs in der Literatur
- Die mythischen Vorbilder und ihre Bedeutung für die Darstellung des Inzests bei Mann und Musil
- Die Motivstruktur des Inzests in den beiden Romanen und deren unterschiedliche Ausprägungen
- Psychoanalytische und philosophische Interpretationen des Inzestmotivs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Inzests als literarisches Motiv ein und stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung und Intention der Inzestdarstellung in den Romanen von Thomas Mann und Robert Musil. Sie hebt die Ambivalenz des Motivs hervor – zwischen Dekadenz und Utopie, Grausamkeit und Liebesrausch – und kündigt die methodische Vorgehensweise der Arbeit an.
Geschichte des Inzests: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Inzestverbots, untersucht dessen rechtliche und traditionelle Grundlagen und analysiert verschiedene wissenschaftliche Theorien, insbesondere die von Claude Lévi-Strauss, um die gesellschaftliche Funktion des Tabus zu verstehen. Es wird auf Ausnahmen vom Inzestverbot eingegangen und der ambivalente Charakter des Inzests als sowohl verbotene Handlung als auch mythisch aufgeladenes Phänomen herausgestellt.
Das literarische Inzestmotiv: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den literarischen Aspekt des Inzestmotivs. Es erforscht den poetischen Reiz des Inzestverbots und untersucht die mythischen Vorbilder, die sowohl Thomas Mann als auch Robert Musil in ihren Werken verarbeitet haben. Der Fokus liegt auf antiken Mythen wie dem Mythos von Narcissus und der Bedeutung der Androgynität für die Darstellung der Geschwisterliebe.
Motivstruktur des Inzests: In diesem Kapitel wird die Struktur des Inzestmotivs in den beiden Romanen analysiert. Es werden die verschiedenen Konstellationen (Geschwisterinzest bei Musil, Zwillingsinzest und Mutter-Sohn-Beziehung bei Mann) verglichen und die Rolle der Raumsemantik in der Gestaltung des Inzestmotivs untersucht. Die Analyse fokussiert darauf, wie die Inzestbeziehungen die Handlungsstrukturen und die Gesamtkomposition der Romane prägen.
Die Inzestthematik im Wandel der Zeit: Dieser Abschnitt betrachtet die Entwicklung des Inzestmotivs in der Literatur verschiedener Epochen, von der Aufklärung und Romantik bis zum 20. Jahrhundert. Es wird die Verknüpfung des Inzestmotivs mit gesellschaftlichen Diskursen wie Blutschande und Rassismus beleuchtet, und die unterschiedlichen Konnotationen des Motivs im Laufe der Zeit werden herausgearbeitet.
Psychoanalyse, Metaphysik und Inzest: Hier werden psychoanalytische und metaphysische Deutungsansätze zur Interpretation des Inzestmotivs vorgestellt. Die Theorien von Bachofen und Freud werden diskutiert und auf ihre Anwendung auf die Werke Manns und Musils bezogen. Die Analyse konzentriert sich auf die psychologischen Aspekte der Inzestbeziehungen und deren Zusammenhang mit den jeweiligen Weltanschauungen der Autoren.
Zur „Ernsthaftigkeit der Romane”: Dieser Abschnitt analysiert den Stellenwert des Inzestmotivs für die Gesamtkomposition und die jeweiligen Anliegen der Romane. Es werden die Lebensphilosophie der Humanität bei Mann und die utopische Weltanschauung der Liebeskonzeption bei Musil im Kontext des Inzestmotivs beleuchtet. Die Bedeutung autobiografischer Einflüsse und die zeitgenössische Rezeption der Romane werden ebenfalls kurz angeschnitten.
Schlüsselwörter
Inzest, Thomas Mann, Robert Musil, Der Erwählte, Der Mann ohne Eigenschaften, Motiv, Tabu, Mythen, Psychoanalyse, Androgynität, Geschwisterliebe, Literaturwissenschaft, Romantik, Moderne, Jahrhundertwende, Gesellschaft, Moral.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Inzest in den Romanen von Thomas Mann und Robert Musil"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert das Inzestmotiv in Thomas Manns "Der Erwählte" und Robert Musils "Der Mann ohne Eigenschaften". Sie untersucht die Verwendung, den historischen Kontext und verschiedene Deutungsmöglichkeiten des Motivs im Lichte der Psychoanalyse und literaturwissenschaftlicher Ansätze.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den historischen und gesellschaftlichen Kontext des Inzestverbots, den poetischen Reiz des Inzestmotivs in der Literatur, mythische Vorbilder bei Mann und Musil, die Motivstruktur des Inzests in beiden Romanen, psychoanalytische und philosophische Interpretationen, sowie die Entwicklung des Inzestmotivs im Wandel der Zeit (Aufklärung, Romantik, Moderne).
Welche Autoren und Werke stehen im Mittelpunkt?
Die zentrale Betrachtung liegt auf den Romanen "Der Erwählte" von Thomas Mann und "Der Mann ohne Eigenschaften" von Robert Musil. Die Analyse fokussiert auf die Darstellung des Inzestmotivs in diesen Werken und deren jeweilige Interpretation.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit nutzt literaturwissenschaftliche und psychoanalytische Ansätze. Sie analysiert die Motivstruktur, die Raumsemantik, die mythischen Bezüge und bezieht Theorien von Autoren wie Claude Lévi-Strauss, Johann Jakob Bachofen und Sigmund Freud mit ein.
Welche Mythen und Theorien spielen eine Rolle?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Mythen (Narkissos, Isis und Osiris, Ödipus), sowie auf Theorien von Claude Lévi-Strauss (Inzesttheorien), Johann Jakob Bachofen (Mutterrecht) und Sigmund Freud (Totem und Tabu). Diese werden im Kontext der Interpretation des Inzestmotivs in den Romanen diskutiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, die die Geschichte des Inzests, das literarische Inzestmotiv, die Motivstruktur in den beiden Romanen, die Entwicklung des Motivs im Wandel der Zeit, psychoanalytische und metaphysische Deutungen, sowie eine Schlussbetrachtung zur "Ernsthaftigkeit der Romane" behandeln. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die Bedeutung des Inzestmotivs in den jeweiligen Romanen, seine Funktion innerhalb der Handlungsstruktur und seine Interpretation im Kontext der jeweiligen Weltanschauung der Autoren (Mann: Humanität; Musil: utopische Liebeskonzeption). Der Einfluss autobiografischer Elemente und die zeitgenössische Rezeption werden ebenfalls betrachtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Inzest, Thomas Mann, Robert Musil, Der Erwählte, Der Mann ohne Eigenschaften, Motiv, Tabu, Mythen, Psychoanalyse, Androgynität, Geschwisterliebe, Literaturwissenschaft, Romantik, Moderne, Jahrhundertwende, Gesellschaft, Moral.
- Quote paper
- Gina Saiko (Author), 2006, "Ach, wäre fern, was ich liebe!" Zum Motiv des Inzests in Thomas Manns "Der Erwählte" und Robert Musils "Der Mann ohne Eigenschaften", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/80453