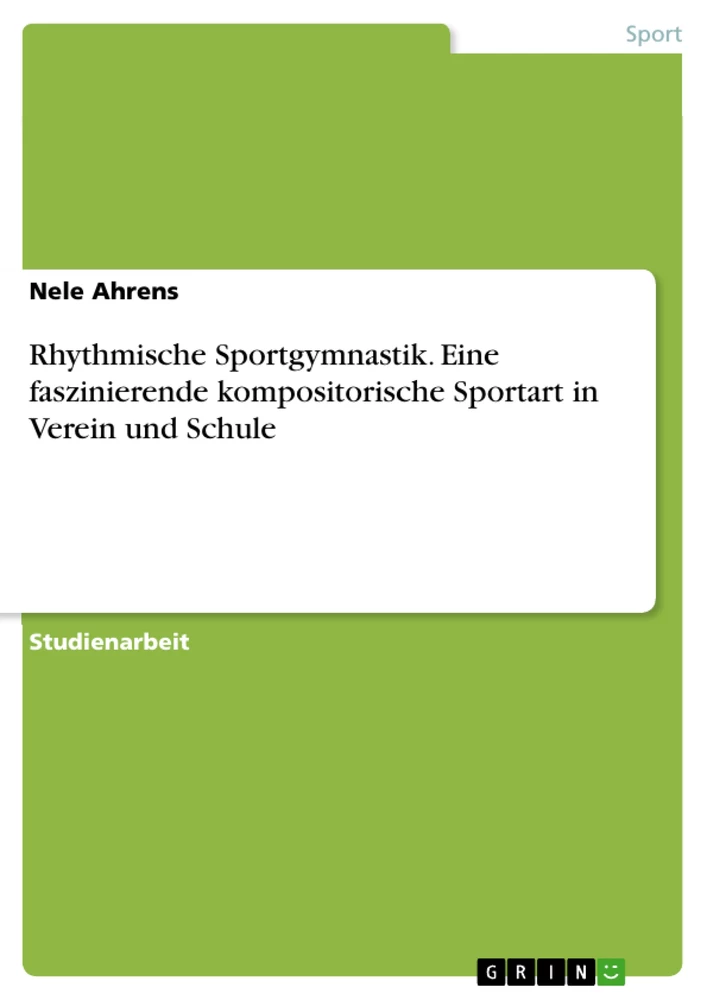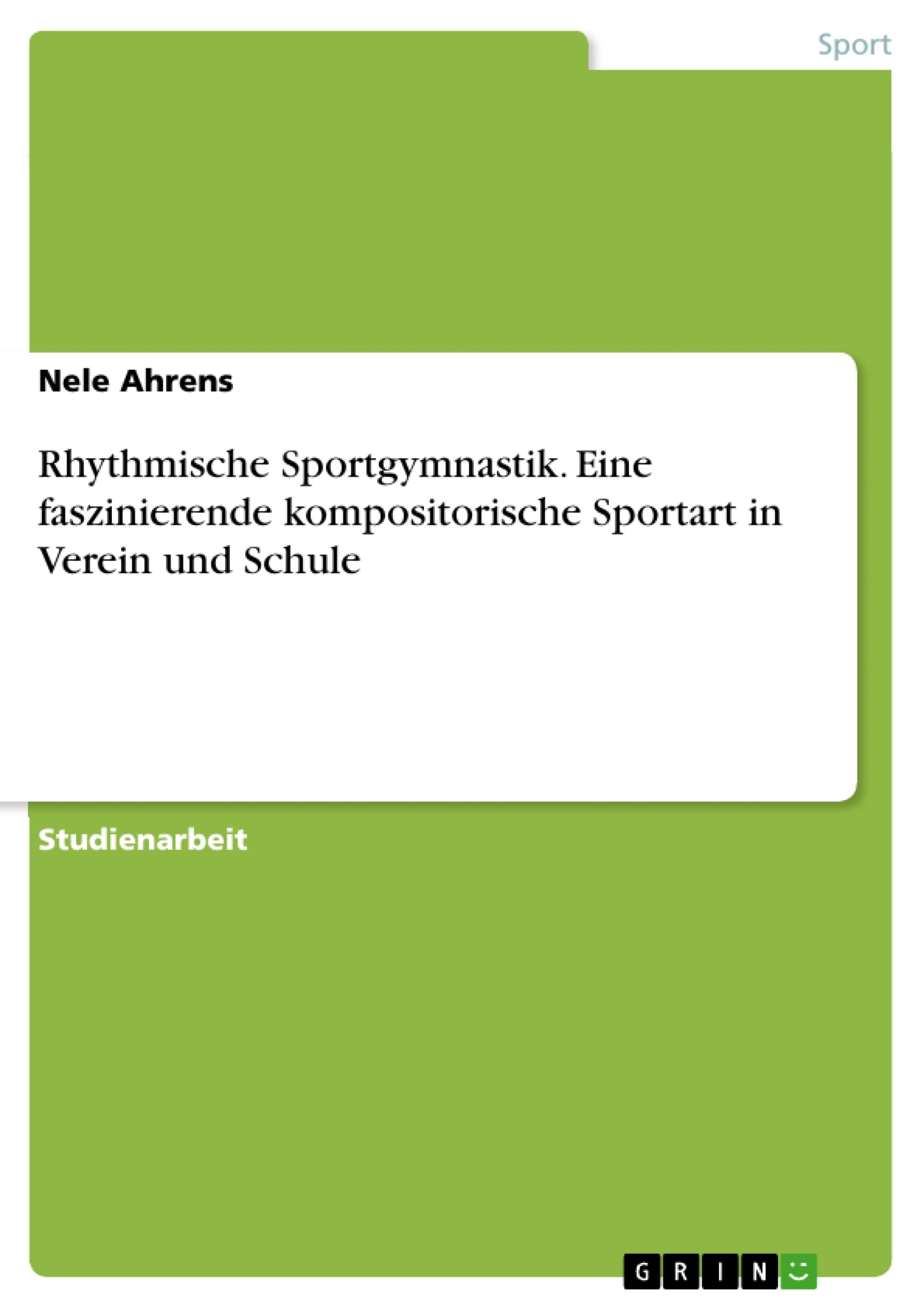Die rhythmische Sportgymnastik (RSG) hat sich vor gut 40 Jahren zu einer eigenständigen, auf internationaler Ebene etablierten Sportart entwickelt und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Denn durch die Verbindung von Musik, einer kreativen Bewegungsgestaltung und den sportlichen Höchstanforderungen wurde diese Sportart gerade für junge Mädchen immer reizvoller und anziehender. Wie aber sieht es in der Praxis dieser Sportart aus? Welche Methodik wirkt sich günstig auf das Erlernen der komplexen Bewegungsabläufe und Techniken aus und wie kann eine solche Hochleistungssportart Kindern vermittelt werden?
Die folgende Arbeit wird die Grundlagen, die zur rhythmischen Sportgymnastik im Spezialkurs Gymnastik und Tanz gegeben wurden, erweitern, sowie dem Leser einen detaillierten Einblick in die Facetten und Möglichkeiten dieser Sportart geben.
Zunächst soll eine Begriffsbestimmung und die Charakteristik, die diese Sportart kennzeichnen gegeben werden; daraufhin wird ein kurzer historischer Überblick den ersten Komplex abschließen.
Die wichtigsten Techniken, mit und ohne Handgerät, sowie die allgemeinen Voraussetzungen werden in dem darauf folgenden Teil betrachtet. Nach diesen grundlegenden Aspekten, wird es dann darum gehen, dem Leser die Praxis der rhythmischen Sportgymnastik vorzustellen, indem das Training der RSG, die Methodik und die Besonderheiten des Trainings mit Kindern vorgestellt werden. Ein abschließendes Fazit wird die gesamte Thematik abrunden.
Da die Arbeit bei der Beschreibung der einfachsten Grundlagen oder der RSG-Techniken - mit und ohne Handgerät - aufgrund ihrer Komplexität zu sehr an Umfang gewinnen würde, wird vom Leser ein gewisses Grundwissen bzw. das Wissen bestimmter Fachbegriffe vorausgesetzt (z.B. dass er die unterschiedlichen Grifftechniken beim Halten eines Reifens oder bestimmte Begriffe, wie z.B. Einzel- und Gruppenklassement kennt), um diese Problematik zu vermeiden. Die Techniken werden deshalb größtenteils nur genannt, nicht näher erklärt. Weiterhin ist anzumerken, dass bei den Übungen zur Entwicklung der konditionellen und koordinativen Fähigkeiten nur eine kleine Auswahl getroffen werden konnte, um den Leser eine grobe Vorstellung vermitteln zu können, es sind jedoch weitaus mehr Übungen möglich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist rhythmische Sportgymnastik?
- Definition: Rhythmische Sportgymnastik
- Charakteristik der rhythmischen Sportgymnastik
- Die Entwicklung und Entstehung der RSG - ein kurzer historischer Überblick
- Techniken der rhythmischen Sportgymnastik
- Tänzerische Schulung
- Techniken ohne Handgerät
- Techniken mit Handgerät
- Allgemeine Voraussetzungen
- Konditionelle Fähigkeiten
- Koordinative Fähigkeiten
- Persönliche Voraussetzungen
- Materielle Rahmenbedingungen
- Methodik und Training
- Training mit Kindern - Besonderheiten der Vermittlung
- Trainingsstunden allgemein
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet die rhythmische Sportgymnastik (RSG) als eigenständige Sportart und widmet sich der Frage, wie diese Sportart in der Praxis umgesetzt wird. Dabei wird die Methodik des Erlernens komplexer Bewegungsabläufe und Techniken sowie die Vermittlung an Kinder fokussiert. Die Arbeit will dem Leser einen detaillierten Einblick in die Facetten und Möglichkeiten der RSG geben.
- Definition und Charakteristik der rhythmischen Sportgymnastik
- Historische Entwicklung der RSG
- Techniken mit und ohne Handgerät
- Allgemeine Voraussetzungen für die Ausübung der RSG
- Trainingsprinzipien und Methodik der RSG, insbesondere die Besonderheiten im Training mit Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der rhythmischen Sportgymnastik ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Sie hebt die Verbindung von Musik, Bewegung und sportlichen Höchstleistungen hervor und erläutert die besondere Relevanz der RSG für junge Mädchen. Des Weiteren werden die wichtigsten Punkte der Arbeit vorgestellt, die im Folgenden näher beleuchtet werden.
Das zweite Kapitel widmet sich der Definition und Charakteristik der rhythmischen Sportgymnastik. Hier werden die wichtigsten Merkmale der Sportart beschrieben, wie die Kombination aus Körper- und Gerätetechniken, die Verwendung von Handgeräten und die Einbeziehung von Elementen aus Tanz und Gymnastik. Es wird auch der Einfluss des klassischen und modernen Tanzes auf die RSG näher beleuchtet.
Der dritte Teil behandelt die Techniken der rhythmischen Sportgymnastik, sowohl mit als auch ohne Handgerät. Hier werden die wichtigsten Techniken und Bewegungsabläufe genannt und in Verbindung mit den entsprechenden Handgeräten gesetzt. Zusätzlich werden tänzerische Elemente und ihre Relevanz für die RSG beschrieben.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den allgemeinen Voraussetzungen für die Ausübung der rhythmischen Sportgymnastik. Hier werden konditionelle und koordinative Fähigkeiten sowie persönliche Voraussetzungen, wie z.B. Motivation und Disziplin, aufgezeigt. Darüber hinaus werden die notwendigen materiellen Rahmenbedingungen, wie z.B. Trainingsstätten und Geräte, näher erläutert.
Im fünften Kapitel stehen die Methodik und das Training der RSG im Fokus. Die Besonderheiten des Trainings mit Kindern werden hervorgehoben und wichtige Aspekte wie die Vermittlung der Techniken, die Gestaltung von Trainingsstunden und die Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der jungen Sportlerinnen werden erläutert.
Schlüsselwörter
Rhythmische Sportgymnastik, RSG, Handgeräte, Musik, Bewegung, Koordination, Kondition, Tanz, Gymnastik, Training, Methodik, Kinder, Leistungsoptimierung.
- Quote paper
- Nele Ahrens (Author), 2007, Rhythmische Sportgymnastik. Eine faszinierende kompositorische Sportart in Verein und Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/80370