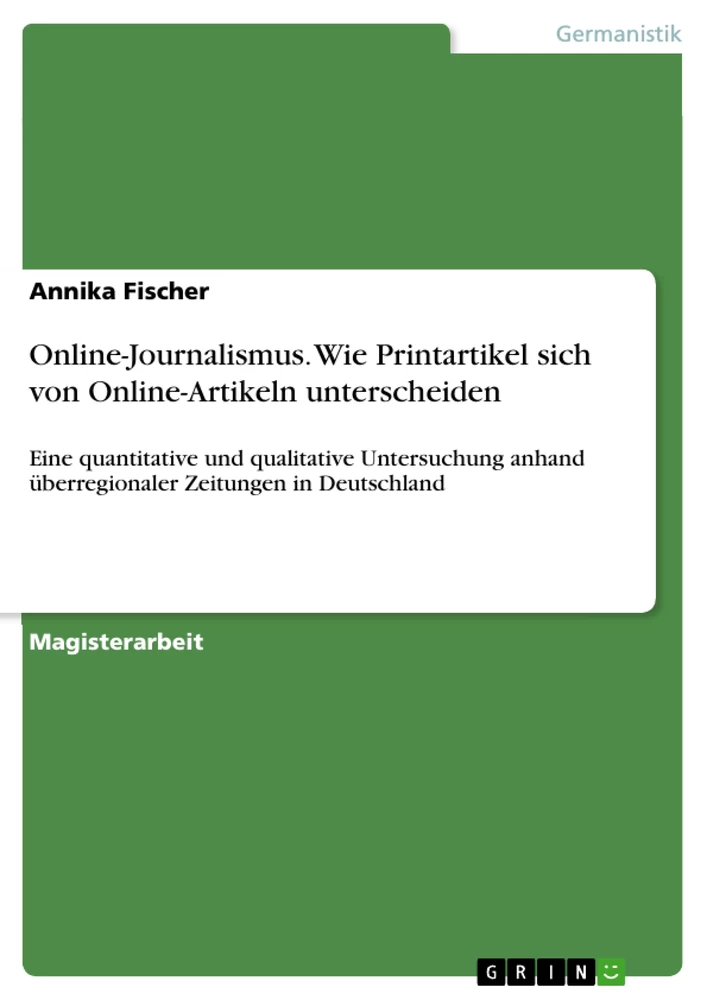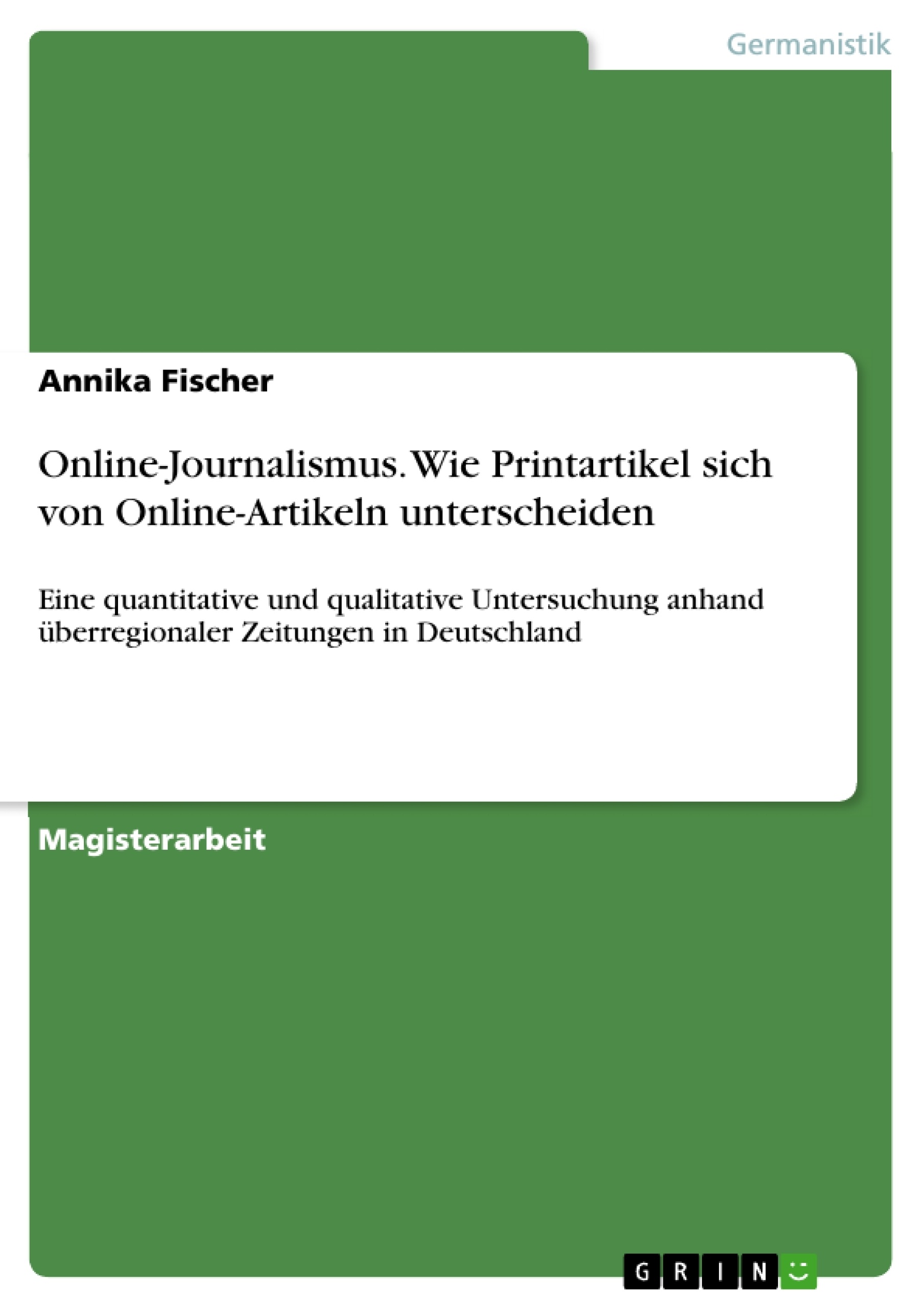Die Anzahl der Nutzer des Internets hat in den letzten Jahren rasant zugenommen: Noch im Jahre 1998 gaben acht Prozent der Westdeutschen und sechs Prozent der Ostdeutschen an, mindestens einmal pro Woche das Internet in der Freizeit zu nutzen. Sechs Jahre später sind in Westdeutschland über 38 Prozent und in Ostdeutschland über 33 Prozent der Menschen Internetnutzer. Seit über zehn Jahren haben sämtliche überregionale Zeitungen einen Internetauftritt.
In dieser Arbeit wird untersucht, wie deutsche überregionale Printmedien sowohl ihren Printwie auch ihren Internetauftritt sprachlich gestalten. Für die Untersuchung werden drei überregionale Zeitungen betrachtet: Die Süddeutsche Zeitung (SZ), die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) und die Netzeitung (NZ), die nur im Internet verfügbar ist. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich über die Woche vom 17.07.2006 bis 21.07.2006. Um den Untersuchungsgegenstand einzugrenzen, wird sich die Autorin nur mit den Artikeln des Ressorts Politik der Zeitungen beschäftigen. Sprachlich werden dabei die Artikelformen und Textsorten, die die jeweiligen Medien verwenden, verglichen.
Untersucht wird, inwiefern das Medium Internet Einfluss auf die Textgestaltung hat. Es wird ein Unterschied zwischen der Lesbarkeit von Texten auf Papier (Printzeitung) und Texten auf dem Monitor (Onlinezeitung) vermutet. Mit Hilfe der Korpuslinguistik sollen außerdem die Text- und Satzlänge sowie die Wortanzahl der Artikel im Korpus in die Analyse einbezogen werden. Zur Veranschaulichung wird die Verständlichkeit von Artikeln in den Print- und Online-Zeitungen verglichen. Da in der gesichteten Literatur keine ähnlichen Untersuchungen statt gefunden haben beziehungsweise die Zeitungssprache im Internet nicht explizit betrachtet wurde, wird in dieser Arbeit der Vergleich von Zeitungsartikeln im Printmedium und online mit verschiedenen Ansätzen betrachtet. Dabei liegt die Fragestellung bezüglich der Artikelgestaltung zugrunde, inwiefern sich Print- und Onlinemedien in Bezug auf ihre Satzumfänge pro Artikel, durchschnittliche Satzlängen und Wortlängen unterscheiden.
Ein Augenmerk wird auch auf die Verständlichkeit der Korpustexte gelegt. Explizit eingegangen wird auch auf den Aspekt der Verständlichkeit der
Artikel.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Ansatz
- Untersuchungsgegenstand
- Überblick zur Literaturlage
- Die Zeitung und ihre Sprache
- Das Internet als neues Medium
- Zeitung im Internet
- Studien zu Rezeptionsunterschieden beim Lesen auf Papier und auf dem Bildschirm
- Studien zum Vergleich von Printmedien mit ihrem Onlinependant
- Richtlinien für das Schreiben von Online-Texten
- Der Teaser
- Korpuslinguistik
- Die zur Untersuchung ausgewählten Medien
- Die Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Die Süddeutsche Zeitung
- Die Netzeitung
- Vorgehensweise beim Zusammenstellen des Korpus
- Die journalistischen Textsorten in den untersuchten Zeitungen
- Die Nachricht
- Die Meldung
- Der Bericht / Die Reportage
- Das Interview
- Der Kommentar
- Die Glosse
- Quantitative Analyse des Korpus
- Vorgehensweise bei der empirischen Analyse des Korpus
- Überprüfung der theoretischen Annahmen durch empirische Untersuchungen am Korpus
- Umfang des Datenmaterials
- Häufigkeit und Verteilung der Teaser
- Chi-Quadrat-Test für die Verteilung der Teaser
- Verteilung der Artikel in den Zeitungen auf die einzelnen Wochentage
- Verteilung der Teaser in den Zeitungen auf die einzelnen Wochentage
- Durchschnittliche Länge der Artikel
- Arithmetisches Mittel für die Wortanzahl der Artikel
- Median der Artikel-Wortanzahl
- Standardabweichung und Spannweiten bei der Artikel-Wortanzahl
- Arithmetisches Mittel für die Satzanzahl der Artikel
- Durchschnittliche Länge der Sätze
- Zuordnung der journalistischen Textformen zu den untersuchten Zeitungen
- Häufigkeiten und Verteilung der Textsorten
- Chi-Quadrat-Test in Bezug auf die Verteilung der Textsorten
- Analyse der Überschriften
- Die Wortartenstile der Überschriften
- Kategorieneinteilung für die Wortartenstile
- Analyse der Überschriftenstile der Zeitungen
- Durchschnittliche Überschriftenlänge
- Die Verständlichkeit der untersuchten Artikel
- Verständlichkeitsformeln
- Berechnung der Formel am Korpus
- Ergebnisse der Berechnung nach der Verständnisformel von AMSTAD am Korpus
- Qualitative Analyse des Korpus
- Ausgewählte Beispiele der SZ
- „Israel muss sich zurückziehen“
- „Brüchige Meinungsfront“
- „Anschlag auf Marktplatz“
- Ausgewählte Beispiele der F.A.Z.
- „Eine Friedenstruppe für den Südlibanon?“
- „Nachschub aus Syrien“
- „Ahmadineschad schreibt der Bundeskanzlerin“
- Der unzufriedene Bundespräsident
- Ein Artikel der NZ im Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der sprachlichen Gestaltung von Print- und Online-Artikeln in überregionalen deutschen Zeitungen. Die Arbeit untersucht, inwiefern sich die Sprache von Zeitungsartikeln im Printmedium von Online-Artikeln unterscheidet.
- Die Unterschiede zwischen Print- und Online-Artikeln in Bezug auf Textsorte, Artikel-Struktur, Satzlänge und Wortlänge.
- Die Rolle des Internets als Zeitungsmedium und wie es die Textgestaltung beeinflusst.
- Die Verständlichkeit von Texten auf Papier im Vergleich zu Texten auf dem Bildschirm.
- Die Besonderheiten der neuen Textform „Teaser“ im Online-Journalismus.
- Die Anwendung der Korpuslinguistik für die Analyse von Zeitungstexten.
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird der theoretische Hintergrund der Arbeit dargestellt, der die Zeitungssprache, das Internet als Zeitungsmedium und die Unterschiede zwischen Print- und Online-Artikeln beleuchtet.
Kapitel 2 behandelt die Methode der Korpuslinguistik, die in dieser Arbeit zur Analyse des Korpus verwendet wurde. Es werden die drei Ansätze der Korpusanalyse beschrieben und der für diese Arbeit relevante Ansatz, der korpusbasierte, quantitativ-qualitative Ansatz, näher erläutert.
Kapitel 3 bietet eine umfassende Beschreibung der drei überregionalen Zeitungen, die für die Untersuchung ausgewählt wurden: Die Süddeutsche Zeitung (SZ), die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) und die Netzeitung (NZ).
Kapitel 4 präsentiert die quantitative Analyse des Korpus. Es werden Daten zur Häufigkeit und Verteilung von Teasern, Artikellängen und Satzlängen präsentiert, die mithilfe von statistischen Methoden wie dem Chi-Quadrat-Test analysiert werden.
Kapitel 5 befasst sich mit der Zuordnung der journalistischen Textsorten zu den untersuchten Zeitungen. Es wird gezeigt, welche Textsorten in den einzelnen Zeitungen dominieren und ob es einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Textsorten und dem Zeitungstyp gibt.
Kapitel 6 analysiert die Überschriften der Artikel. Es wird untersucht, ob sich die Überschriften von Print- und Online-Artikeln in Bezug auf den Nominalstil, den Verbalstil oder den Adjektivstil unterscheiden.
Kapitel 7 geht auf die Verständlichkeit der untersuchten Artikel ein. Die Arbeit nutzt die Verständlichkeitsformel von AMSTAD, um den Schwierigkeitsgrad der Artikel zu berechnen und die Ergebnisse für Print- und Online-Artikel zu vergleichen.
Kapitel 8 widmet sich der qualitativen Analyse des Korpus. Es werden ausgewählte Artikel aus der SZ, der F.A.Z. und der NZ miteinander verglichen, um die Unterschiede zwischen Print- und Online-Artikeln in Bezug auf Inhalt, Struktur und Sprache zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Online-Journalismus, Printjournalismus, Zeitungssprache, Textsorten, Korpuslinguistik, Quantitative Analyse, Qualitative Analyse, Verständlichkeit, Teaser, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Netzeitung,
- Quote paper
- Annika Fischer (Author), 2007, Online-Journalismus. Wie Printartikel sich von Online-Artikeln unterscheiden, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/79687