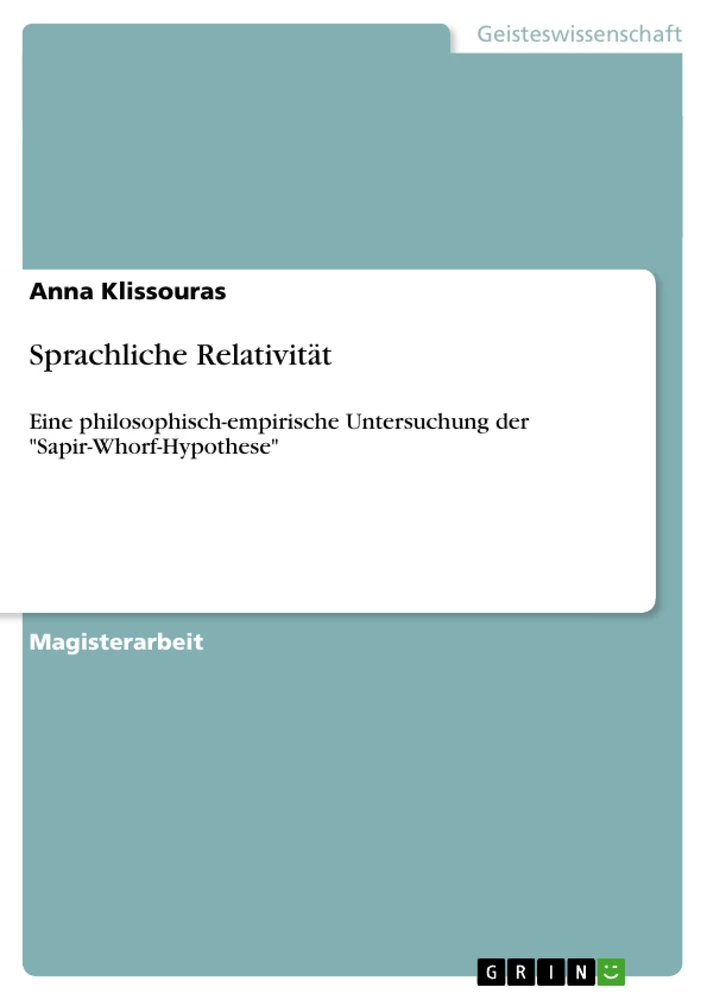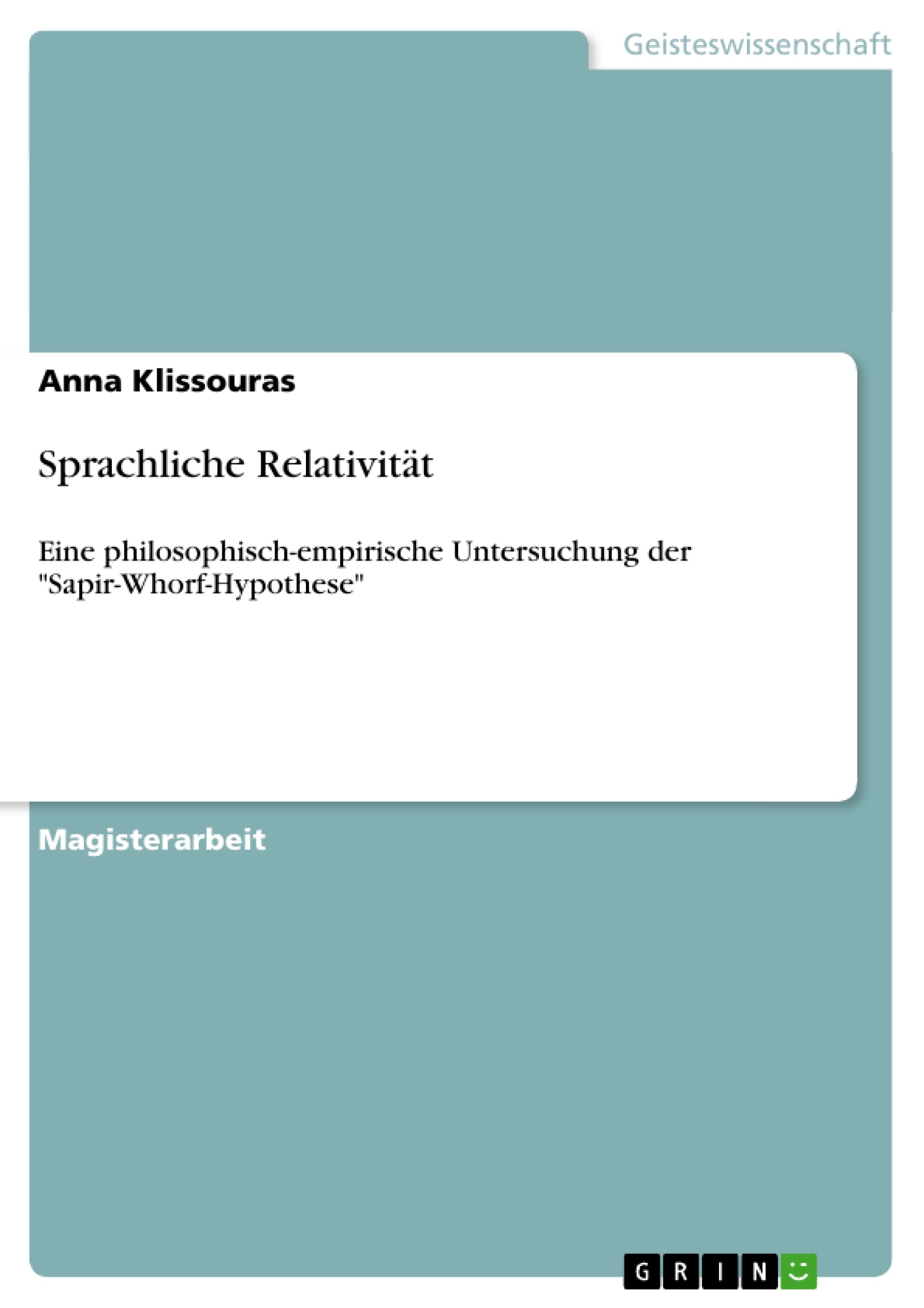In den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts beschrieb der Amerikaner Benjamin Lee Whorf (1897 - 1941) in wenigen Aufsätzen ein sprachliches Relativitätsprinzip, welches einen prägenden Einfluss des sprachlichen Hintergrundes eines Menschen auf seine Denkstrukturen postulierte. Der Chemiker war nach Abschluss seines Studiums zunächst als Versicherungsangestellter tätig gewesen, um sich dann der Ethnolinguistik indianischer Sprachen zuzuwenden, welche er ab 1931 bei Edward Sapir studierte und einige Jahre später selbst lehrte. Sapir hatte im Laufe seiner Untersuchungen bereits eine gewisse Interdependenz zwischen Sprache und Kognition vermutet; erst Whorf aber formulierte diesen vagen Zusammenhang als Prinzip, das wegen seiner starken Beeinflussung durch Sapir später als die „Sapir-Whorf-Hypothese“ bezeichnet wurde.
Diese Hypothese gilt als umstritten. Tatsächlich sind die von Whorf formulierten Thesen nicht nur wegen ihrer Inhalte problematisch, sondern auch wegen des unsicheren Fundamentes, auf dem sie sich bewegen. Angesichts der Tragweite seiner Theorie, die ein allgemein gültiges Prinzip sein will, liefern die etwa 140 von ihm zu diesem Thema formulierten Seiten nur wenig Material: Whorfs Schlussfolgerungen gründen vor allem auf seine Beobachtungen an Hopi-Indianern und deren Sprache, was den Vorwurf der Subjektivität aufbrachte. Auf eine Bezugnahme auf linguistische oder philosophische Positionen sowie weitere empirische Untersuchungen verzichtet Whorf zudem weitestgehend.
Die vorliegende Arbeit wird sich dieser Problemlage auf drei Weisen nähern. Der erste Teil stellt die „Sapir-Whorf-Hypothese“ mit ihren deskriptiven Argumenten sowie Gegenargumenten vor und reduziert sie auf ihre Hauptthesen, welche im weiteren Verlauf der Arbeit als Ausgangspunkt der Fragestellung dienen werden. Ein philosophischer Diskurs zwischen Universalisten und Relativisten soll die Theorie der sprachlichen Relativität im zweiten Teil in die philosophische Tradition einspannen und zunächst auf rein rationalem Wege zu ersten Ergebnissen bezüglich ihrer Plausibilität führen. Im dritten Teil sollen dann jene Fragen des Spracherwerbs und der kognitiven Beeinflussung durch Sprache geklärt werden, auf welche nur die Empirie sinnvolle Antworten geben kann. Schließlich soll sich ein transparenteres Gesamtbild der sprachlichen Relativitätstheorie ergeben, dessen Gehalt und Grenzen sich aufgrund der erarbeiteten Argumente und Fakten ersehen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. DIE SAPIR-WHORF-HYPOTHESE
- 1.1 Der Einfluss von Wort-Kategorien
- 1.2 Der Einfluss der Grammatik
- 1.3 Ausblick
- 2. DER PHILOSOPHISCHE DISKURS: UNIVERSALISMUS VS. RELATIVISMUS
- 2.1 Kant: Das Sprachapriori
- 2.2 Herder: Kant-Kritik
- 2.3 Früher sprachlicher Relativismus: Wilhelm von Humboldt
- 2.4 Noam Chomsky: cartesianische Linguistik
- 2.5 Resultate
- 3. EMPIRISCHE ANSÄTZE
- 3.1 Lässt sich der Spracherwerb auf empirischem Weg erklären?
- 3.2 Bestätigt die Empirie einen sprachlichen Einfluss auf die Kognition?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die umstrittene Sapir-Whorf-Hypothese, die einen prägenden Einfluss der Sprache auf das Denken postuliert. Die Zielsetzung besteht darin, die Hypothese anhand philosophischer und empirischer Argumente zu beleuchten und ihre Plausibilität zu bewerten. Dabei werden sowohl die deskriptiven Argumente der Hypothese als auch Gegenargumente berücksichtigt.
- Der Einfluss von Wort-Kategorien und Grammatik auf die Denkstrukturen
- Der philosophische Diskurs zwischen Universalismus und Relativismus im Kontext der sprachlichen Relativität
- Empirische Ansätze zur Erklärung des Spracherwerbs und des kognitiven Einflusses der Sprache
- Bewertung der Plausibilität der Sapir-Whorf-Hypothese anhand der gesammelten Argumente
- Untersuchung der Grenzen der sprachlichen Relativitätstheorie
Zusammenfassung der Kapitel
1. DIE SAPIR-WHORF-HYPOTHESE: Dieses Kapitel präsentiert die Sapir-Whorf-Hypothese und ihre zentralen Thesen. Es wird erläutert, wie Whorf, basierend auf seinen Beobachtungen der Hopi-Sprache, argumentierte, dass die sprachlichen Strukturen einer Kultur die Weltsicht ihrer Sprecher prägen. Der Fokus liegt auf der These, dass die Kategorisierung von Objekten und die Grammatik einer Sprache das Denken beeinflussen und zu unterschiedlichen Weltbildern bei Sprechern verschiedener Sprachen führen. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere philosophische und empirische Auseinandersetzung mit der Hypothese.
2. DER PHILOSOPHISCHE DISKURS: UNIVERSALISMUS VS. RELATIVISMUS: Dieses Kapitel analysiert die Sapir-Whorf-Hypothese im Kontext des philosophischen Diskurses zwischen Universalismus und Relativismus. Es untersucht die Positionen von Kant, Herder, Humboldt und Chomsky, um die Theorie der sprachlichen Relativität in die philosophische Tradition einzubetten. Die Diskussion beleuchtet, wie die verschiedenen philosophischen Perspektiven die Frage nach der Universalität oder Relativität von Denken und Sprache beeinflussen und wie diese Perspektiven sich auf die Bewertung der Sapir-Whorf-Hypothese auswirken. Es wird ein rationaler Weg beschritten, um die Plausibilität der Hypothese zu überprüfen.
3. EMPIRISCHE ANSÄTZE: Dieses Kapitel wendet sich empirischen Ansätzen zu, um die Frage des Spracherwerbs und des kognitiven Einflusses der Sprache zu untersuchen. Es erörtert, ob der Spracherwerb empirisch erklärt werden kann und ob empirische Befunde einen sprachlichen Einfluss auf die Kognition bestätigen. Der Fokus liegt auf der Überprüfung der Sapir-Whorf-Hypothese anhand von empirischen Daten, um eine fundiertere Bewertung der Hypothese zu ermöglichen und die Grenzen der Theorie zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Sapir-Whorf-Hypothese, sprachliche Relativität, Universalismus, Relativismus, Spracherwerb, Kognition, Hopi-Sprache, Weltbild, Denkstrukturen, Grammatik, Wort-Kategorien, Empirie, Philosophie.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit über die Sapir-Whorf-Hypothese
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Sapir-Whorf-Hypothese, welche postuliert, dass die Sprache einen prägenden Einfluss auf das Denken hat. Sie beleuchtet die Hypothese anhand philosophischer und empirischer Argumente und bewertet deren Plausibilität.
Welche Aspekte der Sapir-Whorf-Hypothese werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss von Wort-Kategorien und Grammatik auf Denkstrukturen, den philosophischen Diskurs zwischen Universalismus und Relativismus im Kontext sprachlicher Relativität, empirische Ansätze zur Erklärung des Spracherwerbs und des kognitiven Einflusses der Sprache, sowie eine Bewertung der Plausibilität der Sapir-Whorf-Hypothese und ihrer Grenzen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel 1 präsentiert die Sapir-Whorf-Hypothese und ihre zentralen Thesen. Kapitel 2 analysiert die Hypothese im Kontext des philosophischen Diskurses zwischen Universalismus und Relativismus, unter Berücksichtigung von Positionen von Kant, Herder, Humboldt und Chomsky. Kapitel 3 wendet sich empirischen Ansätzen zur Überprüfung der Hypothese zu.
Welche Philosophen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit diskutiert die Positionen von Immanuel Kant, Johann Gottfried Herder, Wilhelm von Humboldt und Noam Chomsky im Kontext der sprachlichen Relativität und ihrer Relevanz für die Sapir-Whorf-Hypothese.
Welche empirischen Ansätze werden betrachtet?
Kapitel 3 untersucht empirische Ansätze zur Erklärung des Spracherwerbs und zur Bestätigung eines kognitiven Einflusses der Sprache. Es wird geprüft, ob empirische Befunde die Sapir-Whorf-Hypothese unterstützen und welche Grenzen die Theorie aufweist.
Welche Rolle spielt die Hopi-Sprache in der Arbeit?
Die Hopi-Sprache dient als Beispiel in Kapitel 1, um Whorfs Argumentation zu veranschaulichen, dass sprachliche Strukturen die Weltsicht der Sprecher prägen. Whorf’s Beobachtungen der Hopi-Sprache bildeten einen wichtigen Ausgangspunkt für seine Theorie.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit bewertet die Plausibilität der Sapir-Whorf-Hypothese anhand der gesammelten philosophischen und empirischen Argumente und untersucht die Grenzen der Theorie der sprachlichen Relativität. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Text detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Sapir-Whorf-Hypothese, sprachliche Relativität, Universalismus, Relativismus, Spracherwerb, Kognition, Hopi-Sprache, Weltbild, Denkstrukturen, Grammatik, Wort-Kategorien, Empirie, Philosophie.
- Quote paper
- Anna Klissouras (Author), 2005, Sprachliche Relativität, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/79630