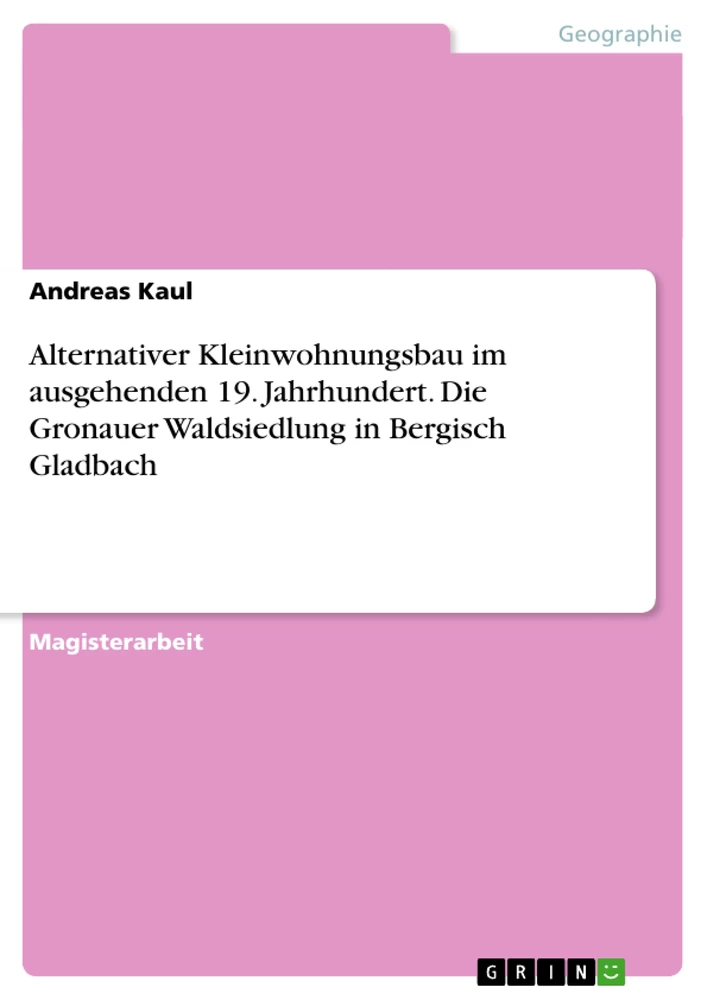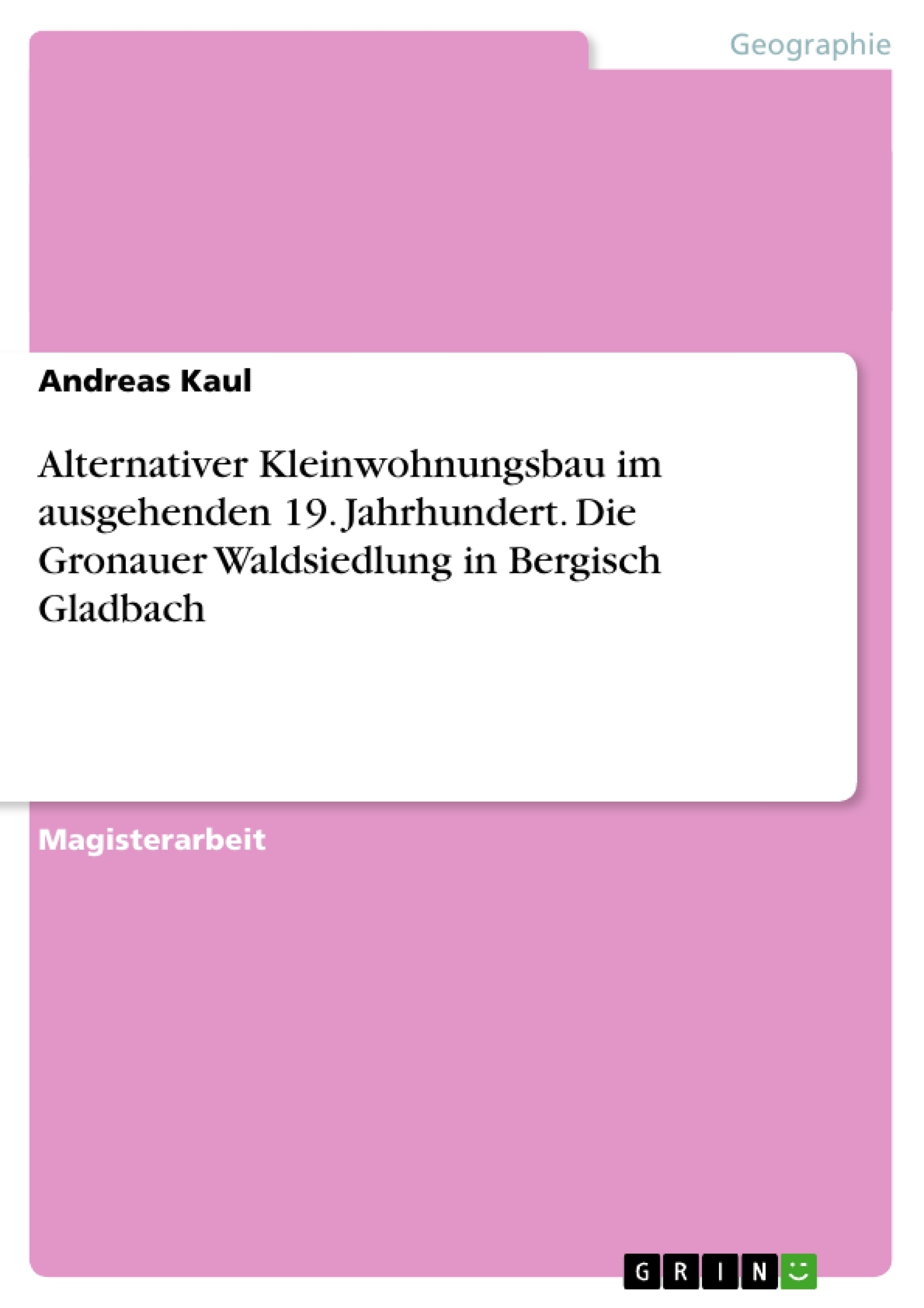Ende Dezember 2005 zählte die Stadt Bergisch Gladbach eine Einwohnerzahl von 110.114 Bürgern. Bezogen auf die Höhe der Bewohner ist Bergisch Gladbach somit nach der Klassifizierung der amtlichen deutschen Statistik für Städtetypen eine Großstadt. Im Vergleich zu anderen Städten dieser Größenordnung verlief die Stadtentwicklung in Bergisch Gladbach jedoch untypisch. Im Jahre 1856, dem Jahr der Verleihung der Stadtrechte, lebten im Siedlungsgebiet der Kommune 5000 Menschen. Das Stadtgebiet setzte sich aus einer Vielzahl von Streusiedlungen und Kirchdörfern zusammen. An jener Stelle, an welcher sich heute das Stadtzentrum befindet, war im Jahre 1856 kein nennenswertes Dorf zu finden. Einen enormen Aufschwung erlebte die Stadt im Zuge der Industrialisierung der Papierproduktion. Seitdem die Firma Zanders ab den 1850er Jahren das Papier maschinell fertigte, und mit der Gründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 ein großer Absatzmarkt für Papier entstand, entwickelte sich die Stadt Bergisch Gladbach zur Industriestadt. Die Entwicklung der Stadt erfolgte in der Nähe der Fabrikgelände „Gohrsmühle“ und „Schnabelsmühle“, sowie in Sichtweite des Wohnsitzes der Fabrikantenfamilie, der „Villa Zanders“. Nicht selten griffen die Papierfabrikanten direkt in die Entwicklung der Stadt Bergisch Gladbach ein: Als bedingt durch die Industrialisierung immer mehr Arbeiter aus den umgebenden Regionen in die aufstrebende Industriestadt strömten, drohte das ländliche Erscheinungsbild der Stadt unterzugehen. Das klassische Einfamilienhaus drohte dem Massenmietshaus zu weichen. Im Jahre 1897 begann der Papierfabrikant Richard Zanders, fünf Jahre vor der Gründung der Deutschen Gartenstadtgesellschaft , mit der Planung eines beispielhaften Wohnbauprojektes: Unter Ausschluss der Bodenspekulation sollte bewiesen werden, dass weiterhin der Bau von Einfamilienarbeiterwohnhäusern in ländlicher Umgebung möglich ist. So entstand die Gartensiedlung „Gronauer Wald“ in Bergisch Gladbach, welche in einem Waldgelände zwischen den Ortsteilen Gronau und Heidkamp, fußläufig von der Papierfabrik zu erreichen, entstanden ist. Das Projekt der „Gronauer Waldsiedlung“ ist ein herausragendes Beispiel des sozial motivierten Wohnungsbaus im ausgehenden 19. Jahrhundert und wird in der Literatur vielfach als „mustergültig“ bezeichnet. Das Projekt der „Gronauer Waldsiedlung“ soll in der vorliegenden Arbeit näher betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Zielsetzung der Untersuchung
- 1.2. Methodik der Arbeit
- 1.3. Aufbau der Arbeit
- 2. Die Wohnsituation der Arbeiter im ausgehenden 19. Jahrhundert
- 2.1. Die Situation der Arbeiter und die soziale Frage
- 2.2. Die Stadtentwicklung im 19. Jahrhundert
- 2.3. Modelle des Arbeiterwohnbaus
- 2.3.1. Die Entstehung des „wilhelminischen Wohngürtels“ in Berlin
- 2.3.2. Der Bau von Werkswohnsiedlungen im Ruhrgebiet
- 2.4. Alternativen zum klassischen Arbeiterwohnbau
- 2.4.1. Das Modell der Gartenstadt
- 2.4.2. Die Gartenstadtbewegung in Deutschland
- 3. Die Entwicklung der Stadt Bergisch Gladbach
- 3.1. Die Entwicklung Bergisch Gladbachs vor 1856
- 3.2. Die Verleihung der Stadtrechte im Jahre 1856
- 3.2.1. Die strukturelle Entwicklung Bergisch Gladbachs
- 3.2.2. Die Herausbildung des Stadtzentrums in Bergisch Gladbach
- 3.2.3. Neue siedlungsgeographische Problemstellungen
- 3.3. Die Papierfabrikantenfamilie Zanders
- 3.4. Das kommunale Engagement Bergisch Gladbacher Fabrikanten
- 3.5. Die Bauzonenordung in Bergisch Gladbach
- 3.5.1. Die dreistufige Bauzonenordnung nach Richard Zanders
- 3.5.2. Die modifizierte Bauzonenordnung des Regierungspräsidiums
- 3.6. Die Förderung des Kleinwohnungsbaus in Bergisch Gladbach
- 3.6.1. Darlehen der Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz
- 3.6.2. Die Wohnbauförderung der Firma J.W. Zanders
- 4. Die Entstehung der „Gartensiedlung Gronauer Wald“
- 4.1. Die Idee der „Gartensiedlung Gronauer Wald“
- 4.2. Konzeption der Einfamilienhaussiedlung Gronauer Wald
- 4.3. Die Planungsphase der Siedlung
- 4.4. Die Verkaufsbedingungen für die Grundstücke im Gronauer Wald
- 4.5. Die Planung der Wohnhäuser
- 4.5.1. Die Architekten der Wohnhäuser im „Gronauer Wald“
- 4.5.1.1. Architekt Ludwig Bopp
- 4.5.1.2. Architekt Oskar Lindemann
- 4.5.1.3. Architekt Peter Will
- 4.5.1. Die Architekten der Wohnhäuser im „Gronauer Wald“
- 4.6. Die erste Bauphase im Gronauer Wald 1898 – 1906
- 4.7. Das Jahr 1906: Die Zäsur in der Entwicklung der Wohnsiedlung
- 4.8. Die Gründung der „Gemeinnützigen Gartensiedlungsgesellschaft“
- 4.8.1. Die Struktur der Gemeinnützigen Gartensiedlungsgesellschaft
- 4.8.2. Die „Gemeinnützige Ansiedlergenossenschaft Gronauer Wald“
- 4.9. Die Bautätigkeit im „Gronauer Wald“ nach der Neuorganisation
- 4.10. Die „dritte Bauphase“ nach dem Zweiten Weltkrieg
- 4.11. Allgemeine Resonanz auf die „Gartensiedlung Gronauer Wald“
- 5. Die Grund- und Aufrissgestaltung in der Gronauer Waldsiedlung
- 5.1. Die Bauphasen in der Gronauer Waldsiedlung
- 5.2. Die Struktur der Straßen und Wege
- 5.3. Der Zustand der Gebäude in der Gronauer Waldsiedlung
- 6. Schutz und Erhaltung in der Gronauer Waldsiedlung
- 6.1. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Denkmalschutzes
- 6.1.1. Definition Denkmal
- 6.1.2. Definition Denkmalbereich
- 6.1.3. Der Schutz von Orten und Siedlungen
- 6.2. Schutz und Erhaltung der Wohngebäude im Gronauer Wald
- 6.1. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Denkmalschutzes
- 7. Satzung zur Erhaltung des historischen Erscheinungsbildes
- 8. Vorschlag für einen Rundgang durch die Gronauer Waldsiedlung
- 9. Die Gartensiedlung „Gronauer Wald“: Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung der Gronauer Waldsiedlung in Bergisch Gladbach, ein bedeutendes Beispiel für alternativen Kleinwohnungsbau im ausgehenden 19. Jahrhundert. Es wird analysiert, wie die Siedlung entstand, welche Planungen ihr zugrunde lagen und wie ihr heutiger Zustand ist. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung eines Schutzkonzeptes für den Erhalt des historischen Erscheinungsbildes.
- Die Motivation zur Gründung der Gronauer Waldsiedlung
- Die Planungs- und Gestaltungsprinzipien der Siedlung
- Der heutige Zustand der Gebäude und das Erscheinungsbild der Siedlung
- Möglichkeiten zum nachhaltigen Schutz des historischen Gesamtgefüges
- Der Kontext des alternativen Arbeiterwohnbaus im ausgehenden 19. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht die Gronauer Waldsiedlung in Bergisch Gladbach als Modellprojekt des reformorientierten Kleinwohnungsbaus. Sie beleuchtet die Motivationen hinter der Gründung, die aktuelle Situation der Siedlung und erarbeitet ein Schutzkonzept für den Erhalt ihres historischen Erscheinungsbildes. Die Arbeit beantwortet Fragen zur Gründung, Planung, heutigem Zustand und nachhaltigem Schutz der Siedlung.
2. Die Wohnsituation der Arbeiter im ausgehenden 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt die schwierigen Lebens- und Wohnbedingungen der Arbeiter im ausgehenden 19. Jahrhundert, die durch die Industrialisierung und Urbanisierung verschärft wurden. Es werden verschiedene Modelle des Arbeiterwohnbaus vorgestellt, wie der „wilhelminische Wohngürtel“ in Berlin und Werkswohnsiedlungen im Ruhrgebiet, um den Kontext der Gronauer Waldsiedlung zu verdeutlichen. Es werden die Alternativen, wie das Gartenstadtmodell, diskutiert.
3. Die Entwicklung der Stadt Bergisch Gladbach: Dieses Kapitel skizziert die historische und geographische Entwicklung Bergisch Gladbachs. Es wird die vorindustrielle Situation, die Auswirkungen der Industrialisierung, insbesondere der Papierproduktion durch die Familie Zanders, sowie die Verleihung der Stadtrechte 1856 und die daraus resultierenden Herausforderungen behandelt. Die Rolle der Fabrikantenfamilien im kommunalen Leben und die Einführung der Bauzonenordnung werden beleuchtet, um den Kontext der Wohnungsbaupolitik zu erklären.
4. Die Entstehung der „Gartensiedlung Gronauer Wald“: Dieses Kapitel widmet sich der Entstehung der Gronauer Waldsiedlung. Es analysiert die Ideen und Konzepte der Gründer, Anna und Richard Zanders, die Planungsphasen, die Verkaufsbedingungen der Grundstücke, die Architektur der Häuser, die verschiedenen Bauphasen und die öffentliche Resonanz auf das Projekt. Die Rolle der beteiligten Architekten wie Bopp und Will wird ebenfalls erläutert.
5. Die Grund- und Aufrissgestaltung in der Gronauer Waldsiedlung: Dieses Kapitel beschreibt die derzeitige Grund- und Aufrissgestaltung der Siedlung, die unterschiedlichen Bauphasen und ihre jeweiligen architektonischen Merkmale. Es wird die Straßenstruktur erläutert und der aktuelle Zustand der Gebäude, inklusive der durchgeführten Modernisierungen und Umbauten, analysiert.
6. Schutz und Erhaltung in der Gronauer Waldsiedlung: Das Kapitel erläutert die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Denkmalschutzes in Nordrhein-Westfalen, definiert die Begriffe „Denkmal“ und „Denkmalbereich“ und diskutiert verschiedene Instrumente des Schutzes, wie die Erhaltungs-, Gestaltungs- und Denkmalbereichssatzung. Es werden die Herausforderungen und Möglichkeiten des Denkmalschutzes für die Gronauer Waldsiedlung im Detail diskutiert.
7. Satzung zur Erhaltung des historischen Erscheinungsbildes: Dieses Kapitel enthält einen Entwurf einer Denkmalbereichssatzung zum Schutz des historischen Erscheinungsbildes der Gronauer Waldsiedlung. Die Satzung spezifiziert den örtlichen Geltungsbereich, den sachlichen Schutzgegenstand und die Rechtsfolgen, um eine nachhaltige Erhaltung zu gewährleisten.
8. Vorschlag für einen Rundgang durch die Gronauer Waldsiedlung: Ein vorschlag für einen Rundgang durch die Siedlung, der die wichtigsten und interessantesten Aspekte der Architektur und Geschichte der Siedlung hervorhebt.
Schlüsselwörter
Gronauer Waldsiedlung, Bergisch Gladbach, alternativer Kleinwohnungsbau, Arbeiterwohnbau, Gartenstadt, Familie Zanders, Richard Zanders, Anna Zanders, Ludwig Bopp, Peter Will, Denkmalschutz, Denkmalbereichssatzung, Sozialgeschichte, Stadtentwicklung, Industrialisierung, Bauzonenordnung.
Häufig gestellte Fragen zur Gronauer Waldsiedlung in Bergisch Gladbach
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung der Gronauer Waldsiedlung in Bergisch Gladbach, einem bedeutenden Beispiel für alternativen Kleinwohnungsbau im ausgehenden 19. Jahrhundert. Analysiert werden die Entstehung der Siedlung, die zugrundeliegenden Planungen und der heutige Zustand. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung eines Schutzkonzeptes für den Erhalt des historischen Erscheinungsbildes.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Motivation zur Gründung der Gronauer Waldsiedlung, die Planungs- und Gestaltungsprinzipien, den heutigen Zustand der Gebäude und das Erscheinungsbild der Siedlung, Möglichkeiten zum nachhaltigen Schutz des historischen Gesamtgefüges und den Kontext des alternativen Arbeiterwohnbaus im ausgehenden 19. Jahrhundert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einleitung, Wohnsituation der Arbeiter im ausgehenden 19. Jahrhundert, Entwicklung der Stadt Bergisch Gladbach, Entstehung der Gartensiedlung Gronauer Wald, Grund- und Aufrissgestaltung der Siedlung, Schutz und Erhaltung, Satzung zur Erhaltung des historischen Erscheinungsbildes, Vorschlag für einen Rundgang und Zusammenfassung/Ausblick. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt der Gronauer Waldsiedlung.
Welche Rolle spielte die Familie Zanders?
Die Familie Zanders, insbesondere Richard und Anna Zanders, spielte eine entscheidende Rolle bei der Gründung und Entwicklung der Gronauer Waldsiedlung. Ihr Engagement und ihre Visionen prägten die Siedlung maßgeblich. Die Arbeit beleuchtet deren kommunales Engagement und die Wohnbauförderung durch die Firma J.W. Zanders.
Welche architektonischen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die Architektur der Häuser in der Gronauer Waldsiedlung, die Rolle der beteiligten Architekten (Bopp, Lindemann, Will) und die verschiedenen Bauphasen. Es werden die Grund- und Aufrissgestaltung, die Straßenstruktur und der heutige Zustand der Gebäude im Detail untersucht.
Wie wird der Denkmalschutz der Siedlung behandelt?
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem Schutz und der Erhaltung der Gronauer Waldsiedlung. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Denkmalschutzes in Nordrhein-Westfalen werden erläutert. Es wird ein Entwurf einer Denkmalbereichssatzung vorgestellt, um den Erhalt des historischen Erscheinungsbildes zu gewährleisten.
Welche Bedeutung hat die Gronauer Waldsiedlung im Kontext des Arbeiterwohnbaus?
Die Gronauer Waldsiedlung wird im Kontext des alternativen Arbeiterwohnbaus im ausgehenden 19. Jahrhundert betrachtet. Die Arbeit vergleicht sie mit anderen Modellen des Arbeiterwohnbaus (z.B. Wilhelminischer Wohngürtel, Werkswohnsiedlungen) und hebt ihre Besonderheiten als Gartenstadt hervor.
Was ist das Ergebnis der Arbeit?
Die Arbeit liefert ein umfassendes Bild der Entstehung, Entwicklung und des heutigen Zustands der Gronauer Waldsiedlung. Sie bietet ein fundiertes Verständnis der historischen, sozialen und architektonischen Aspekte und liefert einen konkreten Vorschlag für den Denkmalschutz der Siedlung in Form einer Denkmalbereichssatzung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gronauer Waldsiedlung, Bergisch Gladbach, alternativer Kleinwohnungsbau, Arbeiterwohnbau, Gartenstadt, Familie Zanders, Richard Zanders, Anna Zanders, Ludwig Bopp, Peter Will, Denkmalschutz, Denkmalbereichssatzung, Sozialgeschichte, Stadtentwicklung, Industrialisierung, Bauzonenordnung.
- Quote paper
- Andreas Kaul (Author), 2006, Alternativer Kleinwohnungsbau im ausgehenden 19. Jahrhundert. Die Gronauer Waldsiedlung in Bergisch Gladbach, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/79425