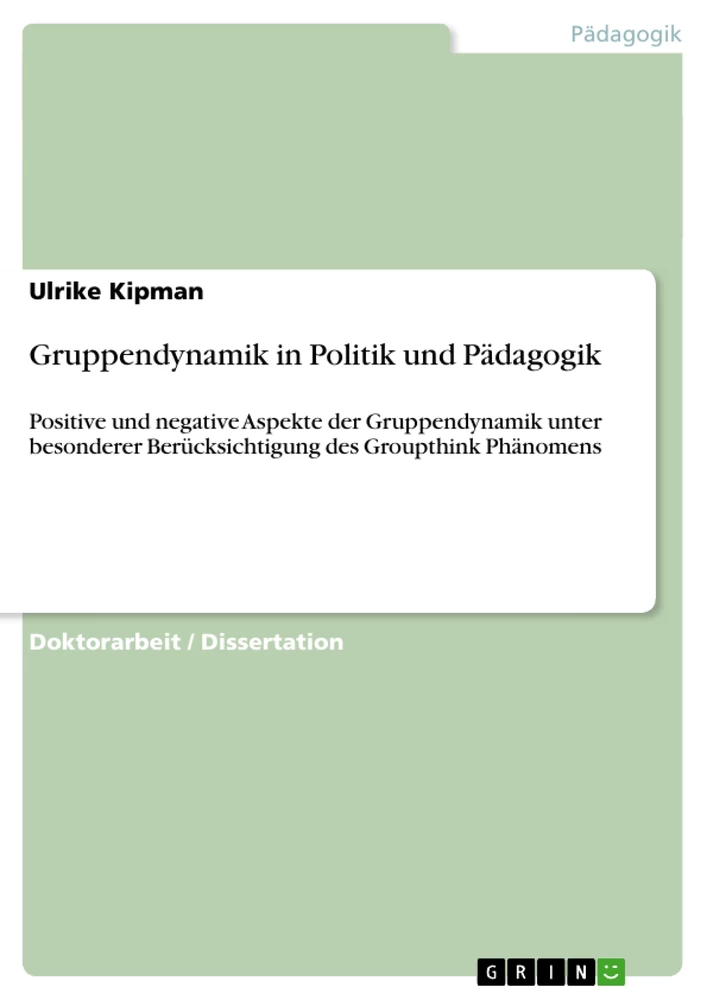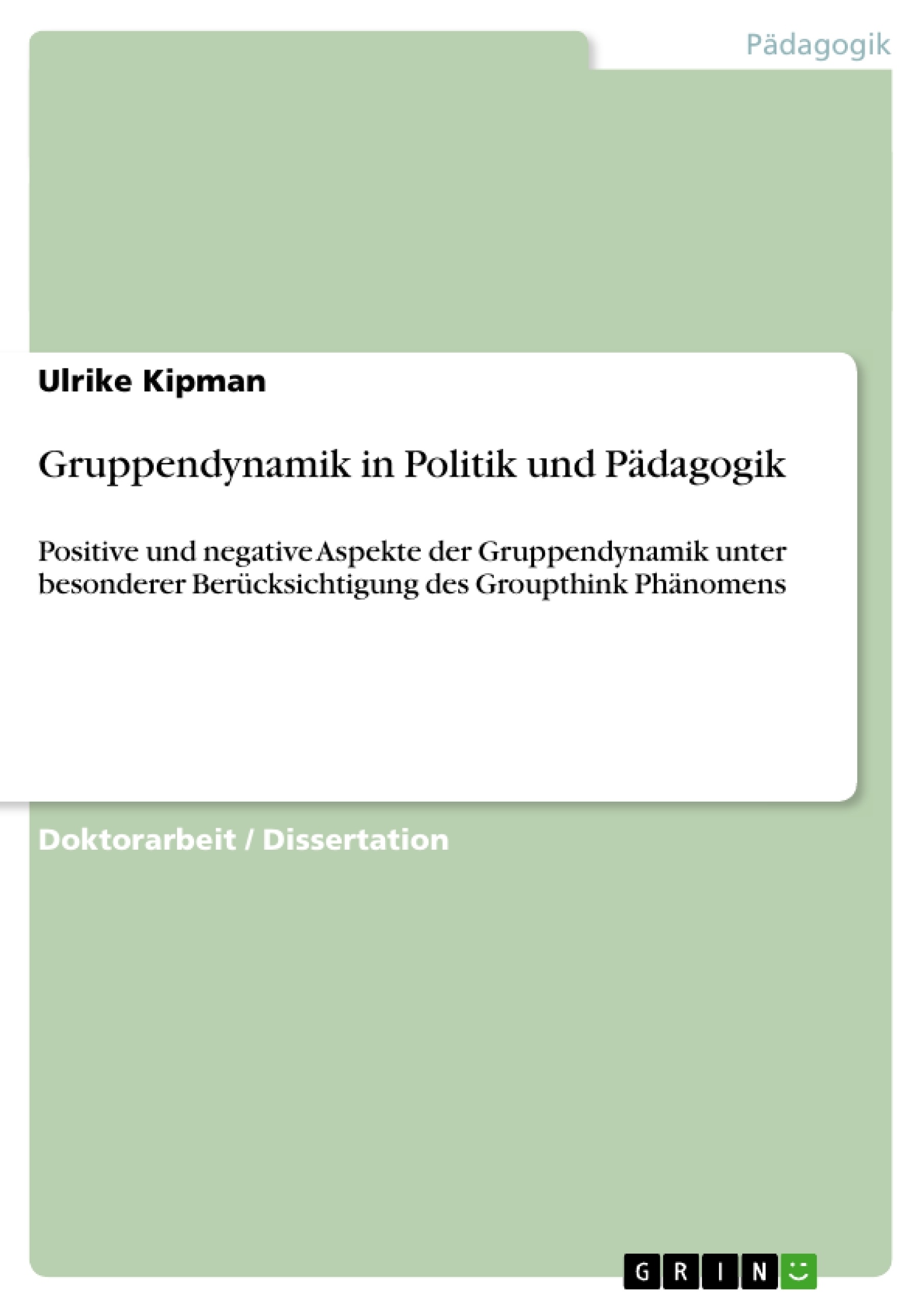Generell wird auf Gefahrenquellen, die die Qualität von Gruppenentscheidungen beeinträchtigen und unter Umständen zu gefährlichen Fehlentscheidungen führen können, eingegangen.
Eines der bekanntesten Modelle der Gruppenforschung, das Groupthink-Modell von Irving Janis (1972), wird – in Fortsetzung zu Janis` bekanntesten Werk mit dem Titel Victims of Groupthink - auf politische Ereignisse der neueren Zeit angewendet.
Ein Aktenstudium liefert empirische Ergebnisse zu gruppendynamischen Geschehnissen in Lehrersitzungen. Am Ende dieser Dissertation wird schließlich ein Fortbildungsprogramm für Lehrer entwickelt, das dazu beiträgt, die Gefahr von Fehlentscheidungen in Lehrerkonferenzen zu verringern.
Zusätzlich zur Lehrerfortbildung wird am Ende noch Ideen für eine Fortbildung für SchulleiterInnen präsentiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Problemstellung
- I. Fehlentscheidungen in Gruppen - Gruppen - ein Garant für gute Entscheidungen?
- II. Das Groupthink-Modell und verwandte Modelle
- A. Das Groupthink-Modell von Irving Janis - Kollektive Kritiklosigkeit und Harmoniestreben in Entscheidungsgremien
- B. Verwandte Modelle
- 1. Das Modell der suboptimalen Informationsnutzung - Informationsaustausch in Kleingruppen – ein oft verbesserungswürdiger Prozess
- 2. Das Entrapment-Modell Entrapment in Gruppen: Die Unfähigkeit, eigene Verluste zu stoppen
- 3. Das Modell des Entscheidungsautismus Ein allgemeines Modell für Selbstbestätigungsprozesse bei Einzel- und Gruppenentscheidungen
- III. Kritik / Anmerkungen Theoretische Probleme und empirische Überprüfungen des Groupthink-Modells
- IV. Gruppendynamik in der Politik Die Rolle des Groupthink-Phänomens anhand von ausgewählten Beispielen der neueren Geschichte
- 1. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl
- 2. Der 11. September 2001
- 3. Der Irak-Krieg 2003
- V. Gruppendynamik in der Politik - Wo die Vermeidung von Groupthink zu positiven Ergebnissen führte
- 1. Die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten 1989
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation untersucht die Gruppendynamik in Politik und Pädagogik, wobei ein besonderer Fokus auf positiven und negativen Aspekten und dem Groupthink-Phänomen liegt. Die Arbeit analysiert verschiedene Modelle zur Erklärung fehlerhafter Gruppenentscheidungen und beleuchtet deren Anwendung anhand historischer Beispiele.
- Analyse des Groupthink-Modells von Irving Janis
- Untersuchung verwandter Modelle zu suboptimaler Informationsnutzung, Entrapment und Entscheidungsautismus
- Anwendung der Modelle auf ausgewählte politische Ereignisse
- Bewertung der theoretischen und empirischen Fundamente der Modelle
- Auswertung von Fallstudien zur Illustration des Groupthink-Phänomens und seiner Vermeidung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und Problemstellung: Die Einleitung definiert die Problemstellung, die Methodik und die Ziele der Arbeit. Es wird die Relevanz der Untersuchung von Gruppendynamik und Groupthink im Kontext von Politik und Pädagogik herausgestellt und der methodische Ansatz der Arbeit skizziert. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Entstehung von Fehlentscheidungen in Gruppen zu analysieren und die Rolle des Groupthink-Phänomens dabei zu beleuchten.
I. Fehlentscheidungen in Gruppen - Gruppen - ein Garant für gute Entscheidungen?: Dieses Kapitel beleuchtet die ambivalente Rolle von Gruppen bei Entscheidungsprozessen. Es werden sowohl die Vorteile der Gruppenarbeit, wie bspw. die Bündelung von Wissen und Perspektiven, als auch die Gefahren, wie z.B. die Entstehung von Gruppenzwang und Konformitätsdruck, diskutiert. Es wird eine Grundlage für das Verständnis der Herausforderungen geschaffen, die bei Gruppenentscheidungen auftreten können und die Notwendigkeit der Analyse von Modellen wie Groupthink verdeutlicht.
II. Das Groupthink-Modell und verwandte Modelle: In diesem Kapitel werden das Groupthink-Modell von Irving Janis und verwandte Modelle detailliert vorgestellt und analysiert. Das Groupthink-Modell wird in seinen Komponenten (Rahmenbedingungen, vermittelnder Mechanismus, beobachtbare Konsequenzen) erklärt und seine Anwendung auf reale Situationen skizziert. Anschließend werden verwandte Modelle, wie das Modell der suboptimalen Informationsnutzung, das Entrapment-Modell und das Modell des Entscheidungsautismus, vorgestellt und im Hinblick auf ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Groupthink-Modell analysiert. Der Vergleich der Modelle bietet eine umfassendere Perspektive auf die Ursachen fehlerhafter Gruppenentscheidungen.
III. Kritik / Anmerkungen Theoretische Probleme und empirische Überprüfungen des Groupthink-Modells: Dieses Kapitel widmet sich einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Groupthink-Modell und den verwandten Modellen. Es werden sowohl theoretische Schwächen als auch die Ergebnisse empirischer Überprüfungen diskutiert. Die kritische Auseinandersetzung dient dazu, die Grenzen der Modelle aufzuzeigen und ihre Anwendbarkeit zu relativieren. Es wird die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise der Gruppendynamik unterstrichen.
IV. Gruppendynamik in der Politik Die Rolle des Groupthink-Phänomens anhand von ausgewählten Beispielen der neueren Geschichte: Dieses Kapitel analysiert anhand von Fallstudien (Tschernobyl, 11. September, Irak-Krieg) die Rolle des Groupthink-Phänomens in politischen Entscheidungsprozessen. Es werden die jeweiligen Ereignisse detailliert beschrieben und die Anwendung der in Kapitel II vorgestellten Modelle auf die jeweilige Situation analysiert. Der Vergleich der Fallstudien dient dazu, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Entstehung und den Konsequenzen von Groupthink aufzuzeigen.
V. Gruppendynamik in der Politik - Wo die Vermeidung von Groupthink zu positiven Ergebnissen führte: Abschließend wird ein Fallbeispiel analysiert, in dem die Vermeidung von Groupthink zu positiven Ergebnissen geführt hat (Wiedervereinigung Deutschlands). Dieser Abschnitt soll zeigen, dass Groupthink kein unabwendbares Schicksal ist und positive Ergebnisse durch konstruktive Gruppendynamik erzielt werden können. Die Analyse dieses Falles bietet einen Kontrast zu den negativen Beispielen aus Kapitel IV und unterstreicht die Bedeutung proaktiver Maßnahmen zur Vermeidung von Groupthink.
Schlüsselwörter
Gruppendynamik, Groupthink, Entscheidungsfindung, politische Entscheidungen, Fehlentscheidungen, Gruppenkohäsion, Informationsnutzung, Konformitätsdruck, Fallstudien, Tschernobyl, 11. September, Irak-Krieg, Wiedervereinigung Deutschlands.
Häufig gestellte Fragen zur Dissertation: Fehlentscheidungen in Gruppen - Analyse des Groupthink-Phänomens
Was ist der Gegenstand dieser Dissertation?
Die Dissertation untersucht die Gruppendynamik in Politik und Pädagogik, mit besonderem Fokus auf positive und negative Aspekte und das Groupthink-Phänomen. Sie analysiert Modelle zur Erklärung fehlerhafter Gruppenentscheidungen und deren Anwendung anhand historischer Beispiele.
Welche Modelle werden analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert das Groupthink-Modell von Irving Janis und verwandte Modelle wie das Modell der suboptimalen Informationsnutzung, das Entrapment-Modell und das Modell des Entscheidungsautismus. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Modelle im Hinblick auf die Ursachen fehlerhafter Gruppenentscheidungen untersucht.
Welche historischen Ereignisse werden als Fallstudien verwendet?
Die Dissertation analysiert die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, den 11. September 2001 und den Irak-Krieg 2003 als Fallstudien, um die Rolle des Groupthink-Phänomens in politischen Entscheidungsprozessen zu beleuchten. Im Gegensatz dazu wird die deutsche Wiedervereinigung 1989 als Beispiel für die erfolgreiche Vermeidung von Groupthink untersucht.
Welche Kritikpunkte werden an den Modellen geäußert?
Die Arbeit widmet sich einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Groupthink-Modell und den verwandten Modellen. Sowohl theoretische Schwächen als auch Ergebnisse empirischer Überprüfungen werden diskutiert, um die Grenzen der Modelle aufzuzeigen und ihre Anwendbarkeit zu relativieren.
Welche Zielsetzung verfolgt die Dissertation?
Die Dissertation zielt darauf ab, die Entstehung von Fehlentscheidungen in Gruppen zu analysieren und die Rolle des Groupthink-Phänomens dabei zu beleuchten. Sie untersucht die Anwendung der Modelle auf reale Situationen und bewertet deren theoretische und empirische Fundamente.
Welche Kapitel umfasst die Dissertation?
Die Dissertation gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung und Problemstellung, Fehlentscheidungen in Gruppen, Das Groupthink-Modell und verwandte Modelle, Kritik/Anmerkungen zu den Modellen und Gruppendynamik in der Politik (mit positiven und negativen Beispielen).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Dissertation?
Schlüsselwörter sind: Gruppendynamik, Groupthink, Entscheidungsfindung, politische Entscheidungen, Fehlentscheidungen, Gruppenkohäsion, Informationsnutzung, Konformitätsdruck, Fallstudien, Tschernobyl, 11. September, Irak-Krieg, Wiedervereinigung Deutschlands.
Was ist die Kernaussage der Dissertation?
Die Dissertation zeigt, dass Groupthink ein erheblicher Faktor bei Fehlentscheidungen in Gruppen sein kann, aber auch vermeidbar ist. Durch die Analyse verschiedener Modelle und historischer Ereignisse wird ein umfassendes Verständnis der Gruppendynamik und ihrer Auswirkungen vermittelt.
- Quote paper
- MMag. DDr. B.Sc. Ulrike Kipman (Author), 2006, Gruppendynamik in Politik und Pädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/78801