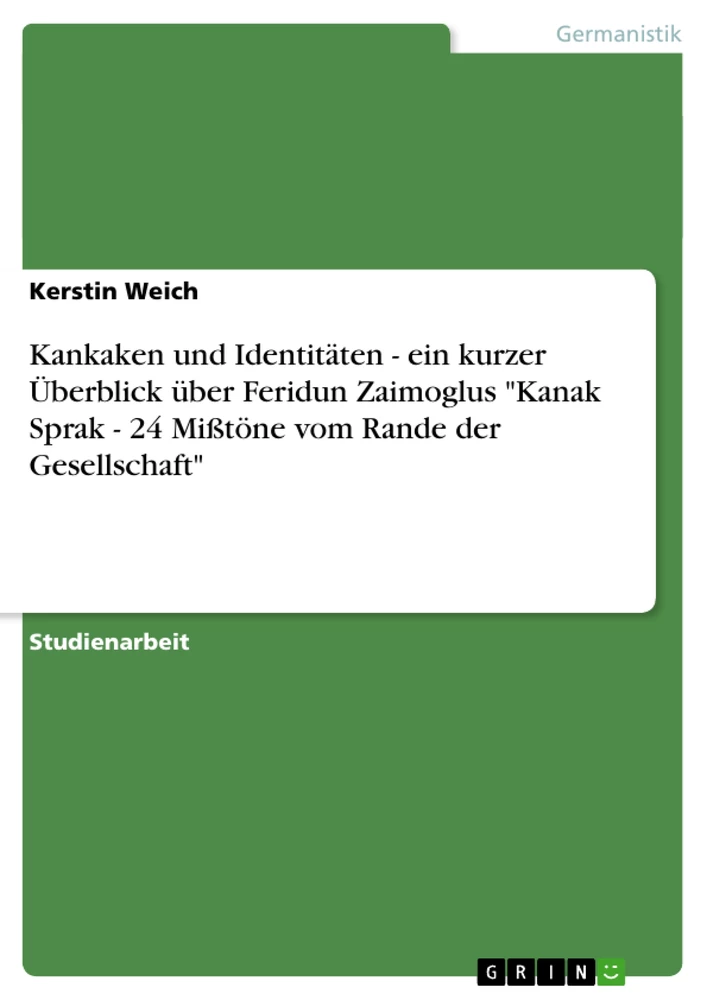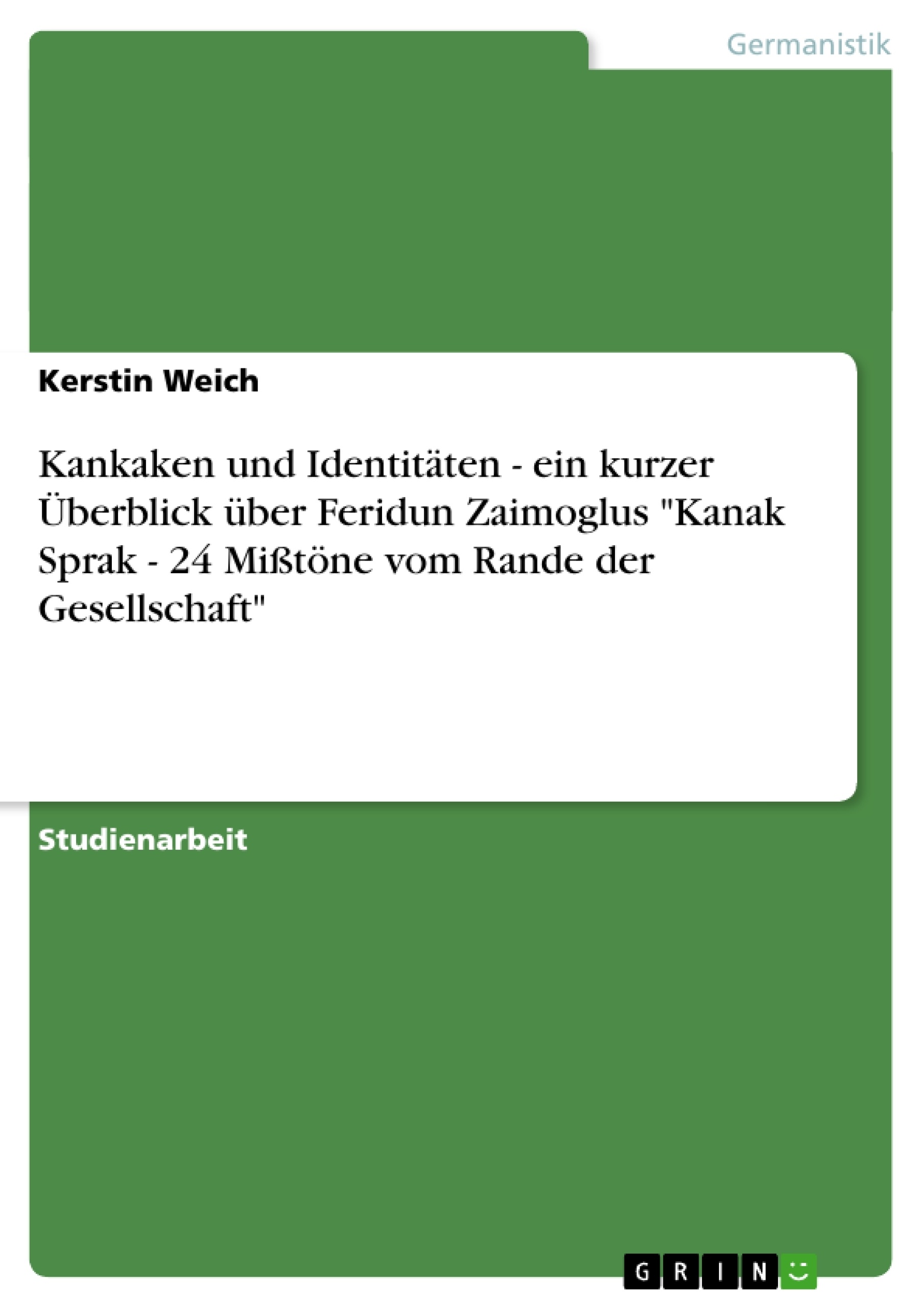Das Buch „Kanak Sprak- 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft“ von Feridun Zaimoglu scheint ein „klassisches“ Beispiel neuester deutscher Migrationsliteratur zu sein, das sich Interpretationsverfahren, denen Texte dieses Genres unterzogen werden, problemlos anbietet. Bei näherer Betrachtung wird klar, dass dieser Eindruck mit Absicht erweckt wird, und so eine Reflexion der Kategorie „Migrationsliteratur“, sowie der Konsequenzen, die sich aus der Kategorisierung ergeben können, fordert. Die vorliegende Arbeit hat es sich zum Anliegen gemacht, diesem Hinweis nachzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Migration als Erzählung
- Genese und Gestalt der deutschen Migrationserzählung
- Kollektive Kultur - nationale Kultur
- Globalisierung und Nation
- Nationalliteratur
- >Kanake - eine Strategie des Begriffs
- Authentizität
- Die Stimme als Garant für Authentizität
- Unheimliche Wahrheit
- Homogenität - Heterogenität
- Identitäten in Bewegung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Feridun Zaimoglus "Kanak Sprak" als Fallbeispiel für die deutsche Migrationsliteratur und hinterfragt die Kategorisierung und die daraus resultierenden Konsequenzen. Sie analysiert die Genese der Migrationserzählung und deren Auswirkungen auf die betroffenen Individuen. Der Fokus liegt auf der Dekonstruktion der Konzepte von nationaler und kollektiver Kultur im Kontext von Migration und Globalisierung.
- Die Konstruktion der Migrationserzählung in der Bundesrepublik Deutschland
- Die kritische Auseinandersetzung mit der Kategorie "Migrationsliteratur"
- Der Einfluss nationaler Identität und Kultur auf die Wahrnehmung von Migration
- Die Rolle von Authentizität in der Migrationsliteratur
- Die Dynamik von Identität im Kontext von Migration und Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort führt in die Thematik ein und präsentiert Feridun Zaimoglus "Kanak Sprak" als Ausgangspunkt für eine kritische Auseinandersetzung mit der Kategorie "Migrationsliteratur" und den damit verbundenen Interpretationsansätzen. Es wird deutlich, dass die Arbeit die impliziten Annahmen und Strategien hinter der Kategorisierung von Literatur fremdstämmiger Autoren hinterfragen möchte.
Migration als Erzählung: Dieses Kapitel diskutiert die Schwierigkeiten bei der Definition von Literatur ausländischer oder fremdstämmiger Autoren in der Bundesrepublik. Es wird der Begriff "Migrationsliteratur" gewählt, wobei "Migration" als moderne diskursive Formation verstanden wird, die eng mit der Konstruktion des modernen Nationalstaates verknüpft ist. Die Autorin betont, dass Migration eine Ursprungserzählung darstellt, die das Selbstverständnis der Betroffenen prägt, unabhängig davon, ob sie persönlich oder vermittelt erfahren wurde.
Genese und Gestalt der deutschen Migrationserzählung: Dieses Kapitel untersucht die Entstehungsgeschichte der Migrationserzählung in der Bundesrepublik. Der Beginn der Einwanderungswelle in den 50er Jahren wird als willkürlicher Ausgangspunkt einer spezifischen, BRD-zentrierten Erzählung identifiziert. Die Autorin betont, dass diese Erzählung das Phänomen Migration erst konstruiert und die Kategorisierung der betroffenen Menschen als Resultat dieser Konstruktion darstellt. Die Kapitel analysiert die Auswirkungen dieser Konstruktion auf die Wahrnehmung der "Migrationsliteratur".
Kollektive Kultur - nationale Kultur: Hier wird die Verbindung zwischen der Gründung eines Nationalstaates und der Erfindung einer kollektiven, nationalen Kultur analysiert. Am Beispiel Deutschlands wird die Hegemonie des bürgerlichen Wertesystems und die ethnische Definition von Kultur dargestellt. Das ius sanguinis wird als Ausdruck einer völkischen Konzeption von Nation beschrieben, die Homogenität und Abgrenzung vom Anderen betont. Der Zusammenhang zwischen nationaler Identität und dem Umgang mit Fremden wird hervorgehoben.
Globalisierung und Nation: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedrohung, die Grenzüberschreitungen im Kontext nationalstaatlicher Vorstellungen von einer homogenen Volksgemeinschaft darstellen können. Die Globalisierung wird als Faktor präsentiert, der dieses nationalstaatliche Bild in Frage stellt und die Grenzen zwischen dem "Eigenen" und dem "Fremden" verwischt. Die Kapitel thematisiert die Spannungen zwischen nationaler Identität und der zunehmenden Globalisierung.
Schlüsselwörter
Migrationsliteratur, nationale Identität, kollektive Kultur, Globalisierung, "Kanak Sprak", Feridun Zaimoglu, Authentizität, ius sanguinis, Diskursanalyse, Identitätskonstruktion.
Häufig gestellte Fragen zu Feridun Zaimoglus "Kanak Sprak"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Feridun Zaimoglus "Kanak Sprak" als Beispiel für deutsche Migrationsliteratur. Sie hinterfragt die Kategorisierung von Migrationsliteratur und deren Konsequenzen, untersucht die Genese der Migrationserzählung und deren Auswirkungen auf betroffene Individuen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Dekonstruktion von nationaler und kollektiver Kultur im Kontext von Migration und Globalisierung.
Welche Themen werden im Buch behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konstruktion der Migrationserzählung in Deutschland, die kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff "Migrationsliteratur", den Einfluss nationaler Identität und Kultur auf die Wahrnehmung von Migration, die Rolle von Authentizität in der Migrationsliteratur und die Dynamik von Identität im Kontext von Migration und Globalisierung. Konzepte wie "Kanak Sprak", ius sanguinis, Homogenität und Heterogenität werden analysiert.
Welche Kapitel umfasst das Buch und worum geht es darin?
Das Buch gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Ein Vorwort, das die Thematik einführt; ein Kapitel über Migration als Erzählung und die Schwierigkeiten bei der Definition von Literatur ausländischer Autoren; ein Kapitel zur Genese und Gestalt der deutschen Migrationserzählung; ein Kapitel über kollektive und nationale Kultur und deren Verbindung zum Nationalstaat; ein Kapitel über Globalisierung und Nation und deren Spannungsfeld; und schließlich ein Schlusskapitel. Jedes Kapitel vertieft die oben genannten Themen aus unterschiedlichen Perspektiven.
Was ist die Kernaussage des Buches?
Die Kernaussage kritisiert die impliziten Annahmen und Strategien hinter der Kategorisierung von Literatur fremdstämmiger Autoren. Es wird argumentiert, dass die Kategorie "Migrationsliteratur" selbst eine Konstruktion ist, die die Wahrnehmung von Migration und die Identität der Autoren beeinflusst. Das Buch plädiert für eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Kategorisierung und ihren Auswirkungen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für das Buch?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Migrationsliteratur, nationale Identität, kollektive Kultur, Globalisierung, "Kanak Sprak", Feridun Zaimoglu, Authentizität, ius sanguinis, Diskursanalyse und Identitätskonstruktion.
Für wen ist dieses Buch relevant?
Dieses Buch ist relevant für Wissenschaftler, Studierende und alle Interessierten, die sich mit Migrationsliteratur, nationaler Identität, kultureller Identität, Globalisierung und der Konstruktion von Literatur auseinandersetzen möchten. Es bietet einen kritischen und analytischen Einblick in die deutsche Migrationsgeschichte und ihre literarische Darstellung.
Wie wird Authentizität im Kontext des Buches betrachtet?
Authentizität wird als problematischer Begriff im Kontext von Migrationsliteratur betrachtet. Das Buch hinterfragt, inwiefern die "Stimme" als Garant für Authentizität angesehen werden kann und wie diese Zuschreibung die Wahrnehmung und Interpretation der Literatur beeinflusst.
Wie wird der Begriff "Kanak Sprak" im Buch behandelt?
Der Begriff "Kanak Sprak" dient als Ausgangspunkt und Fallbeispiel für die Analyse der deutschen Migrationsliteratur und der damit verbundenen Debatten um Identität, Authentizität und Kategorisierung.
- Quote paper
- Kerstin Weich (Author), 2001, Kankaken und Identitäten - ein kurzer Überblick über Feridun Zaimoglus "Kanak Sprak - 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/78688