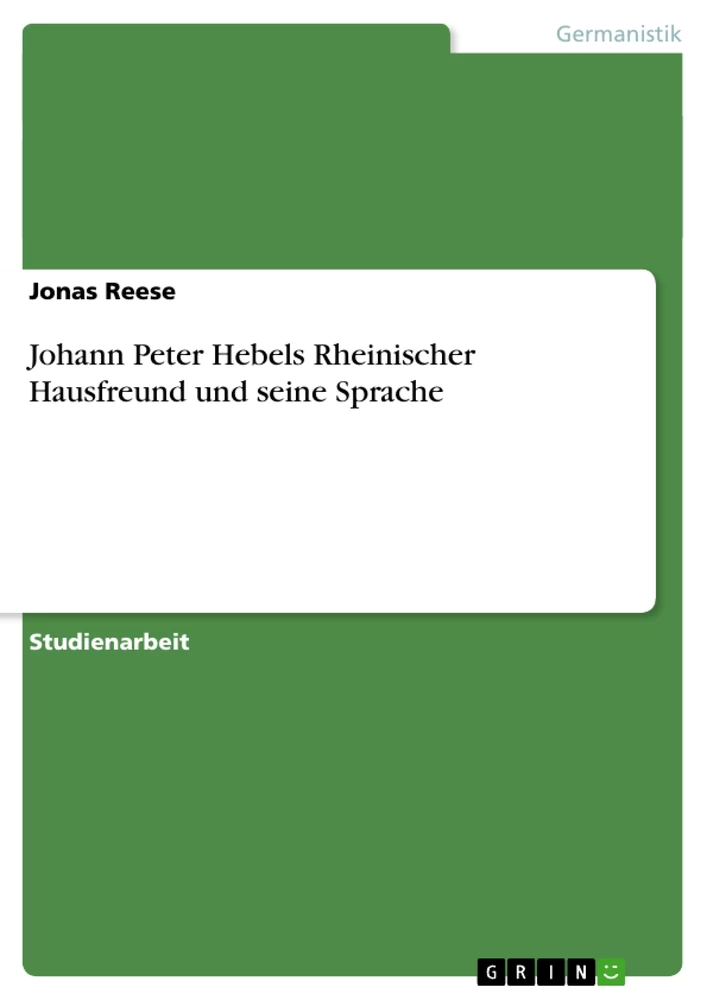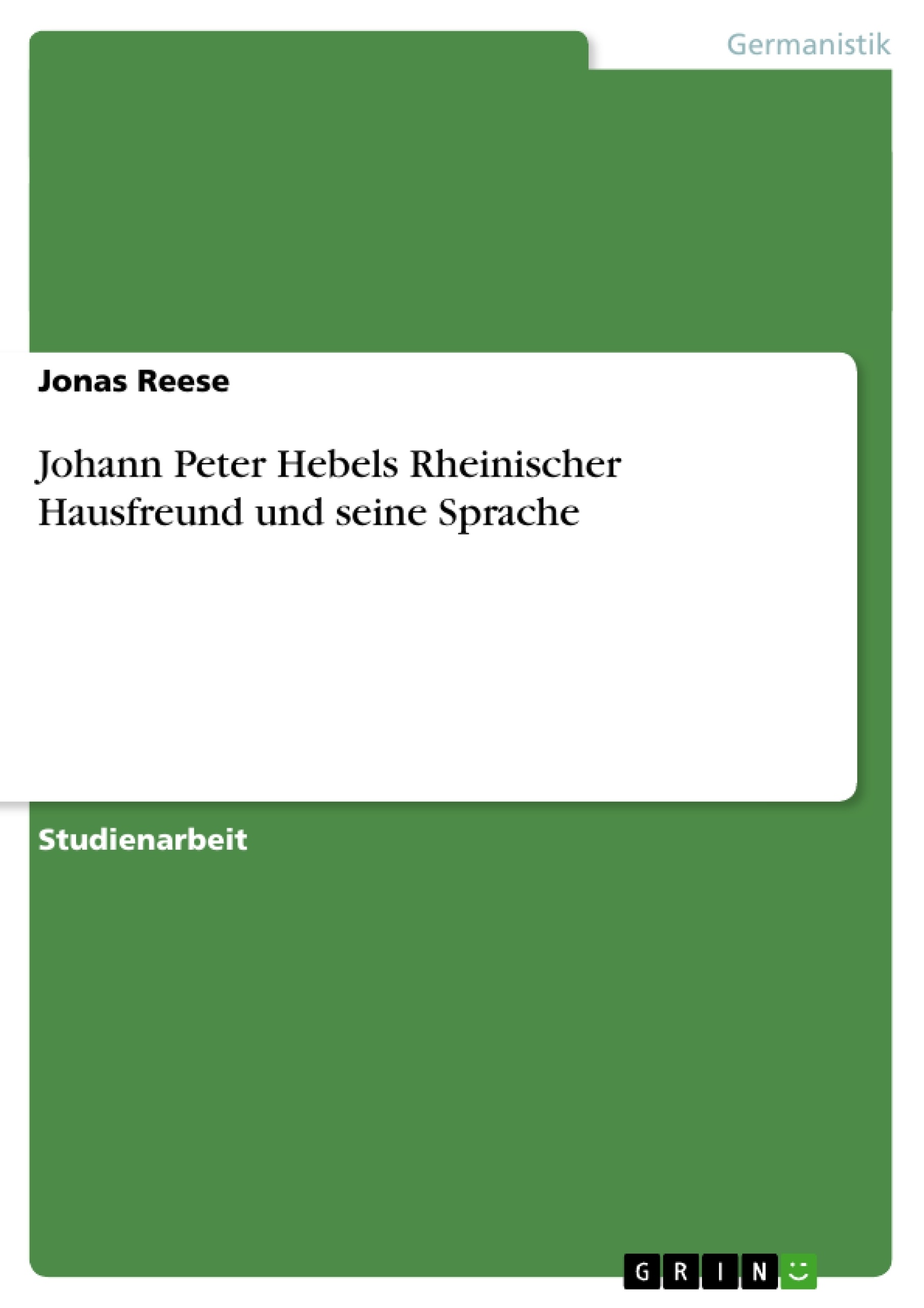Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit sind die Kalendergeschichten Johann Peter Hebels, die er ab dem Jahre 1807 in dem Kalender „Der Rheinländische Hausfreund“ herausgegeben hat. Hauptaugenmerk liegt hier auf der Funktion und der Sprache des epischen Erzählers, des rheinländischen Hausfreunds, sowie auf den Stilmitteln, die die Absichten des Autors umsetzen. Wie hat es Johann Peter Hebel geschafft, sein Ziel zu erreichen, welches er in einem Brief an das Grossherzogliche Ministerium in Karlsruhe formulierte: den Kalender des rheinischen Hausfreundes „zur willkommenen wohltätigen Erscheinung und womöglich zum vorzüglichsten Kalender in ganz Deutschland und zum Siegenden in jeder möglichen Konkurrenz zu machen.“ Natürlich ist es in diesem begrenzten Rahmen nur ausschnittsweise möglich, die Kunst und Stilmittel Hebels herauszustellen. So werden nur die Hauptaspekte seiner Arbeit behandelt. Zuvor ist es aber notwendig einen literaturwissenschaftlichen und kurzen historischen Kontext zu schaffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Literaturwissenschaftliche Einordnung der Kalendergeschichte
- Der „Rheinländische Hausfreund“
- Bedeutung des „Rheinländischen“
- Die Bedeutung des „Hausfreundes“
- Die Funktion des Hausfreunds in den Geschichten
- Die Sprache des Hausfreunds
- Bildlichkeit
- Natürlichkeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kalendergeschichten Johann Peter Hebels, die ab 1807 im „Rheinländischen Hausfreund“ erschienen. Der Fokus liegt auf der Funktion und Sprache des epischen Erzählers, des „rheinländischen Hausfreunds“, und den Stilmitteln, die Hebels Intentionen umsetzen. Die Arbeit beleuchtet, wie Hebel sein Ziel – den Kalender zum erfolgreichsten in ganz Deutschland zu machen – zu erreichen versuchte.
- Die literaturwissenschaftliche Einordnung der Kalendergeschichte als Gattung
- Die Rolle und Charakterisierung des „rheinländischen Hausfreundes“
- Analyse der Sprache und Stilmittel in Hebels Kalendergeschichten
- Der historische Kontext der Kalendergeschichten und ihre Rezeption
- Hebels Intentionen und ihr Erfolg
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den Gegenstand der Untersuchung: die Kalendergeschichten Johann Peter Hebels und deren Erscheinen im „Rheinländischen Hausfreund“ ab 1807. Der Schwerpunkt liegt auf der Funktion und Sprache des Erzählers sowie den Stilmitteln, die Hebels Intentionen verdeutlichen. Die Einleitung verdeutlicht auch die Grenzen der Arbeit und hebt die Notwendigkeit eines literaturwissenschaftlichen und historischen Kontextes hervor, um Hebels Werk angemessen zu analysieren. Sie erwähnt Hebels Brief an das Großherzogliche Ministerium als Ausdruck seiner Ambitionen für den Kalender.
Literaturwissenschaftliche Einordnung der Kalendergeschichte: Dieses Kapitel befasst sich mit der schwierigen Einordnung der Kalendergeschichte als literarische Gattung. Es diskutiert unterschiedliche Definitionen und Ansätze, die sowohl formale Aspekte (Länge, Dialog, etc.) als auch den Kontext der Veröffentlichung im Kalender berücksichtigen. Die Diskussion zeigt die Herausforderungen auf, eine eindeutige Definition zu finden, und beleuchtet unterschiedliche Perspektiven von Forschern wie Kilchenmann, Rohner und Knopf. Das Kapitel argumentiert, dass die Kalendergeschichte aufgrund ihrer Vielfältigkeit und Offenheit für verschiedene literarische Elemente nicht leicht in bestehende Kategorien einzuordnen ist und sich vielmehr durch ihre Vielfältigkeit auszeichnet. Die Einordnung der Kalendergeschichte als „Geschichtsschreibung epischen Charakters“ wird als pragmatischer Ansatz präsentiert.
Der „Rheinländische Hausfreund“: Dieses Kapitel analysiert den Kalender „Rheinländischer Hausfreund“ selbst. Es untersucht die Entwicklung des Titels und den Bezug zu traditionellen Kalenderfiguren wie dem „Hinkenden Boten“. Der „Hausfreund“ wird als Figur des 18. Jahrhunderts charakterisiert, die sich durch ihre freundschaftliche und nahbare Art von dem „Hinkenden Boten“ unterscheidet. Der Abschnitt betont die Bedeutung des Kalenders als eines der wenigen verfügbaren Lesematerialien für die Bevölkerung, insbesondere das Landvolk, in jener Zeit. Die Beschreibung des „Hausfreundes“ als „freundnachbarlich“ unterstreicht seinen integrativen Charakter und seine Rolle in der Kommunikation mit den Lesern.
Schlüsselwörter
Johann Peter Hebel, Kalendergeschichten, Rheinländischer Hausfreund, epischer Erzähler, Sprache, Stilmittel, literarische Gattung, historischer Kontext, Volkskalender, Bürgertum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Kalendergeschichten Johann Peter Hebels im Rheinländischen Hausfreund"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Kalendergeschichten von Johann Peter Hebel, die ab 1807 im „Rheinländischen Hausfreund“ erschienen. Der Fokus liegt auf der Funktion und der Sprache des epischen Erzählers, des „rheinländischen Hausfreundes“, und den verwendeten Stilmitteln, die Hebels Intentionen verdeutlichen. Die Arbeit beleuchtet, wie Hebel sein Ziel – den Kalender zum erfolgreichsten in ganz Deutschland zu machen – zu erreichen versuchte.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die literaturwissenschaftliche Einordnung der Kalendergeschichte als Gattung, die Rolle und Charakterisierung des „rheinländischen Hausfreundes“, die Analyse der Sprache und Stilmittel in Hebels Kalendergeschichten, den historischen Kontext der Kalendergeschichten und ihre Rezeption, sowie Hebels Intentionen und deren Erfolg.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel zur literaturwissenschaftlichen Einordnung der Kalendergeschichte, ein Kapitel zum „Rheinländischen Hausfreund“, ein Kapitel zur Sprache des Hausfreundes (Bildlichkeit und Natürlichkeit) und ein Fazit. Zusätzlich werden Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel bereitgestellt.
Was ist die Bedeutung des „Rheinländischen Hausfreundes“?
Das Kapitel zum „Rheinländischen Hausfreund“ analysiert den Kalender selbst, untersucht die Entwicklung des Titels und den Bezug zu traditionellen Kalenderfiguren. Es betont die Bedeutung des Kalenders als eines der wenigen verfügbaren Lesematerialien für die Bevölkerung, insbesondere das Landvolk, jener Zeit. Der „Hausfreund“ wird als eine freundschaftliche und nahbare Figur des 18. Jahrhunderts charakterisiert, die sich vom „Hinkenden Boten“ unterscheidet.
Wie wird die Sprache und der Stil von Hebels Kalendergeschichten analysiert?
Die Analyse der Sprache und Stilmittel konzentriert sich auf Aspekte wie Bildlichkeit und Natürlichkeit der Sprache des „rheinländischen Hausfreundes“. Die Arbeit untersucht, wie diese Stilmittel Hebels Intentionen unterstützen und zum Erfolg des Kalenders beigetragen haben.
Wie wird die Kalendergeschichte literaturwissenschaftlich eingeordnet?
Dieses Kapitel diskutiert die Schwierigkeiten bei der Einordnung der Kalendergeschichte als literarische Gattung. Es werden verschiedene Definitionen und Ansätze betrachtet, die formale Aspekte (Länge, Dialog etc.) und den Kontext der Veröffentlichung berücksichtigen. Die Arbeit argumentiert, dass die Kalendergeschichte aufgrund ihrer Vielfältigkeit nicht leicht in bestehende Kategorien einzuordnen ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Johann Peter Hebel, Kalendergeschichten, Rheinländischer Hausfreund, epischer Erzähler, Sprache, Stilmittel, literarische Gattung, historischer Kontext, Volkskalender, Bürgertum.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit nennt explizit Kilchenmann, Rohner und Knopf als Forscher, deren Ansätze zur Einordnung der Kalendergeschichte diskutiert werden. Weitere Quellen werden im Text vermutlich zitiert, sind aber in diesem Preview nicht explizit aufgeführt.
- Quote paper
- M.A. Jonas Reese (Author), 2002, Johann Peter Hebels Rheinischer Hausfreund und seine Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/77549