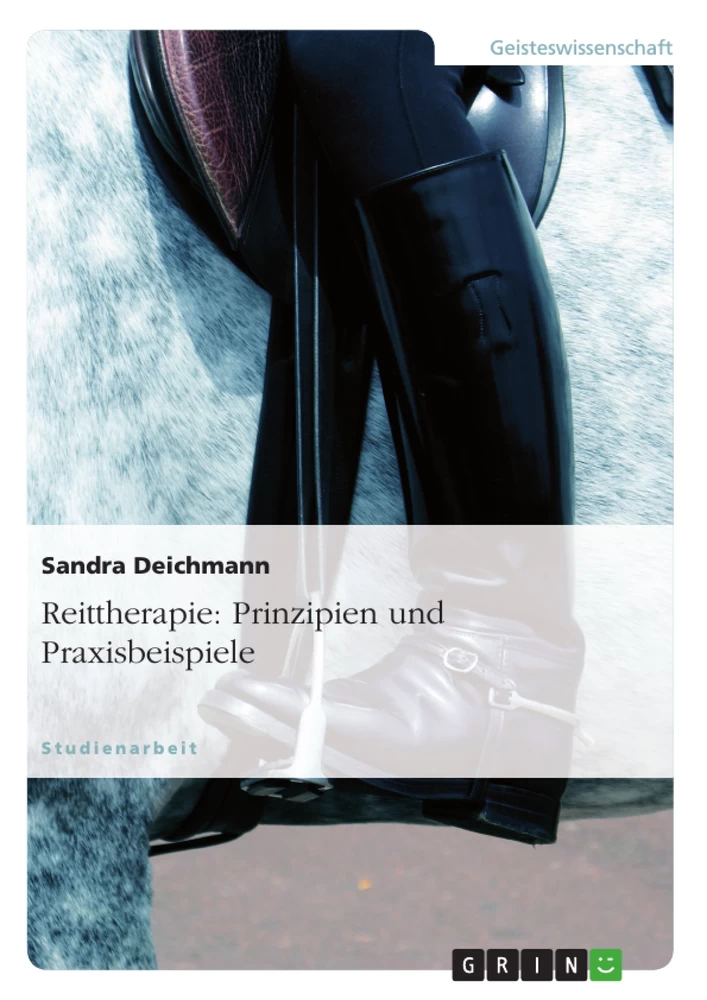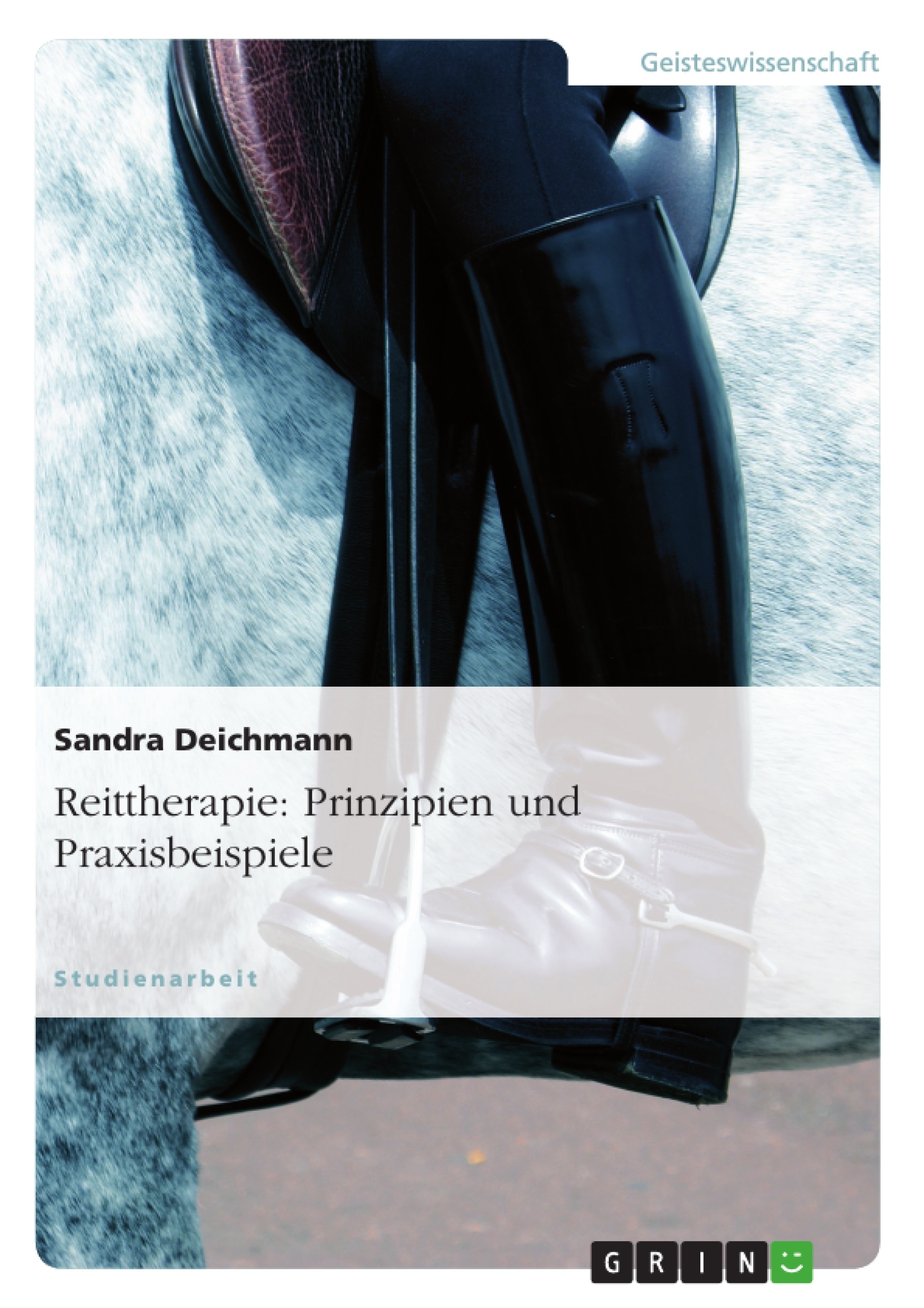Obwohl im Prinzip nur das heilpädagogische Reiten/Voltigieren (HPR/V) zu den „sozial- und psychotherapeutischen Verfahren“ gezählt werden kann, habe ich diese Hausarbeit dennoch eher allgemein gehalten. Zwar liegt wohl ein leichter Schwerpunkt auf diesem Teilbereich der Reittherapie, doch wollte ich aus eigenem Interesse die Hippotherapie und das Reiten als Behindertensport ausreichend mitbeleuchten. Letztendlich wollte ich außerdem einen Überblick über den Gesamtbereich „Reittherapie“ geben und mich nicht nur mit einem Teilaspekt davon befassen. Meiner Ansicht nach sind die Übergänge der einzelnen Disziplinen nämlich derart fließend, dass eine strikte Trennung unmöglich erscheinen muss: der Behindertensport wie die Hippotherapie wirken sich durch den partnerschaftlichen Umgang mit dem Pferd auch positiv auf die Psyche aus, während sowohl beim Sport als auch im HPR/V eine gewisse krankengymnastische Komponente zu finden ist sowie das HPR/V stärker noch als die Hippotherapie von sich aus natürlich eine Form von sportlicher Aktivität darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Mensch und Pferd
- Historische Betrachtung
- Physiologische Wirkung des Reitens
- Psychologische Bedeutung der Mensch-Pferd-Beziehung
- Reittherapie - was ist das?
- Definition
- Das Therapiepferd
- Das Therapiesetting
- Vor- und Nachteile der Therapie mit dem Pferd
- Reiten als Behindertensport
- Allgemeines
- Beispiele
- Hippotherapie
- Das Therapieprinzip
- Indikation und Gegenindikation (nach STRAUß 1991: 50-53)
- Kosten
- Heilpädagogisches Reiten / Voltigieren (HPR/V)
- Definition
- Entstehung und Ziele des HPR/V
- Die Besonderheit des selbständigen Reitens
- Übungen
- Praxisfelder
- Ausbildung zum Reit- oder Voltigierpädagogen in D.
- Abschließende, persönliche Anmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit setzt sich mit dem Thema der Reittherapie auseinander. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Beziehung zwischen Mensch und Pferd, die physiologischen und psychologischen Auswirkungen des Reitens sowie die verschiedenen Formen der Reittherapie. Die Arbeit fokussiert auf die Verwendung des Pferdes im therapeutischen Kontext, insbesondere im Bereich der Heilpädagogik und der Behindertenhilfe.
- Die Mensch-Pferd-Beziehung im historischen Kontext
- Physiologische und psychologische Wirkungen des Reitens
- Reittherapie als therapeutisches Konzept
- Einsatzmöglichkeiten der Reittherapie in der Behindertenhilfe und Heilpädagogik
- Spezifische Formen der Reittherapie wie Hippotherapie und Heilpädagogisches Reiten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die lange Geschichte der Mensch-Pferd-Beziehung, beginnend mit der Jagd auf Wildpferde als Nahrungsquelle bis hin zur Entwicklung der klassischen Hippologie durch Xenophon. Die Domestizierung des Pferdes und seine Nutzung als Last- und Zugtier sowie der Einsatz im Krieg werden ebenfalls erläutert.
Das zweite Kapitel behandelt die physiologische Wirkung des Reitens. Es erklärt, wie die verschiedenen Gangarten des Pferdes den Reiter in Bewegung setzen und wie diese Bewegungsimpulse sich positiv auf verschiedene Körperregionen auswirken.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Reiten als Behindertensport und beleuchtet die verschiedenen Möglichkeiten, wie Pferde Menschen mit Handicaps im Sport unterstützen und fördern können.
Das vierte Kapitel stellt die Hippotherapie vor, eine therapeutische Methode, die die Bewegungen des Pferdes zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten und Koordination von Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen nutzt.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Heilpädagogischen Reiten und Voltigieren (HPR/V) als Form der Reittherapie, die auf die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung von Kindern und Jugendlichen abzielt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Reittherapie, Mensch-Pferd-Beziehung, Hippologie, Physiologische Wirkung, Psychologische Bedeutung, Behindertensport, Hippotherapie, Heilpädagogisches Reiten, Voltigieren.
- Quote paper
- Sandra Deichmann (Author), 2005, Reittherapie: Prinzipien und Praxisbeispiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/77257