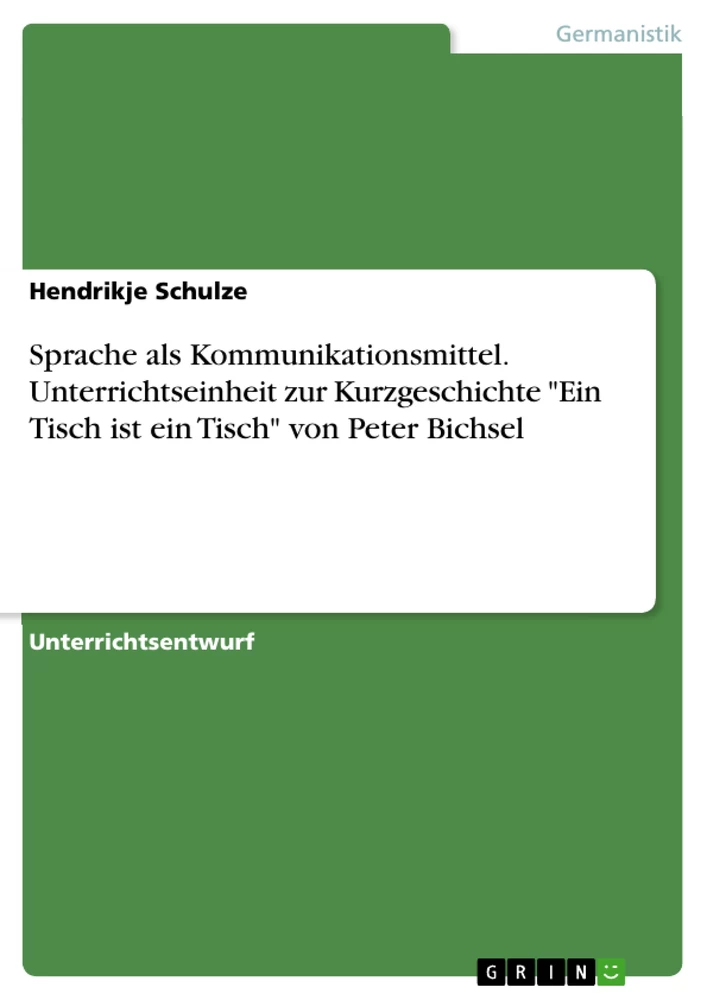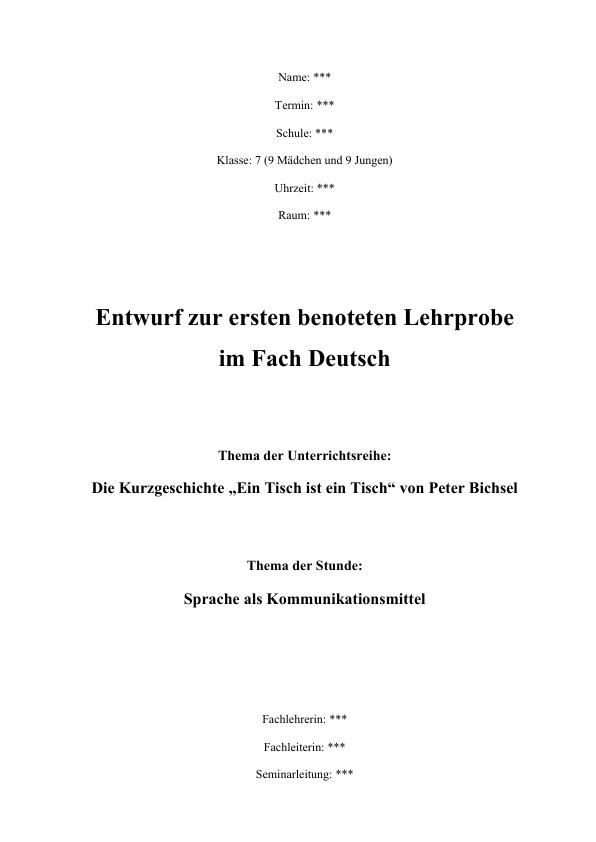Bei der vorliegenden Arbeit handelt sich um einen Unterrichtsentwurf, den die Autorin im Rahmen des Referendariats vorzubereiten hatte. Zielgruppe ist eine 7. Klasse eines Gymnasiums. Entwurf, Lehrprobe und Auswertung wurden mit 13 Punkten bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Pädagogische Situation der Klasse – Unterrichtsvoraussetzungen
- 2. Auswahl und Begründung der Stundenziele
- 3. Didaktisch methodische Überlegungen
- 3.1. Textauswahl
- 3.2. Einordnung der Unterrichtsstunde in die Unterrichtseinheit
- 3.3. Begründung der didaktisch-methodischen Entscheidungen
- 4. Geplanter Stundenverlauf
- 5. Anhang
- 5.1. Sitzplan
- 5.2. Fragen zur Auswertung der Fortsetzungen (Folie)
- 5.3. Wortschlangentext für die Schüler
- 5.4. Kopie der Folie zum Vergleich des Wortschlangentextes
- 5.5. Geplantes Tafelbild
- 5.6. Beispiele für konstruierte Sprachen (Anschauungsmaterial)
- 5.7. Verschlüsselte Überschriften mit Code
- 5.8. Text: Peter Bichsel „Ein Tisch ist ein Tisch“
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Entwurf beschreibt die Vorbereitung einer Lehrprobe im Fach Deutsch für die Klasse 7 zum Thema „Sprache als Kommunikationsmittel“, basierend auf Peter Bichsels Kurzgeschichte „Ein Tisch ist ein Tisch“. Das Hauptziel ist die Bewertung der Schülerfähigkeiten im Umgang mit literarischen Texten und die Förderung des spielerischen Umgangs mit Sprache. Die Lehrprobe analysiert die kommunikativen Aspekte von Sprache und die Fähigkeit der Schüler, Texte zu interpretieren und zu diskutieren.
- Analyse der kommunikativen Funktion von Sprache
- Interpretation literarischer Texte
- Spielerischer Umgang mit Sprache
- Klassenmanagement und Diskussionsführung
- Förderung der individuellen Schülerfähigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Pädagogische Situation der Klasse - Unterrichtsvoraussetzungen: Dieses Kapitel bietet einen detaillierten Einblick in die Klasse 7, ihre Zusammensetzung, die individuellen Stärken und Schwächen der Schüler sowie die bestehenden sozialen Dynamiken. Es beschreibt die Klassenzusammensetzung, die unterschiedlichen Lernniveaus und die sozialen Beziehungen innerhalb der Klasse. Besonderes Augenmerk wird auf Schüler mit besonderen Bedürfnissen (Lese-Rechtschreibschwäche, ADHS) gelegt, sowie auf die Integration neuer Schüler. Die bisherigen Lernerfahrungen der Klasse mit verschiedenen Texten und Arbeitsmethoden werden ebenfalls analysiert, um die didaktische Planung der Lehrprobe zu optimieren. Die Beschreibung der Klassensituation dient als Grundlage für die methodische Gestaltung des Unterrichts.
2. Auswahl und Begründung der Stundenziele: Dieser Abschnitt legt die übergeordneten Ziele der Unterrichtseinheit und die spezifischen Stundenziele der Lehrprobe dar. Die übergeordneten Ziele konzentrieren sich auf das Verständnis der Rolle von Sprache als Kommunikationsmittel und die Auseinandersetzung mit der Situation älterer Menschen. Die Stundenziele konkretisieren dies, indem sie die Bewertung von Schülerbeiträgen, die Textinterpretation und den spielerischen Umgang mit Sprache in den Mittelpunkt stellen. Die Begründung der gewählten Ziele betont den Bezug zu den drei Lernbereichen des Deutschunterrichts (mündlicher und schriftlicher Sprachgebrauch, Umgang mit Texten). Die Auswahl der Stundenziele ist eng an die Bedürfnisse und das Leistungsniveau der Klasse angepasst, um einen erfolgreichen und lehrreichen Unterricht zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Sprache als Kommunikationsmittel, Literarische Textinterpretation, Kurzgeschichte, Peter Bichsel, „Ein Tisch ist ein Tisch“, Klassenmanagement, Diskussionsregeln, spielerischer Sprachunterricht, Schülerförderung, individuelle Lernbedürfnisse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Lehrprobe Deutsch Klasse 7 – Peter Bichsel "Ein Tisch ist ein Tisch"
Was ist der Gegenstand dieser Lehrprobe?
Diese Lehrprobe im Fach Deutsch für die Klasse 7 behandelt das Thema „Sprache als Kommunikationsmittel“ anhand von Peter Bichsels Kurzgeschichte „Ein Tisch ist ein Tisch“. Sie dient der Bewertung der Schülerfähigkeiten im Umgang mit literarischen Texten und der Förderung des spielerischen Umgangs mit Sprache.
Welche Ziele werden in der Lehrprobe verfolgt?
Hauptziel ist die Analyse der kommunikativen Aspekte von Sprache und die Überprüfung der Schülerfähigkeiten in Textinterpretation und Diskussion. Die Lehrprobe zielt auf die Förderung des spielerischen Umgangs mit Sprache und die Berücksichtigung individueller Lernbedürfnisse ab. Konkrete Ziele umfassen die Analyse der kommunikativen Funktion von Sprache, die Interpretation literarischer Texte und effektives Klassenmanagement.
Wie ist die Lehrprobe strukturiert?
Die Lehrprobe gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Beschreibung der pädagogischen Situation der Klasse, die Auswahl und Begründung der Stundenziele, didaktisch-methodische Überlegungen (Textauswahl, Einordnung in die Unterrichtseinheit, Begründung der methodischen Entscheidungen), den geplanten Stundenverlauf, einen Anhang mit Materialien (Sitzplan, Arbeitsblätter, etc.) und ein Literaturverzeichnis.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Lehrprobe konzentriert sich auf die Analyse der kommunikativen Funktion von Sprache, die Interpretation literarischer Texte (speziell die Kurzgeschichte von Peter Bichsel), den spielerischen Umgang mit Sprache, Klassenmanagement und Diskussionsführung sowie die Förderung individueller Schülerfähigkeiten.
Welche Materialien werden in der Lehrprobe verwendet?
Der Anhang enthält diverse Materialien, darunter einen Sitzplan, Fragen zur Auswertung von Textfortsetzungen, den Wortschlangentext für die Schüler, eine Kopie der Folie zum Vergleich des Wortschlangentextes, ein geplantes Tafelbild, Beispiele für konstruierte Sprachen, verschlüsselte Überschriften mit Code und den Text „Ein Tisch ist ein Tisch“ von Peter Bichsel.
Welche Schülerfähigkeiten stehen im Mittelpunkt?
Die Lehrprobe bewertet die Fähigkeiten der Schüler im Umgang mit literarischen Texten, insbesondere deren Interpretationsfähigkeiten und die Fähigkeit zur Diskussion. Die Fähigkeit zum spielerischen Umgang mit Sprache und die Berücksichtigung individueller Lernbedürfnisse spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Wie wird die pädagogische Situation der Klasse berücksichtigt?
Das erste Kapitel beschreibt detailliert die Klassenzusammensetzung, die individuellen Stärken und Schwächen der Schüler, soziale Dynamiken, Lernerfahrungen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen (z.B. Lese-Rechtschreibschwäche, ADHS). Diese Informationen dienen als Grundlage für die methodische Gestaltung des Unterrichts.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Lehrprobe am besten?
Schlüsselwörter sind: Sprache als Kommunikationsmittel, literarische Textinterpretation, Kurzgeschichte, Peter Bichsel, „Ein Tisch ist ein Tisch“, Klassenmanagement, Diskussionsregeln, spielerischer Sprachunterricht, Schülerförderung, individuelle Lernbedürfnisse.
- Arbeit zitieren
- Hendrikje Schulze (Autor:in), 2006, Sprache als Kommunikationsmittel. Unterrichtseinheit zur Kurzgeschichte "Ein Tisch ist ein Tisch" von Peter Bichsel, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/76857