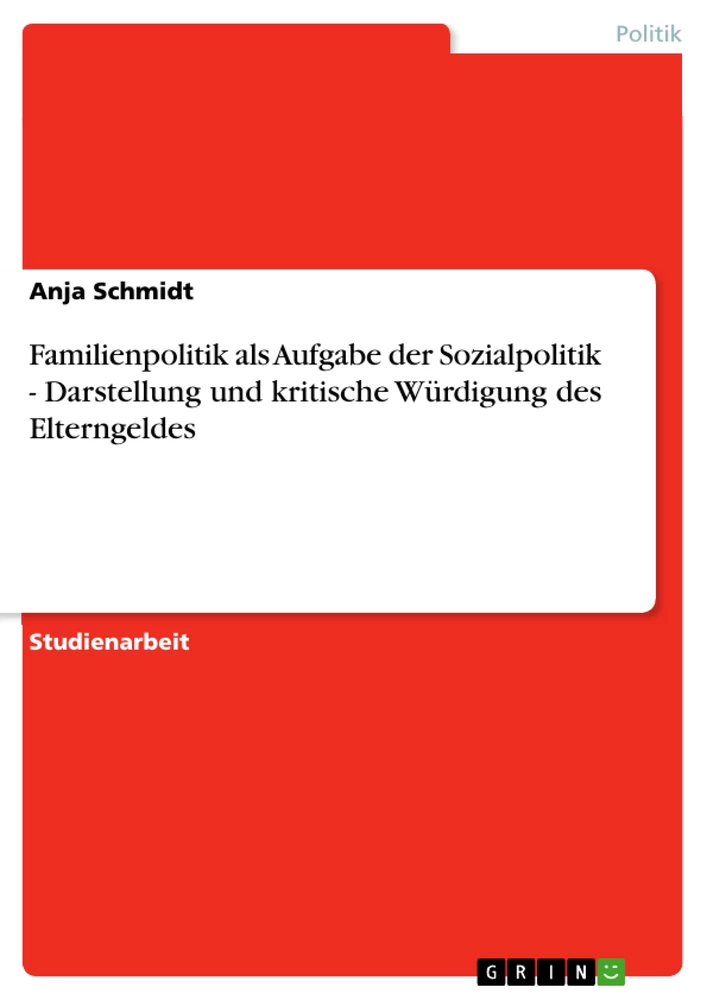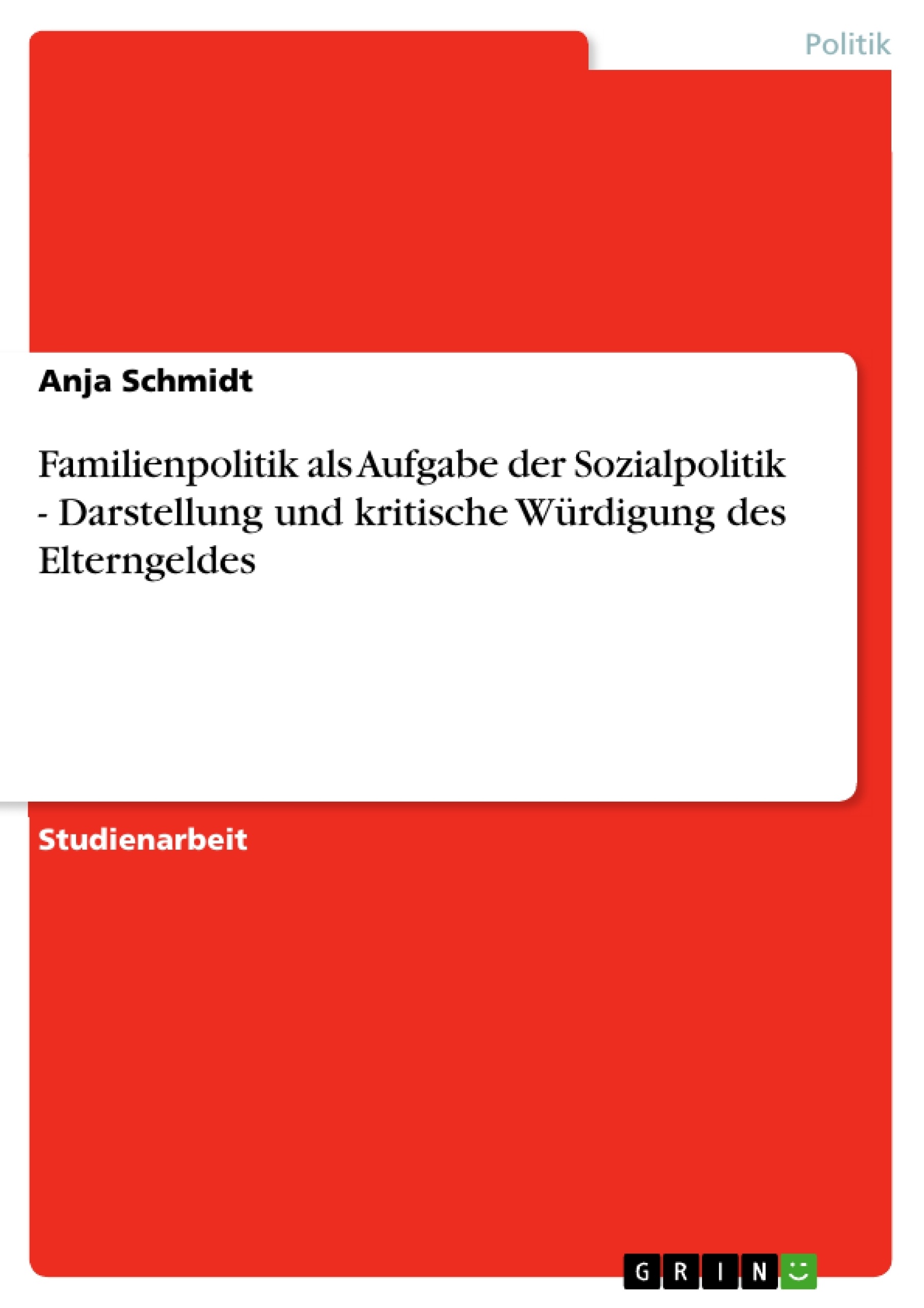Die Familie ist die Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung. Kinder sind die zukünftigen Träger der Gesellschaft. Die Familie regelt das Verhalten des Men-schen, in ihr werden Rücksicht, Toleranz, Liebe, Vertrauen, Geborgenheit sowie Mitverantwortung erlernt. Der Staat schützt Ehe und Familie. „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Pflege und Er-ziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ih-nen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemein-schaft.“
(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art. 6 Abs. 1 und 2.)
Die Erscheinungsformen der Familie als Grundeinheit der Gesellschaft verän-dern sich in einem sich wandelnden sozialen Ganzen. In Deutschland sind Kinder zum Störfaktor geworden, denn sie kosten Geld und schränken die Frei-heit des Konsums ein. Es wird zur Normalität, als Single zu leben und lockere Partnerschaften einzugehen. Wenn eine Familie gegründet wird, kommt das erste und meist einzige Kind nicht vor dem 30. Lebensjahr. Deutschland hat mit 1,35 Kindern eine Fertilitätsrate unter dem EU-Durchschnitt. Die Menschen müssen ermutigt werden mehr Kinder zu bekommen, um den negativen Trend der Bevölkerungsentwicklung zu verlangsamen. Politik und Gesellschaft müs-sen auf diese Entwicklungen mit familienpolitischen Konzepten reagieren und nach Möglichkeiten suchen, um für das Zusammenleben eine Kultur des Mit-einanders zu bewirken, die der Aufgaben- und Leistungsbreite von Familien gerecht wird. Es gilt zu ermitteln, mit welchen längerfristigen Trends eine Fami-lienpolitik zu rechnen und sich auseinandersetzen muss. Denn viele dieser Trends stellen bei genauerer Betrachtung kein unabänderbares Schicksal dar, sondern zeigen sich in manchem Teilaspekt als ein Gestaltungsproblem.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegende Charakteristika der Familienpolitik in Deutschland
- Geschichtliche Entwicklung
- Familienleistungen in Deutschland
- Aufgaben und Ziele
- Umfang der Familieninvestitionen
- Maßstäbe einer nachhaltigen Familienpolitik
- Ausgestaltung des Elterngeldes
- Allgemeine Eckpunkte
- Voraussetzungen für den Bezug
- Höhe und Berechnung
- Bezugsdauer
- Beantragung und Fristen
- Auswirkungen auf die Kranken- und Pflegeversicherung
- Kritische Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat widmet sich der Darstellung und kritischen Würdigung des Elterngeldes in Deutschland. Es beleuchtet die historische Entwicklung der Familienpolitik, die Aufgaben und Ziele von Familienleistungen sowie die Gestaltung des Elterngeldes. Darüber hinaus werden die Auswirkungen des Elterngeldes auf die Kranken- und Pflegeversicherung analysiert.
- Die historische Entwicklung der Familienpolitik in Deutschland
- Die Aufgaben und Ziele von Familienleistungen
- Die Gestaltung des Elterngeldes und seine Auswirkungen
- Die Bedeutung des Elterngeldes für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Die Herausforderungen der Familienpolitik im Kontext des demografischen Wandels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Familie als Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung und die Herausforderungen, die der demografische Wandel für die Familienpolitik mit sich bringt. Kapitel 2 untersucht die grundlegenden Charakteristika der Familienpolitik in Deutschland, ihre historische Entwicklung und die Aufgaben und Ziele von Familienleistungen. Kapitel 3 widmet sich der Ausgestaltung des Elterngeldes, einschließlich der allgemeinen Eckpunkte, der Voraussetzungen für den Bezug, der Berechnung der Höhe, der Bezugsdauer, der Beantragung und der Auswirkungen auf die Kranken- und Pflegeversicherung. Die kritische Betrachtung des Elterngeldes wird ebenfalls in Kapitel 3 beleuchtet.
Schlüsselwörter
Familienpolitik, Elterngeld, Familienleistungen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, demografischer Wandel, Kinderbetreuung, Familienförderung, Soziale Sicherung, Gesundheitswesen, Pflegeversicherung.
- Quote paper
- Anja Schmidt (Author), 2007, Familienpolitik als Aufgabe der Sozialpolitik - Darstellung und kritische Würdigung des Elterngeldes, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/76026