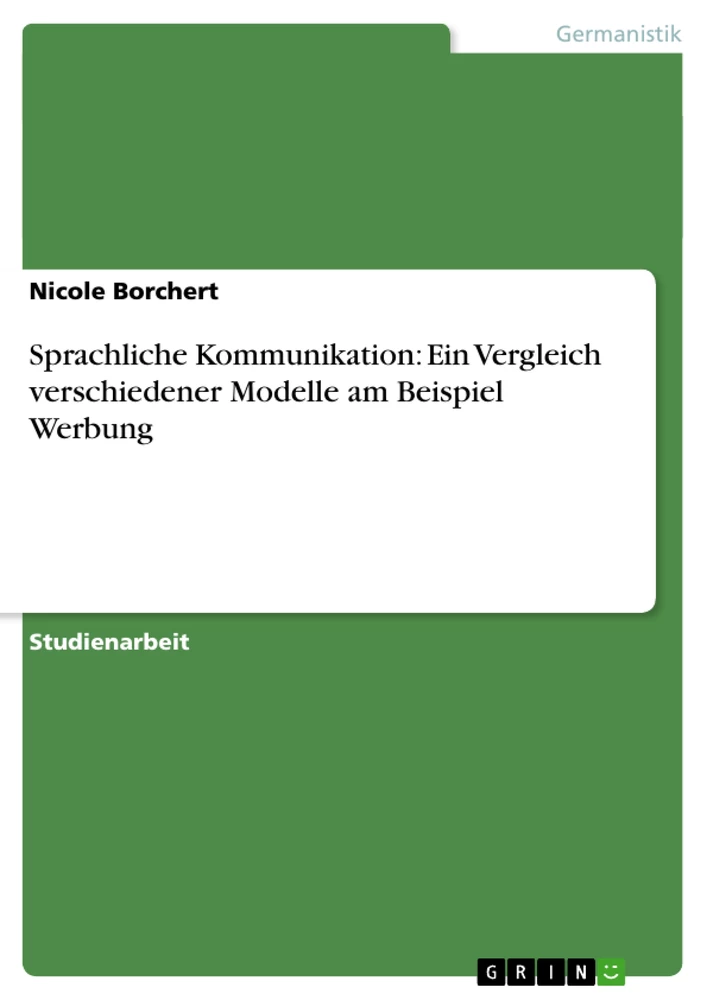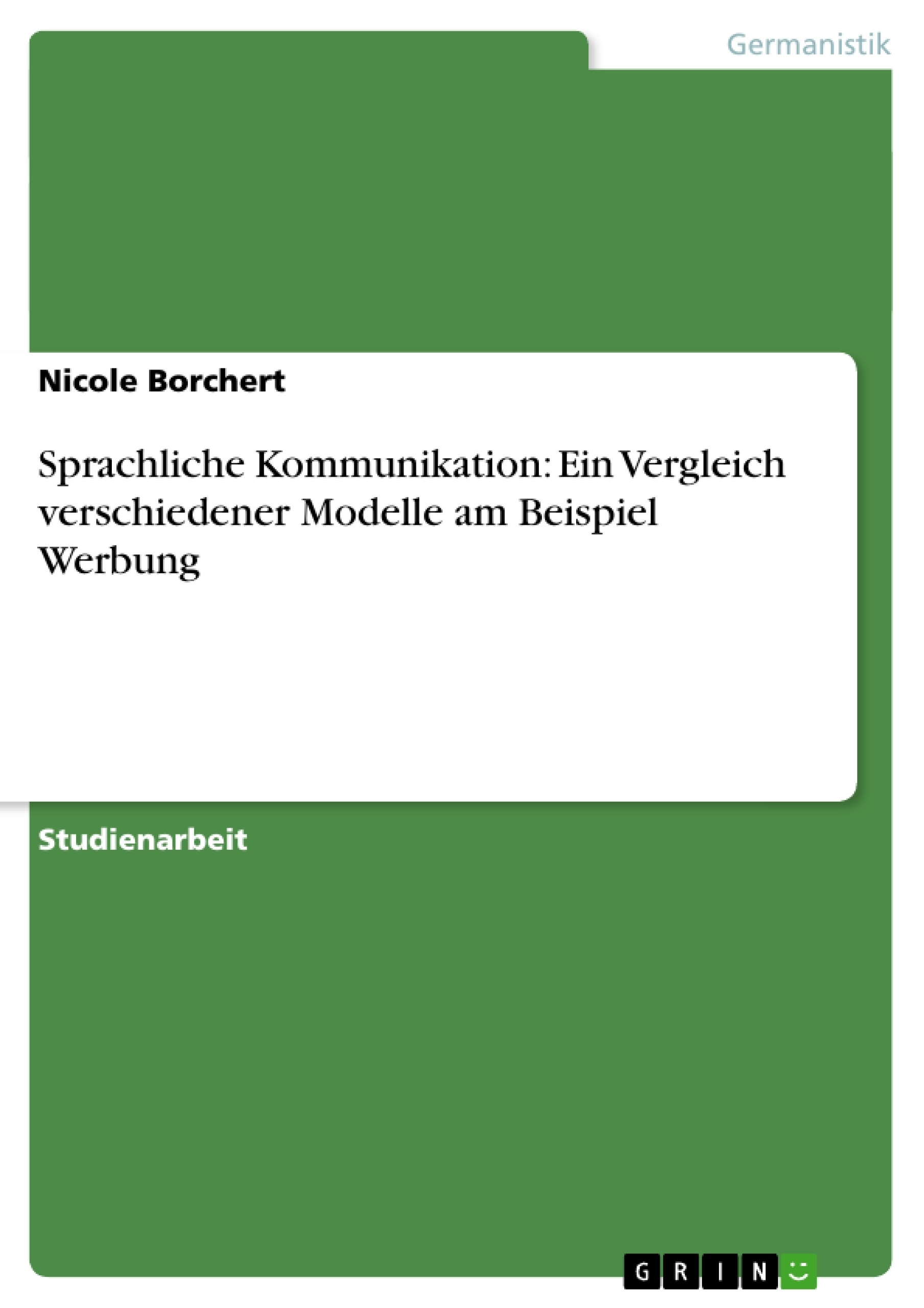Bei dem Begriff Kommunikation handelt es sich um eine Ableitung vom lateinischen Verb communicare, was soviel bedeutet wie „gemeinsam machen“, „vereinigen“ oder „mitteilen“ (Hoberg 2004: 13). Die etymologische Bedeutung impliziert bereits ein charakteristisches Kennzeichen von Kommunikation, und zwar dass sie nur unter der Voraussetzung zweier Parteien erfolgen kann, also stets etwas „Gemeinsames“ darstellt. Die Beteiligten eines Kommunikationsprozesses werden durch die Unterteilung in Sender und Empfänger differenziert, wobei der Sender etwas mitteilt, beziehungsweise die Intention einer Mitteilung verfolgt, und der Empfänger diese Mitteilung als Information aufnimmt und ideal-erweise mit ihr etwas anzufangen weiß.
Kommunikation ereignet sich mittels Zeichen, welche zwischen den Kommunikationspartnern vereinbart wurden. Die Übermittlung von Zeichen beinhaltet immer auch Handlungsorientierungen, also Hinweise und Anhaltspunkte für Handlungen (vgl. Buddemeier 1973: 18). Demnach richtet sich Kommunikation immer auf Handlungszusammenhänge, da der Sender einerseits eine bestimmte Erwartungshaltung hat, und der Empfänger andererseits die intendierte Handlungsorientierung verstehen muss. Eine Kommunikation gilt dann als „gelungen“, wenn die ausdrückliche oder verdeckte Handlungsorientierung vom Empfänger verstanden wurde, unabhängig davon, ob er dieser nachkommt
(vgl. Buddemeier 1973: 18).
Kommunikation entsteht also nicht dadurch, dass jemand etwas sagt und ein anderer dies akustisch wahrnimmt, sondern von Kommunikation kann erst dann die Rede sein, wenn Zeichen übermittelt und verstanden werden, und wenn sich vor allem für den Rezipienten daraus eine vom Produzenten intendierte Handlungsorientierung ergibt (vgl. Buddemeier 1973: 27). Eine derartige Handlungsorientierung kann in dem Sinne „verdeckt“ sein, dass beispielsweise der Autor eines Romans keine direkte Anleitungen für Handlungen liefert, dennoch Wirkungen beim Leser hervorrufen kann, welche er durch Stil, Form und Erzählweise beabsichtigt hat (vgl. Buddemeier 1973: 33).
Im weiteren Sinne wird unter Kommunikation „jede Form von wechselseitiger Übermittlung von Informationen durch Zeichen/ Symbole zwischen Lebewesen (Menschen, Tieren) oder Daten verarbeitenden Maschinen“ verstanden
(Bußmann 2002: 354).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Kommunikation?
- Zielsetzung und Herangehensweise
- Zwischenmenschliche Kommunikation
- Kommunikationsformen
- Kommunikationsbedingungen
- Kommunikationsmodelle
- Grundfragestellungen
- Vergleich verschiedener Modelle
- Lasswell (1948)
- Shannon und Weaver (1949)
- Bühler (1934)
- Jakobson (1960)
- Kommunikation in der Werbung
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit dem Konzept der sprachlichen Kommunikation und analysiert unterschiedliche Modelle, um die komplexen Prozesse der Informationsübertragung und -verarbeitung zu verstehen. Dabei liegt der Fokus auf dem Vergleich verschiedener Ansätze und ihrer Anwendung im Kontext von Werbung.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Kommunikation“
- Untersuchung verschiedener Kommunikationsformen und -bedingungen
- Analyse und Vergleich unterschiedlicher Kommunikationsmodelle
- Anwendung der Modelle auf die Praxis der Werbekommunikation
- Bedeutung der Komponenten eines Kommunikationsprozesses in der Werbung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das erste Kapitel bietet eine grundlegende Einführung in das Konzept der Kommunikation, indem es den Begriff etymologisch beleuchtet und verschiedene Definitionen sowie die Bedeutung der Handlungsorientierung in Kommunikationsprozessen diskutiert.
- Zwischenmenschliche Kommunikation: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Kommunikationsformen wie verbaler und nonverbaler Kommunikation sowie mit den Bedingungen, die zu erfolgreichem Austausch führen.
- Kommunikationsmodelle: In diesem Kapitel werden verschiedene Modelle der Kommunikation vorgestellt und verglichen. Dazu gehören unter anderem die Modelle von Lasswell, Shannon und Weaver, Bühler und Jakobson.
Schlüsselwörter
Kommunikation, Sprachwissenschaft, Kommunikationsmodelle, Werbung, Handlungsorientierung, Sender, Empfänger, Medium, Kommunikationscode, Nachricht, Information, Störungen, Sprachliche Mittel, Nonverbale Kommunikation, Pragmatik
- Quote paper
- Nicole Borchert (Author), 2007, Sprachliche Kommunikation: Ein Vergleich verschiedener Modelle am Beispiel Werbung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/73624