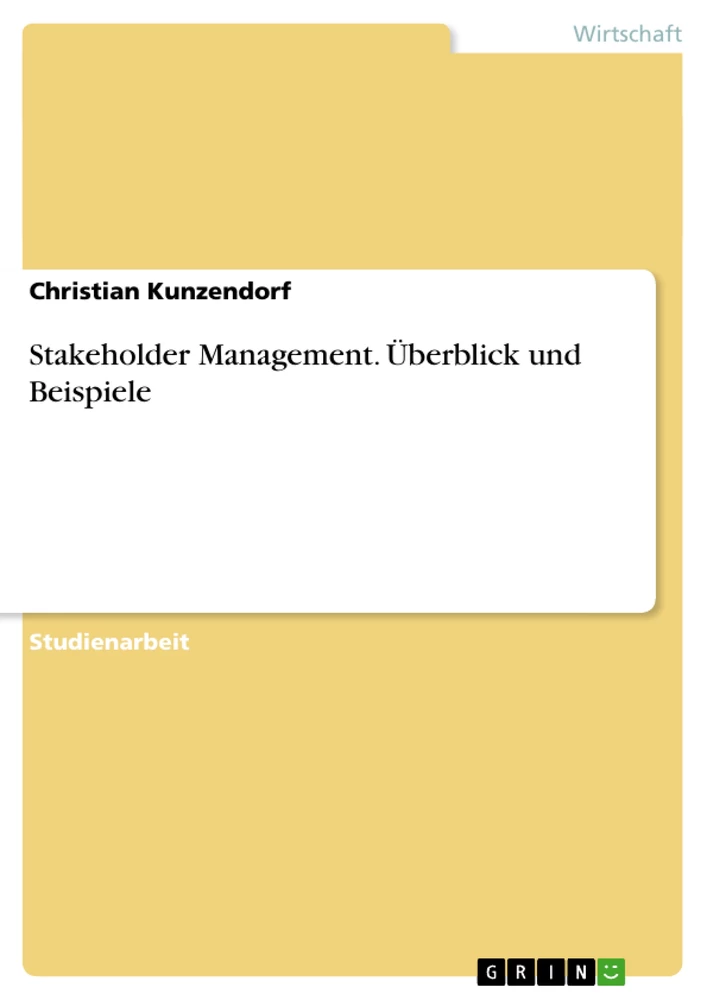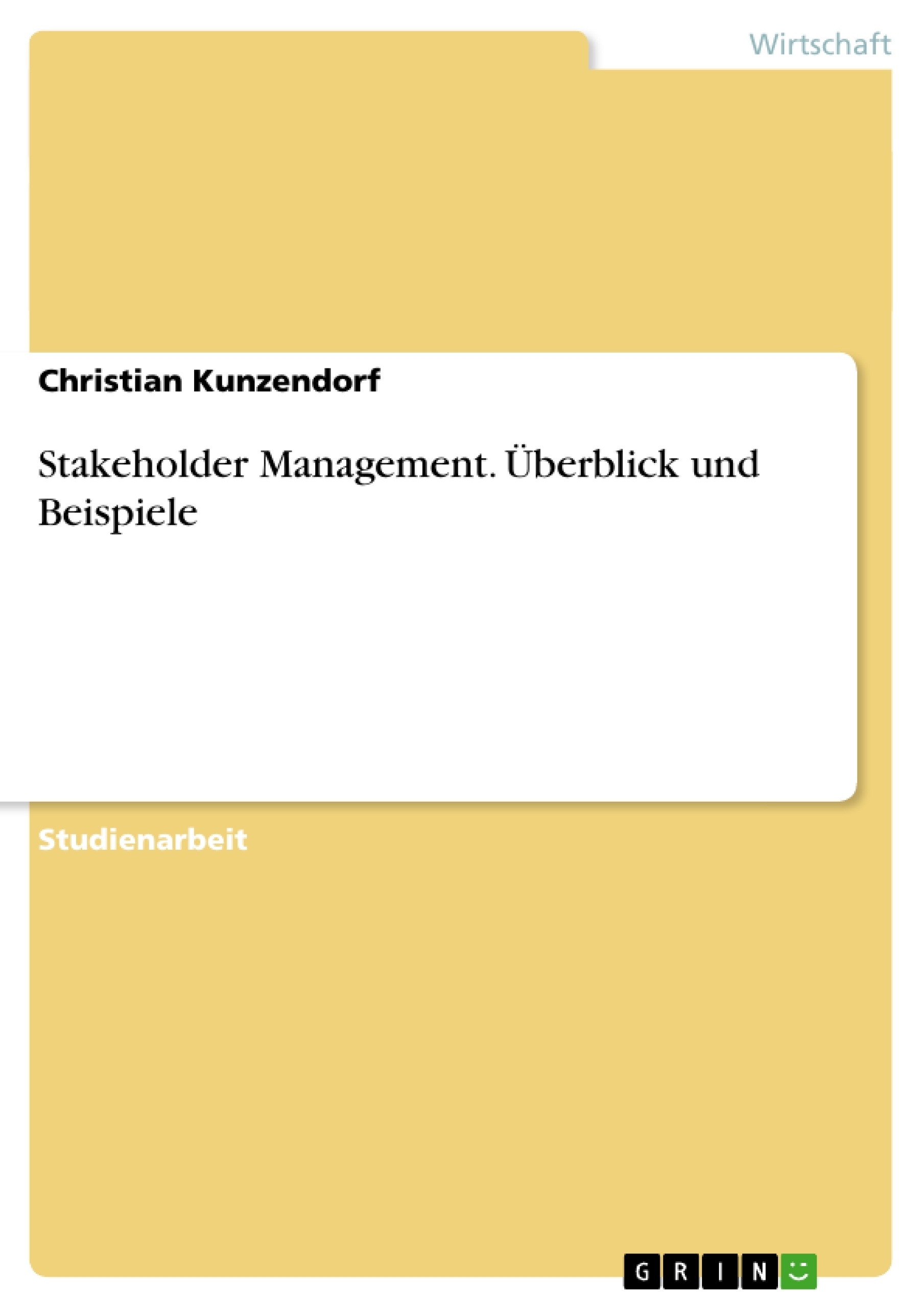Das Wörterbuch übersetzt den englischen Begriff stake mehrdeutig mit dem Wort Einlage, Anteil oder Beteiligung. Ein Stakeholder kann demnach als Inhaber eines Anteils oder einer Beteiligung an einer Sache verstanden werden.
Erste in diese Richtung gehende Gedanken äußerte bereits 1759 der britische Moralphilosoph und Ökonomen ADAM SMITH. 200 Jahre später wurde der Begriff des „Stakeholder“ erstmalig vom STANFORD RESEARCH INSTITUTE verwendet um ein Modell zu beschreiben, in dem eine Unternehmung nicht ohne die Unterstützung seiner „Stakeholder“ überleben kann. Die ersten ausführlichen Gedanken über den Umgang von Unternehmen mit Stakeholdern äußerte R. Edward FREEMAN 1984 seinem Buch „Strategic Management: A Stakeholder Approach“. Er wird seitdem auch als Begründer des „Stakeholder Management“ bezeichnet.
Bis zum heutigen Tage wurden zahlreiche Beiträge zum Stakeholder Ansatz und Stakeholder Management Konzept veröffentlicht. Dennoch herrscht weiterhin eine kontroverse Debatte über die theoretischen Grundlagen und Fragen der praktischen Umsetzung in Unternehmen.
Der Stakeholder Ansatz fordert das unternehmerische Handeln an den Ansprüchen seiner Stakeholder auszurichten. SCHUPPISSER bezeichnet diesen Ansatz als „äußerst fruchtbar, weil er es ermöglicht, die traditionell auf Märkte, Branchen, Ressourcen und den Wettbewerb ausgerichtete Steuerung [.] von Unternehmungen substanziell zu ergänzen um eine auf eine breiter gefasste Umwelt fokussierte Perspektive“ zu ermöglichen. Dabei sehen DEIX/ ROHRER / WIRT in der „Erweiterung des Horizontes von [.] zu berücksichtigenden Ansprüchen über die der Anteilseigner hinaus auf weitere Anspruchsträger“ die Grundlage für den langfristigen Erfolg eines Unternehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition
- Entstehungsgeschichte
- Der Stakeholder Ansatz
- Das Unternehmen als soziale Veranstaltung
- Ansprüche vs. Interessen
- Drei Dimensionen des Stakeholder Ansatzes
- Stakeholder Management
- Ziel des Stakeholder Managements
- Drei Management Ebenen
- Stakeholder Identifizierung
- Stakeholder Strategien in Führungsprozessen
- Stakeholder Transaktion
- Stakeholder Management in der Praxis
- Praxisbeispiel - Stakeholder Management bei der HASPA
- Qualitätsmessung mit TRI*M
- Beschwerdemanagement
- The HASPA ideas market
- Stakeholder Management und E-Business
- Fazit
- Zusammenfassung
- Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Stakeholder-Ansatz und sein Management im Kontext von Unternehmen. Das Ziel ist es, den Begriff zu definieren, seine Entstehung nachzuzeichnen und die verschiedenen Aspekte des Stakeholder Managements zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Anwendungen.
- Definition und historische Entwicklung des Stakeholder-Konzepts
- Der Stakeholder-Ansatz und seine verschiedenen Dimensionen
- Das Ziel und die Ebenen des Stakeholder Managements
- Praktische Anwendung des Stakeholder Managements anhand eines Beispiels
- Der Zusammenhang zwischen Stakeholder Management und E-Business
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Stakeholder Management ein. Sie definiert den Begriff "Stakeholder" und beleuchtet dessen historische Entwicklung, beginnend mit frühen Überlegungen von Adam Smith bis hin zur umfassenderen Betrachtung durch R. Edward Freeman. Die Einleitung hebt die anhaltende Debatte über die theoretischen Grundlagen und die praktische Umsetzung des Stakeholder Managements hervor.
Der Stakeholder Ansatz: Dieses Kapitel beschreibt den Stakeholder-Ansatz als Ausrichtung unternehmerischen Handelns an den Ansprüchen der Stakeholder. Es präsentiert verschiedene Perspektiven auf das Unternehmen, etwa als Netzwerk von interagierenden Anspruchsgruppen oder als pluralistisches Gebilde. Es werden unterschiedliche Anspruchsgruppen mit ihren Leistungen und erwarteten Gegenleistungen vorgestellt und der Unterschied zwischen Ansprüchen und Interessen diskutiert. Die drei Dimensionen des Stakeholder-Ansatzes (deskriptiv, instrumental und normativ) werden erläutert.
Stakeholder Management: Dieses Kapitel behandelt das Stakeholder Management selbst, beginnend mit der Definition des Ziels. Es werden die drei Managementebenen (Identifizierung, Strategien in Führungsprozessen und Transaktion) detailliert beschrieben, welche für eine erfolgreiche Implementierung unerlässlich sind. Dieser Abschnitt bildet die Brücke zur praktischen Anwendung des Konzepts.
Stakeholder Management in der Praxis: Dieses Kapitel analysiert das Stakeholder Management anhand eines Praxisbeispiels, vermutlich der HASPA. Es werden Methoden zur Qualitätsmessung (TRI*M) und zum Beschwerdemanagement sowie das „HASPA ideas market“ als konkrete Beispiele für erfolgreiche Stakeholder-Interaktionen präsentiert. Der Abschnitt beleuchtet zusätzlich den Zusammenhang zwischen Stakeholder Management und E-Business.
Schlüsselwörter
Stakeholder, Stakeholder Management, Anspruchsgruppen, Interessen, Unternehmen, Strategie, E-Business, Praxisbeispiel, HASPA, TRI*M, Beschwerdemanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Stakeholder Management"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit zum Stakeholder Management?
Diese Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über den Stakeholder-Ansatz und sein Management in Unternehmen. Sie beinhaltet eine Einleitung mit Begriffsdefinition und Entstehungsgeschichte, eine detaillierte Betrachtung des Stakeholder-Ansatzes mit seinen Dimensionen, eine ausführliche Beschreibung des Stakeholder Managements mit seinen drei Managementebenen (Identifizierung, Strategien, Transaktion), ein Praxisbeispiel (HASPA) mit konkreten Maßnahmen wie TRI*M, Beschwerdemanagement und dem "HASPA ideas market", sowie einen Ausblick auf den Zusammenhang zwischen Stakeholder Management und E-Business. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und Bewertung.
Was wird unter dem Stakeholder-Ansatz verstanden?
Der Stakeholder-Ansatz beschreibt die Ausrichtung unternehmerischen Handelns an den Ansprüchen verschiedener Anspruchsgruppen (Stakeholder). Die Arbeit beleuchtet das Unternehmen als Netzwerk interagierender Gruppen und diskutiert den Unterschied zwischen Ansprüchen und Interessen der Stakeholder. Drei Dimensionen des Ansatzes – deskriptiv, instrumental und normativ – werden erläutert.
Welche Managementebenen werden im Stakeholder Management behandelt?
Die Arbeit beschreibt drei Managementebenen: 1. **Stakeholder Identifizierung:** Das Erkennen und Definieren relevanter Anspruchsgruppen. 2. **Stakeholder Strategien in Führungsprozessen:** Die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Interaktion mit den Stakeholdern. 3. **Stakeholder Transaktion:** Die konkrete Interaktion und Kommunikation mit den Stakeholdern.
Welches Praxisbeispiel wird verwendet?
Als Praxisbeispiel wird das Stakeholder Management der HASPA (Hamburger Sparkasse) herangezogen. Die Arbeit präsentiert konkrete Maßnahmen wie die Qualitätsmessung mit TRI*M, das Beschwerdemanagement und das "HASPA ideas market" als Beispiele für erfolgreiche Stakeholder-Interaktionen.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Stakeholder Management und E-Business dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet den Einfluss des E-Business auf das Stakeholder Management, jedoch werden die genauen Details im Kontext des Praxisbeispiels (HASPA) besprochen. Es ist anzunehmen, dass die veränderte Kommunikations- und Interaktionslandschaft durch digitale Technologien im Fokus steht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Stakeholder, Stakeholder Management, Anspruchsgruppen, Interessen, Unternehmen, Strategie, E-Business, Praxisbeispiel, HASPA, TRI*M, Beschwerdemanagement.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Stakeholder-Ansatz zu definieren, seine historische Entwicklung nachzuvollziehen und verschiedene Aspekte des Stakeholder Managements zu beleuchten. Sie verbindet theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungen und zeigt die Relevanz des Stakeholder Managements im Kontext von Unternehmen auf, insbesondere im Zusammenhang mit E-Business.
- Quote paper
- Christian Kunzendorf (Author), 2005, Stakeholder Management. Überblick und Beispiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/73075