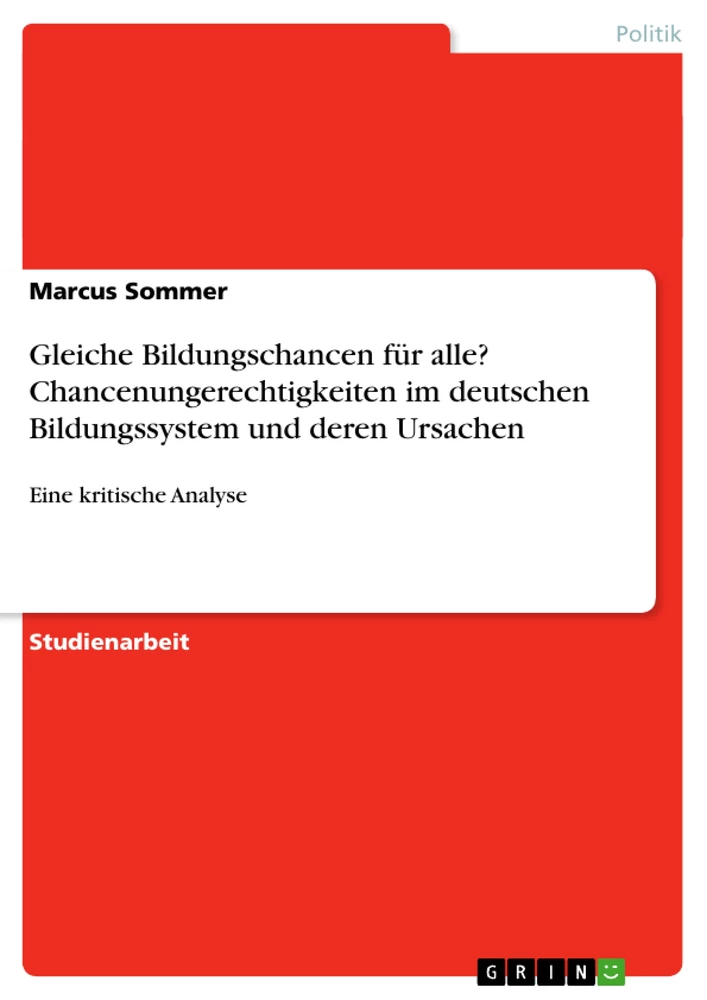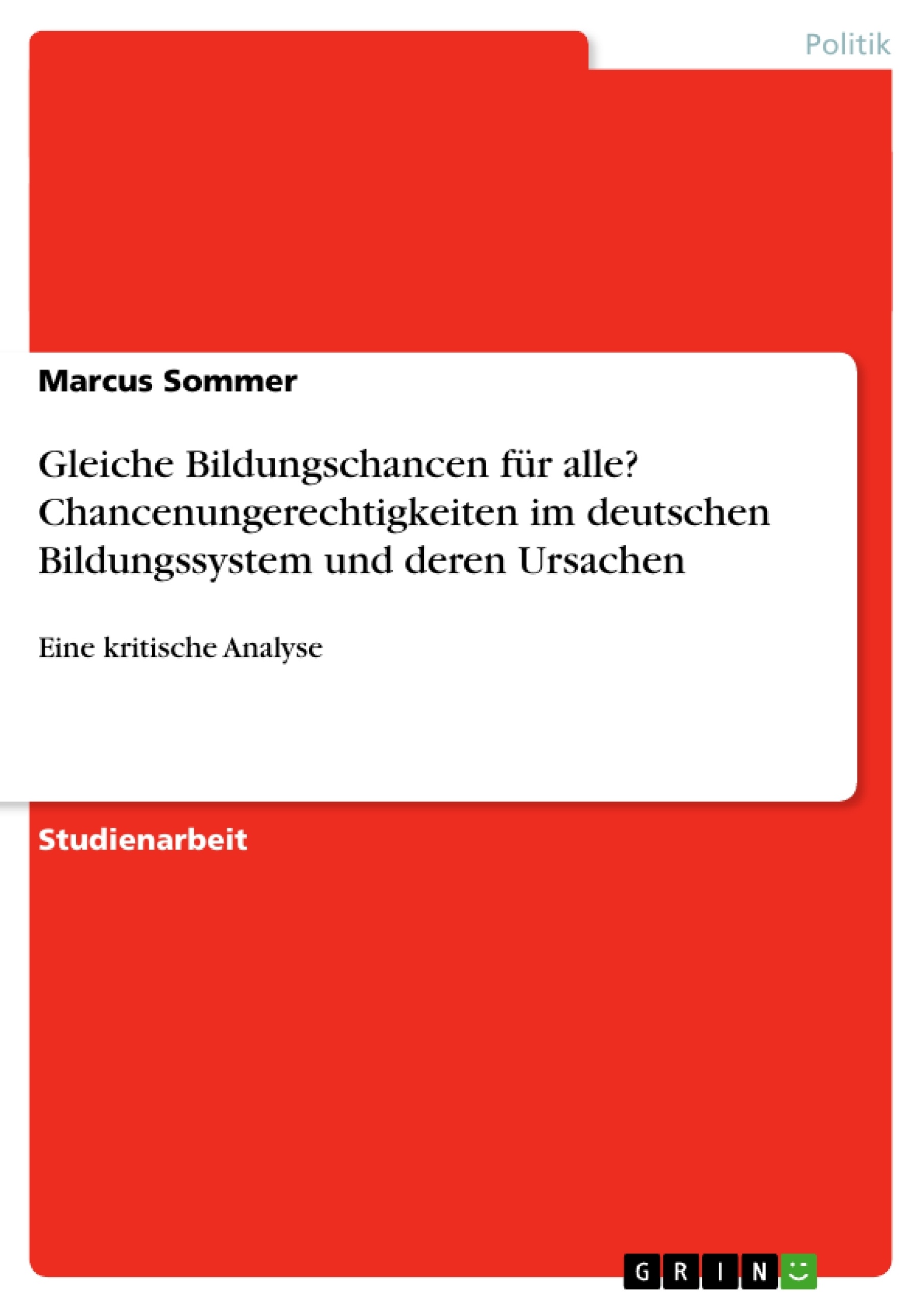„Bildungschancen sind Lebenschancen. Sie dürfen nicht von der Herkunft abhängen.“ Bundespräsident Horst Köhler schmettert diese mahnenden Worte in seiner ersten Berliner Rede im September 2006 durch die Aula der Kepler- Hauptschule in Berlin Neukölln. Vor ihm sitzen traditionsgemäß weitere hohe Repräsentanten des deutschen Staates. Gewerkschaftsfunktionäre, Wirtschaftseliten, Politiker – und mehrere Schüler aus der Schule, in der er spricht. Warum sagt Köhler das? Warum beschäftigt sich ein deutscher Bundespräsident gerade mit Bildungschancen?
Weil Deutschland ein Problem hat. Horst Köhler weiß: „Ein Kind aus einer Arbeiterfamilie hat im Vergleich zu dem Kind eines Akademikerpaares nur ein Viertel der Chancen, aufs Gymnasium zu kommen.“ Von höchster Stelle wird dem deutschen Bildungssystem eine enorme Schwäche attestiert. Statt Kinder entsprechend ihrer individuellen Leistungsfähigkeit den entsprechenden Schultypen zuzuordnen, beeinflusst anscheinend der soziale Status ihre Zukunft und Platzierung. Horst Köhler steht mit seiner Analyse nicht alleine da. Die Journalistin Christina Wandt bescheinigt dem deutschen Bildungssystem die Durchlässigkeit des „indischen Kastenwesens“, die aktuelle SHELL-Studie 2006 erklärt, dass „Jugendliche aus den sozial privilegierten Elternhäusern [...] aussichtsreichere Schulformen“ besuchen und Rolf Becker und Wolfgang Lauterbach geben ihrem 2004 publizierten Buch den provokanten Titel: „Bildung als Privileg?“ Deutschland im 21. Jahrhundert: Noch nie gab es in Deutschland so viele Gymnasiasten wie heute. Noch nie war die Quote an Studenten höher. Noch nie waren so viele Menschen im Bildungssektor beschäftigt. Doch scheinbar hat die enorme Bildungsexpansion es nicht geschafft, auch allen jungen Menschen die gleichen Chancen für ihren individuellen Erfolg zu ermöglichen. Anscheinend trägt der Geldbeutel der Eltern mit dazu bei, Schulform und Bildungschancen zu bestimmen.
Dieser Frage möchte sich die vorliegende Arbeit annehmen und mit Hilfe von empirischen Erkenntnissen aus der aktuellen Forschungslage klären. Ist im deutschen Bildungssystem die Chancengerechtigkeit außer Kraft gesetzt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bildungsexpansion in Deutschland
- Die Folgen der Bildungsexpansion: Ein quantitativer Sprung unter Beibehaltung sozialer Barrieren
- Kritische Stimmen zu Chancengerechtigkeit im Bildungssystem der BRD
- Empirische Analyse: Die Verteilung im deutschen Schulsystem nach sozialer Herkunft
- Erkenntnisse nach PISA: Die Abhängigkeit von Leistung nach sozialer Herkunft
- Gründe für die ungleichen Bildungschancen
- Brüche im Bildungssystems als Katalysatoren sozialer Ungleichheit
- Bildungsaspiration von Eltern
- Lehrerempfehlungen in Abhängigkeit vom sozialen Status der Eltern
- Das Problem der Objektivität der Leistungsbewertung
- Kulturelles Kapital der Eltern als Vorteil für den Bildungserfolg der Kinder
- Brüche im Bildungssystems als Katalysatoren sozialer Ungleichheit
- Auswege aus dem Dilemma: Möglichkeiten von Bildungspolitik zur Reduzierung sozialer Ungleichheiten im Bildungserfolg
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob im deutschen Bildungssystem Chancengerechtigkeit gewährleistet ist oder ob soziale Herkunft den Bildungserfolg von Kindern maßgeblich beeinflusst. Dabei werden empirische Erkenntnisse aus der aktuellen Forschungslage herangezogen, um die Ursachen möglicher Chancenungerechtigkeiten aufzudecken und Lösungsansätze für eine gerechtere Bildungslandschaft zu skizzieren.
- Entwicklung des deutschen Bildungssystems nach dem Zweiten Weltkrieg
- Analyse der Bildungsexpansion und ihrer Folgen
- Bedeutung der sozialen Herkunft für den Bildungserfolg
- Identifizierung von Faktoren, die ungleiche Bildungschancen fördern
- Möglichkeiten von Bildungspolitik zur Reduzierung sozialer Ungleichheiten im Bildungserfolg
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Hausarbeit beleuchtet die Problematik von ungleichen Bildungschancen in Deutschland und stellt die Frage, ob das deutsche Bildungssystem sozial gerecht ist. Die Einleitung skizziert den aktuellen Forschungsstand und die Zielsetzung der Arbeit.
- Die Bildungsexpansion in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des deutschen Bildungssystems nach dem Zweiten Weltkrieg und die stetige Zunahme der Bildungsexpansion, die sich in der steigenden Anzahl von Gymnasiasten, Abiturienten und Studenten zeigt. Der Anstieg der Bildungsteilnahme wird mit dem wachsenden Bedarf an qualifizierter Arbeitskraft und dem gesellschaftlichen Wandel erklärt.
- Die Folgen der Bildungsexpansion: Dieses Kapitel analysiert die Folgen der Bildungsexpansion auf die Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungssystem. Es werden kritische Stimmen zu diesem Thema beleuchtet und empirische Daten zur Verteilung im Schulsystem nach sozialer Herkunft untersucht. Die Analyse der PISA-Ergebnisse verdeutlicht die Abhängigkeit von Bildungserfolg von der sozialen Herkunft.
- Gründe für die ungleichen Bildungschancen: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Faktoren, die zu ungleichen Bildungschancen beitragen. Es werden Brüche im Bildungssystem, wie die Bildungsaspiration von Eltern und die Lehrerempfehlungen, beleuchtet sowie die Problematik der Objektivität in der Leistungsbewertung und die Rolle des kulturellen Kapitals der Eltern diskutiert.
- Auswege aus dem Dilemma: Dieses Kapitel stellt verschiedene Möglichkeiten vor, wie Bildungspolitik dazu beitragen kann, die sozialen Ungleichheiten im Bildungserfolg zu reduzieren. Es werden Ansätze zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungssystem beleuchtet.
Schlüsselwörter
Bildungsexpansion, Chancengerechtigkeit, soziale Herkunft, Bildungssystem, Bildungserfolg, PISA, Lehrerempfehlung, kulturelles Kapital, Bildungsaspiration, Bildungspolitik, Ungleichheit.
- Quote paper
- Marcus Sommer (Author), 2006, Gleiche Bildungschancen für alle? Chancenungerechtigkeiten im deutschen Bildungssystem und deren Ursachen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/71828