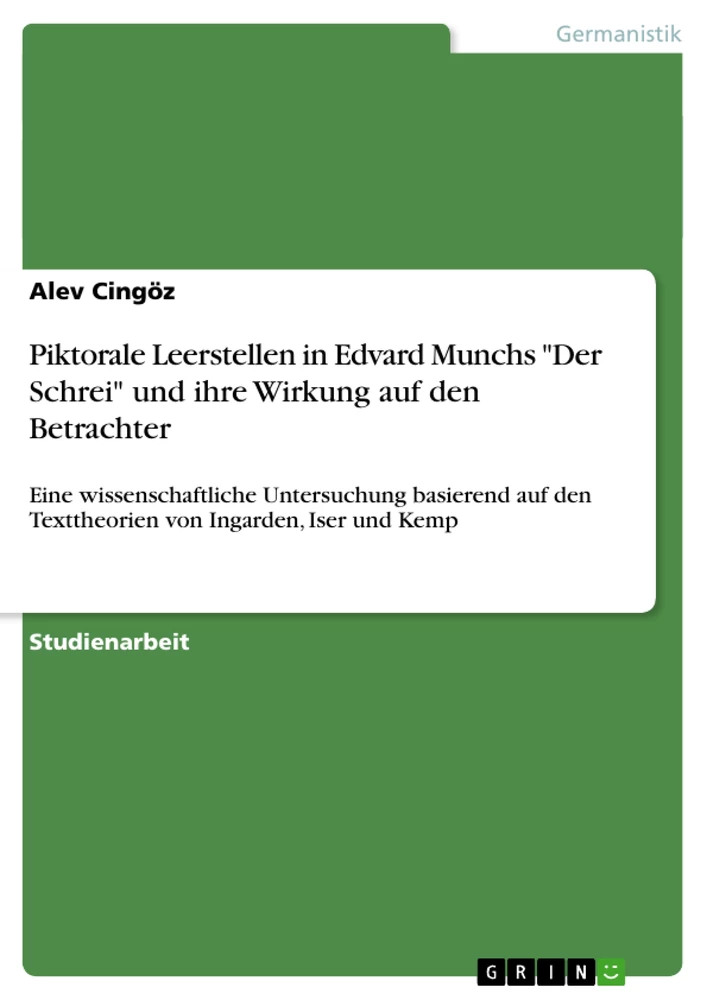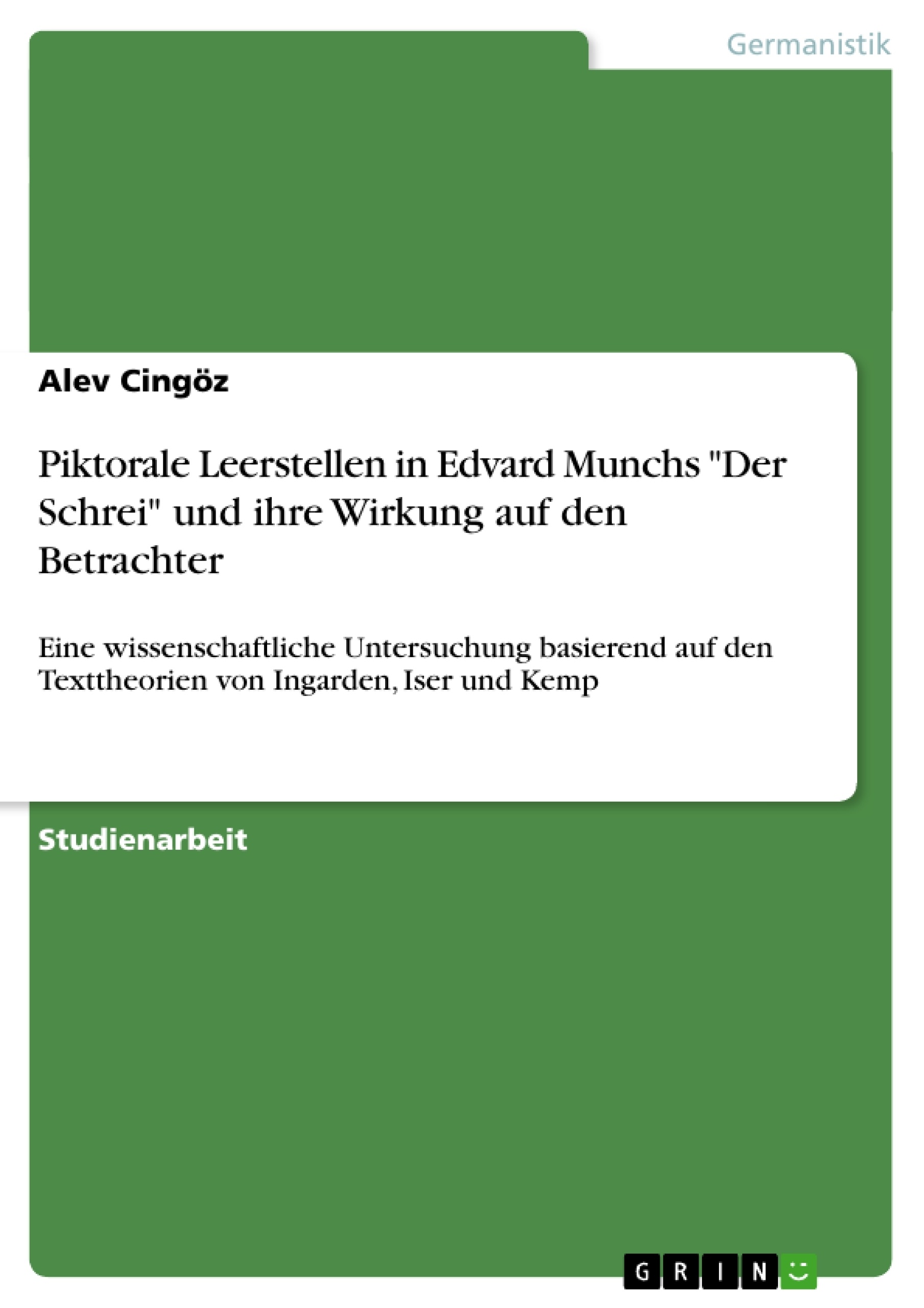Angesichts der zahlreichen Texttheorien in der Literaturwissenschaft und um sie herum sollte man mehrmals überdenken, eine weitere hinzuzufügen, um Überinterpretation und Interpretationsverdrossenheit zu vermeiden. Vor lauter Theorie bleibt der Blick für die Praxis oft zurück, man kann schlichtweg vieles nicht mehr nachvollziehen. Die Rezeptionsästhetik jedoch bietet einige interessante Ansätze, die sich auf die vielfältigsten Texte anwenden lassen. So auch Roman Ingardens Theorie der Unbestimmtheitsstellen, welche anschließend von Wolfgang Iser zu Leerstellen modifiziert wurde und von anderen auf unterschiedliche Bereiche bzw. Medien wie Musik, Film und Malerei übertragen wurde.
Wolfgang Kemp beispielsweise übertrug die Theorie der Leerstellen, die zunächst nur auf Texte angewandt wurde, auf die bildende Kunst und machte in seinem Aufsatz Verständlichkeit und Spannung. Über Leerstellen in der Malerei des 19. Jahrhunderts deutlich, dass es Leerstellen, und zwar so genannte piktorale Leerstellen, auch in Gemälden gibt. Doch gibt es zu dieser Theorie nur wenig Material und wenig Beispiele. Dieses Gebiet wurde anscheinend noch zu wenig erforscht. Die Frage ist: Gibt es wirklich Leerstellen in den meisten oder gar allen Bildern? Gibt es da verschiedene Arten von Leerstellen? Sind alle von jener Art, die Kemp in seinem Aufsatz vorstellt, also jene funktionalen Leerstellen, die es dem Betrachter ermöglichen, die dargestellten Gegenständlichkeiten im Bild miteinander zu kombinieren und so eine mögliche Situation des Bildes herauszufiltern? Für diese Untersuchung betrachten wir ein Bild, das sehr bekannt ist, und zwar Edvard Munchs Gemälde „Der Schrei“ aus dem Jahre 1893. Dieses Bild ist von einer anderen Art als dass man eine klare, mögliche Situation aus den dargestellten Gegenständlichkeiten filtern könnte. Wir wollen, als Nicht-Kunsthistoriker, uns einmal daran versuchen, nur mit der Grundkenntnis der Texttheorien, ein Bild zu untersuchen und herauszufinden, ob sich piktorale Leerstellen darin befinden oder nicht. Und wenn sich welche erkennen lassen: Welche Bedeutung haben sie? Wie wirken sie auf den Betrachter? Was hat dies alles mit dem Künstler, gegebenenfalls mit der Zeit bzw. der Kunstepoche zu tun? Dies soll hier geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Die Texttheorien
- Ingardens Theorie der Unbestimmtheitsstellen
- Isers Theorie der Leerstellen
- Piktorale Leerstellen
- Das Leben und die Kunst Edvard Munchs
- Leerstellen im „Schrei“?
- Fazit: Wie wirken die Leerstellen auf den Betrachter?
- Zusammenfassender Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Wirkung von „piktoralen Leerstellen“ im Gemälde „Der Schrei“ von Edvard Munch, basierend auf den Texttheorien von Ingarden, Iser und Kemp. Sie beleuchtet die Rezeption des Bildes und analysiert, wie die Leerstellen die Interpretation des Betrachters beeinflussen.
- Anwendung der Texttheorien von Ingarden, Iser und Kemp auf bildende Kunst
- Analyse von „piktoralen Leerstellen“ in „Der Schrei“ von Edvard Munch
- Rezeption des Bildes und der Einfluss von Leerstellen auf den Betrachter
- Bedeutung von Leerstellen für die Interpretation von Kunstwerken
- Verknüpfung von Texttheorie und bildender Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Texttheorien von Ingarden, Iser und Kemp. Anschließend werden die Lebensgeschichte und die Kunst Edvard Munchs beleuchtet, um einen Kontext für die Analyse von „Der Schrei“ zu schaffen. Im dritten Kapitel werden die piktoralen Leerstellen im Bild untersucht, wobei ein Fokus auf die Wirkung auf den Betrachter liegt.
Schlüsselwörter
Texttheorie, Rezeptionsästhetik, Unbestimmtheitsstellen, Leerstellen, Piktorale Leerstellen, Edvard Munch, Der Schrei, Interpretation, Betrachter, Wirkung, Bildanalyse, Kunstgeschichte.
- Quote paper
- Alev Cingöz (Author), 2006, Piktorale Leerstellen in Edvard Munchs "Der Schrei" und ihre Wirkung auf den Betrachter, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/71498